
The Project Gutenberg eBook of Im Herzen von Asien. Zweiter Band., by Sven Hedin
Title: Im Herzen von Asien. Zweiter Band.
Author: Sven Hedin
Release Date: June 25, 2022 [eBook #68403]
Language: German
Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1919 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen, Schreibvarianten sowie fremdsprachliche Passagen bleiben gegenüber dem Original unverändert.
Die Bandnummerierung im Umschlagbild wurde vom Bearbeiter hinzugefügt. Dieses Bild wurde in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.
In der verwendeten Buchvorlage waren die Abbildungen 244 und 245 nicht nummeriert; auch die sonst üblichen Seitenverweise fehlen in der Bildunterschrift. Der Einheitlichkeit halber wurde die Nummerierung vom Bearbeiter hinzugefügt.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Im Herzen von Asien.
Zweiter Band.
Zehntausend Kilometer
auf unbekannten Pfaden.
Von
Sven v. Hedin.
Mit 341 einfarbigen und bunten Abbildungen und 5 Karten.
Autorisierte Ausgabe.
Vierte Auflage.
Zweiter Band.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.
1919.
[S. v]
|
Seite
|
|
| Erstes Kapitel. Nach dem Anambaruin-gol | |
| Zweites Kapitel. Bei den Särtängmongolen und durch die Gobiwüste | |
| Drittes Kapitel. Durch unbekanntes Land auf der Suche nach Wasser | |
| Viertes Kapitel. Die Ruinen am alten Lop-nor | |
| Fünftes Kapitel. Lôu-lan | |
| Sechstes Kapitel. Ein Nivellement durch die Lopwüste | |
| Siebentes Kapitel.Der wandernde See | |
| Achtes Kapitel. Islam Bais Schicksal | |
| Neuntes Kapitel. Über die nördlichen Randgebirge nach dem Kum-köll | |
| Zehntes Kapitel. Die Zusammensetzung der Karawane | |
| Elftes Kapitel. Im Schneesturm über den Arka-tag | |
| Zwölftes Kapitel. Die ersten Tibeter | |
| Dreizehntes Kapitel. Das Hauptquartier | |
| Vierzehntes Kapitel. Aufbruch nach Lhasa | |
| Fünfzehntes Kapitel. Die ersten Nomaden | |
| Sechzehntes Kapitel. In kritischer Lage | |
| Siebzehntes Kapitel. In Gefangenschaft der Tibeter | |
| Achtzehntes Kapitel. Rückzug unter Bewachung | |
| Neunzehntes Kapitel. Die letzten Tagemärsche nach dem Hauptquartier | |
| Zwanzigstes Kapitel. Der Zug nach Süden | |
| Einundzwanzigstes Kapitel. Tibetische Truppen versperren uns wieder den Weg | |
| Zweiundzwanzigstes Kapitel. Der Nakktsong-tso | |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel. Der Tschargut-tso | |
| Vierundzwanzigstes Kapitel. Die lange Reise nach Ladak | |
| Fünfundzwanzigstes Kapitel. Via dolorosa | |
| Sechsundzwanzigstes Kapitel. Der Tso-ngombo | |
| Siebenundzwanzigstes Kapitel. Vom Panggong-tso nach Leh | |
| Achtundzwanzigstes Kapitel. Ein Besuch in Indien | |
| Neunundzwanzigstes Kapitel. Über das Kloster Hemis heimwärts | |
| Register. |
[S. vi]
|
Seite
|
||
|
„Einen Schritt weiter — und es kostet euch den Kopf!“
(Titelbild)
|
||
|
8
|
||
|
9
|
||
|
Der Platz, an dem wir umkehrten
|
16
|
|
|
17
|
||
|
Im Tale des Anambaruin-gol. Blick nach Nordwesten
|
28
|
|
|
Blick nach Südosten vom Lager am Anambaruin-gol
|
29
|
|
|
32
|
||
|
Mein mongolischer Führer
|
33
|
|
|
An den Felsen von Dschong-duntsa
|
44
|
|
|
Das Lager im Tale von Dschong-duntsa
|
45
|
|
|
Unsere Kamele im Tale von Dschong-duntsa
|
48
|
|
|
Das Lager in Lu-tschuentsa
|
49
|
|
|
Die Karawane auf dem Eise des Lu-tschuentsa-Baches
|
56
|
|
|
57
|
||
|
Lager mitten in der Sandwüste
|
68
|
|
|
Brunnen, in der letzten Oase gegraben
|
69
|
|
|
69
|
||
|
Prüfung des Nivellierinstruments bei Altimisch-bulak
|
69
|
|
|
80
|
||
|
Der erste Turm der untergegangenen Stadt
|
81
|
|
|
Aussicht von dem Tora des Hauptquartiers.
204. Das Haus beim Lager
|
88
|
|
|
Der Lehmturm von der Südseite
|
89
|
|
|
96
|
||
|
Ausgrabungen im Buddhatempel. 210.
Schnitzereien in Pappelholz
|
97
|
|
|
Geschnitzte Holzstücke aus den Ruinen
|
104
|
|
|
105
|
||
|
Ausgrabungen in einem der Häuser von Lôu-lan
|
112
|
|
|
Die Nivellierungskarawane. 217. Lager
am Wasserarm
|
113
|
|
|
120
|
||
|
Im Schatten der Weiden am Seraiteich in Tscharchlik
|
121
|
|
|
Ein Teil des Stallhofes unseres Serai
|
128
|
|
|
Schereb Lama auf dem „Gelbohr“. 224.
Der Tag vor dem Aufbruch
|
129
|
|
| [S. vii] |
Unser Lager in Jiggdelik-tokai
|
136
|
|
Der Tscharchlik-su bei der letzten, scharfen
Durchbruchsbiegung
|
137
|
|
|
Unser Lager in Unkurluk. Blick auf das Nebental
|
144
|
|
|
Die am Ufer des Kum-köll aufgestapelten Kamellasten.
229. Ankauf von Schafen bei den Hirten von Unkurluk
|
145
|
|
|
Die Kamele am Ufer des Kum-köll
|
152
|
|
|
Turdu Bais Zelt
|
153
|
|
|
Eine angeschossene Orongoantilope
|
160
|
|
|
Erlegter tibetischer Bär
|
161
|
|
|
168
|
||
|
Sirkin mit meinem alten Reisekameraden von 1896.
238. Endlich in einer Gegend mit gutem Wasser
|
169
|
|
|
176
|
||
|
Die beiden Eisbänder im Tal. 243.
Bahnen eines Wegs
|
177
|
|
|
Kosak Schagdur, der Verfasser und der Lama Schereb als
mongolische Pilger
|
184
|
|
|
Der Verfasser als mongolischer Pilger verkleidet
|
185
|
|
|
Ein nächtlicher Überfall
|
192
|
|
|
Die drei Pilger beim Aufbruche aus dem Hauptquartier
|
193
|
|
|
Lager der drei Pilger
|
200
|
|
|
Auf dem Wege nach Lhasa in strömendem Regen
|
201
|
|
|
Ein junger tibetischer Hirt. 251.
Älterer Tibeter
|
208
|
|
|
209
|
||
|
Die Tibeter schwangen ihre Lanzen und heulten wie die Wilden
|
216
|
|
|
Zelte tibetischer Häuptlinge
|
217
|
|
|
Tibetische Kavallerie
|
224
|
|
|
Tibetische Soldaten
|
225
|
|
|
232
|
||
|
Hirten von Dschansung im Gespräch mit dem Lama im Lager
|
233
|
|
|
Der Lama als Gehilfe beim Photographieren der Hirten
|
240
|
|
|
241
|
||
|
248
|
||
|
Der tote Kalpet auf seinem lebenden Katafalk
|
249
|
|
|
Kalpets Grab
|
256
|
|
|
Hladsche Tsering, das Mitglied des Heiligen Rates, seine
Pfeife rauchend
|
257
|
|
|
Die Gouverneure Hladsche Tsering und Junduk Tsering.
274. Hladsche Tsering und Junduk Tsering
|
260
|
|
|
Blick nach Westen am Strande des Tschargut-tso
|
261
|
|
|
Bunte Tafel.
„... und jagten dann im wilden Laufe vor, hinter und durch die Zelte, als
wollten sie uns niederreiten!“ Von Langlet
|
265
|
|
|
Die Garde der tibetischen Gesandten am Tschargut-tso
|
272
|
|
|
Im Kampf mit Wogen und Wind auf dem Tschargut-tso
|
273
|
|
|
280
|
||
|
Das Ufer des Boggtsang-sangpo
|
281
|
|
| [S. viii] |
Gebirge im Norden des Lagers Nr. 92
|
288
|
|
Gebirge im Norden des Lagers Nr. 92
|
289
|
|
|
Die Anführer unserer Leibwache
|
296
|
|
|
Das Tal des Boggtsang-sangpo
|
297
|
|
|
304
|
||
|
Lager Nr. 109 im Westen des Lakkor-tso
|
305
|
|
|
Das Gebirge auf der nördlichen Talseite bei Lager Nr. 114
|
312
|
|
|
Das Gebirge auf der südlichen Talseite bei Lager Nr. 114
|
313
|
|
|
Das Gebirge auf der südlichen Talseite bei Lager Nr. 114
|
320
|
|
|
Das Nordufer des Tsolla-ring-tso.294.
Lager an einem zugefrorenen Sumpfe
|
321
|
|
|
324
|
||
|
325
|
||
|
Doppelte Geröllterrassen
|
328
|
|
|
Das Tempeldorf Noh
|
329
|
|
|
332
|
||
|
Beförderung des Gepäcks auf einem improvisierten Schlitten
über das Eis
|
333
|
|
|
336
|
||
|
Am Panggong-tso
|
337
|
|
|
Gulang Hiraman, der Gesandte des Statthalters von Ladak, mit
seinem Gefolge
|
340
|
|
|
Gulang Hiraman auf seinem Pony
|
341
|
|
|
Musikanten und Tänzer in Drugub. 314.
Lager vom 16. Dezember
|
344
|
|
|
Kloster Dschova
|
345
|
|
|
348
|
||
|
Leh, die Hauptstadt von Ladak
|
349
|
|
|
Se. Exzellenz George Nathanael Lord Curzon, Vizekönig von
Indien
|
352
|
|
|
Ankunft der einzigen überlebenden Kamele in Leh
|
353
|
|
|
Schneesturm auf dem Passe Sodschi-la
|
356
|
|
|
Tempelhof in Hemis. 324. Portal von
Doggtsang Raspas Tempelsaal
|
357
|
|
|
Doggtsang Raspa
|
360
|
|
|
361
|
||
|
Aus der Klosterküche in Hemis
|
364
|
|
|
Trompetende Lamas. 331.
Posaunenblasende Lamas
|
365
|
|
|
368
|
||
|
369
|
||
Karten.
Mitteltibet. Maßstab 1 : 2000000.
Übersichtskarte der Reise Sven v. Hedins, 1899–1902. Maßstab 1 : 14000000.
[S. 1]
Sechs Tage durfte ich mich im Hauptquartier in Temirlik ausruhen, wo die Eisberge um die Quellen herum beständig größer wurden und die Kälte bis auf −27 Grad sank. Von wirklicher Ruhe konnte freilich keine Rede sein, denn ich hatte tausend Dinge zu besorgen. Noch einmal wurde an diesem wichtigen Kontrollpunkte eine vollständige astronomische Beobachtungsreihe ausgeführt, die zuletzt aufgenommenen Platten wurden entwickelt, eine neue Post nach Kaschgar geordnet und alle Abrechnungen für die Karawane, die Verproviantierung und die Lohnzahlungen besorgt.
Ein Andischaner Kaufmann, der aus eigenem Antrieb in mein Lager gekommen war, um dort Geschäfte zu machen, starb an der gewöhnlichen schweren Bergkrankheit und wurde mit den üblichen Zeremonien begraben. An einem sonnigen Tage wurde der kranke Togdasin ins Freie gebracht, und alle Muselmänner sammelten sich um ihn, um durch allerlei Gebetformeln sein Übel zu verjagen; dabei opferten sie Allah auch einen Bock.
Viele Zeit verschlangen alle die Vorbereitungen zur bevorstehenden Expedition durch die östlichen Wüsten. Der Proviant, der nach meiner Berechnung für eine Reise von gegen 2000 Kilometer nötig war, wurde beiseite gestellt und in Kisten und Säcken auf den Sattelleitern der Kamele festgebunden. Meine kleine Jurte wurde gründlich repariert, die Kuppel mit rotem Filz und der Zylinder mit weißem bekleidet, so daß das Ganze aus der Ferne wie eine dänische Flagge aussah. Tscherdon erhielt gründlichen Unterricht in meteorologischer Beobachtungskunst, womit er schon auf dem Ausfluge nach dem Kum-köll hatte beginnen müssen. Er sollte während meiner Abwesenheit die Ablesungen besorgen und den Barographen und Thermographen im Gang halten.
Zurückgelassen wurden nur Tscherdon, Islam Bai, Turdu Bai und Ali Ahun; aber fünf Mann von den Jägern und Goldgräbern wurden angestellt, um ihnen bei dem Umzuge nach Tscharchlik zu helfen, wo der Amban und seine eingeborenen Beke versprochen hatten, sich ihrer anzunehmen.[S. 2] Dort hatten sie übrigens nichts weiter zu tun, als unsere Rückkehr abzuwarten, meine kostbaren Kisten und Aufzeichnungen zu hüten und die Tiere zu pflegen, damit diese in gutem Zustande wären, wenn ich im Frühling wiederkam. Islam sollte auch dafür sorgen, daß von Abdall aus zwei Kähne mit Rudern und Fischnetzen rechtzeitig nach dem zu den Kara-koschun-Sümpfen gehörenden See Tschöll-köll gebracht würden. Da wo sie untergebracht würden, sollte auf einer Düne ein weithin sichtbares Nischan (Wahrzeichen) errichtet werden, damit wir die Kähne finden könnten. Ich sah nämlich ein, daß es uns nicht möglich sein würde, jene Gewässer noch vor dem Schmelzen des Eises zu erreichen.
Die neue Expedition war folgendermaßen zusammengesetzt: der Kosak Schagdur, die Muselmänner Faisullah (Karawan-baschi), Tokta Ahun und Mollah aus Abdall (Führer nach Anambar-ula), Kutschuk, Chodai Kullu, Chodai Värdi, Ahmed und der kürzlich ausfindig gemachte Jäger Tokta Ahun, der, um Verwechslungen mit seinem Namensbruder vorzubeugen, Li Loje genannt wurde; er sprach chinesisch und mongolisch, hatte in Bokalik Pferde gestohlen und war ein bißchen verrückt. Elf Kamele trugen das Gepäck, und elf Pferde wurden zum Reiten benutzt; wir hatten also nur ein Reservepferd, beabsichtigten aber, falls es nötig sein sollte, bei den Mongolen neue Pferde zu kaufen. Drei Hunde, Jolldasch, Malenki und Maltschik, sollten uns begleiten. Da es meine Absicht war, den Gas-See auszuloten, mußte Turdu Bai ein paar Tage mit dem Boote mitkommen. Er wünschte die ganze Reise mitzumachen, bedurfte aber nach den Mühen, die er ausgestanden hatte, der Ruhe.
So brach denn der ersehnte Aufbruchstag, der 12. Dezember, an, und wir sollten Temirlik endgültig verlassen. Ich wurde geweckt, als es noch dunkel war; die Männer trieben die Pferde an, und die Kamele standen gebunden neben den ihrer wartenden Lasten. Der Tag graute; es wurde klar und hell, die Luft war still, der Himmel rein, und richtiges Frühlingswetter herrschte, als wir aufbrachen. Alle Kamele waren gleichmäßig beladen, aber die Lasten konnten mit Leichtigkeit so verteilt werden, daß einige Tiere für den Eistransport frei blieben (Abb. 168, 169).
Alle machte die jetzt bevorstehende Reise froh und angeregt. Ich selbst sehnte mich nach den Annehmlichkeiten des Wüstenlebens. Hagelstürme und Schneetreiben hatten wir dort nicht zu fürchten. Kälte erwartete uns freilich, da jetzt Mittwinter bevorstand, aber es würde eine trockene Kälte sein, die sich mit Brennholz mildern läßt. Schön war es auch, drei volle Wintermonate vor sich und demnach die Aussicht zu haben, daß die meisten Probleme der Exkursion gelöst sein würden, wenn die warmen Frühlingstage kamen. Wir waren aber auch darauf vorbereitet, daß sich die Arbeiten[S. 3] noch auf die wärmere Jahreszeit erstrecken könnten, und hatten deshalb leichte Sommerkleidung mitgenommen. Mein eigenes Gepäck umfaßte drei große Kisten mit Instrumenten, Büchern, Karten, Platten, Tage- und Marschroutenbüchern, Tabak, Kleidungsstücken, chinesischem Silbergelde usw.
Nach freundlichem Abschied von den Zurückbleibenden und dem armen Togdasin kommandierte ich „Marsch“, und nun läuteten die Karawanenglocken der langen, dunkeln Reihe der Kamele, die jetzt in königlicher Haltung von Sum-tun-buluk fortzogen, den „300 Quellen“, wie Temirlik von den Mongolen mit zwei tibetischen und einem mongolischen Worte genannt wird. Alle Kamele, sogar unser einziges Dromedar, das ein boshaftes Vieh war, betrugen sich gut. Der Gischt umgab die Lippen des Dromedars wie Seifenschaum und tropfte überall auf seinem Wege in großen Flocken auf die Erde. Daß es sich im ganzen dennoch manierlich betrug, war nicht sein eigenes Verdienst; hätte es nur gekonnt, so würde es schon Unfug angestiftet haben. Sein eines Vorderbein war am Packsattel festgebunden, so daß es, ohne im geringsten im Gehen gehindert zu sein, doch nicht laufen konnte. Mit dem unmittelbar vor ihm gehenden Kamel war es mittelst eines Strickes und einer Kette verbunden und konnte seine Nachbarn nicht beunruhigen, und sein Maul steckte in einer Halfter, die ihm nicht erlaubte, zu beißen. Prächtig sah er aus, dieser Veteran von Kaschgar, mit seinen funkelnden, wilden, kohlschwarzen Augen, die er, wenn er schlechter Laune war, manchmal so verdrehte, daß nur das Weiße zu sehen war.
Die Karawane als Ganzes betrachtet hatte sich gründlich ausgeruht und war in bestem Zustand; einige Kamele hatten nicht einmal Lasten getragen, seit sie vor mehr als einem Jahre nach Jangi-köll gekommen waren. Jetzt steckten sie auch in ihren Winterpelzen, wahren Dickichten von Wolle. Zwei der ruhigsten, größten Tiere trugen mein persönliches Gepäck; im übrigen hatten Mehl, Reis, Mais und Talkan (geröstetes Mehl) das größte Gewicht; aber die Vorräte verminderten sich täglich, und wenn wir die Gegenden erreichten, wo Eis und Brennholz mitgenommen werden mußten, würde schon Platz dafür frei sein.
Von Faisullah geführt und von seiner Reiterwache eskortiert, schritten die Kamele mit großen Schritten rüstig vorwärts.
Das Programm für die Wanderung, die auf diese Weise begann, war folgendes: Ich wollte über den Astin-tag und an ihm entlang ziehen, um seine orographische Struktur klarzulegen. Der Weg führte also nordostwärts nach einer Gegend, welche die Mongolen, die sich dort aufzuhalten pflegen, Anambar-ula (mit der Genetivendung Anambaruin), die Muselmänner aber Chan-ambal nennen; das letztere Wort ist eine Korruption[S. 4] des ersteren. Wir hatten 400 Kilometer dorthin, und von dort sollte es erst nach Norden durch einen unbekannten Teil der Gobiwüste und dann nach den nördlich davon gelegenen Bergketten hinaufgehen. Darauf wollten wir nach Westen ziehen und versuchen, nach der früher erwähnten Quelle Altimisch-bulak und den Ruinen in der Wüste zu gelangen, und schließlich durch die Wüste nach Abdall und Tscharchlik, dem nächsten großen Sammelplatz, wandern.
Die Reise nach Anambar, die ich in Kürze beschreiben werde, erforderte 17 Marschtage. Die beiden ersten führten uns über steinhart gefrorene Sümpfe mit knisterndem Salz und kantigen Lehmschollen nach einer Quelle im Norden des Gas-Sees. Am 14. Dezember machte ich mit einer ganz kleinen Karawane eine Exkursion nach dem See, dessen Tiefen ich im Boote zu loten beabsichtigte. Mir war gesagt worden, er sei so salzig, daß er nie zufriere. Ein Kulanpfad zeigte uns den besten Weg nach dem Ufer, wo das Erdreich trotz der Kälte so weich war, daß die Pferde bis an die Knie in den Schlamm einsanken. Hier und dort lagen Eisschollen, die wir als Brücken benutzen konnten, doch oft waren sie so dünn, daß die Pferde durch sie durchtraten und fielen. Es war keine leichte Sache, diesen tückischen Strand zu erreichen; aber schließlich gelang es uns und wir lagerten an dem Punkte, wo die in einem Bette vereinigten Quellbäche des Tschimentales in den See münden. Hier gab es süßes Wasser nebst Kamisch an den Ufern, und Feuerung hatten wir selbst. In einiger Entfernung zeigten sich fünf Yake. Es sollte gerade Jagd auf sie gemacht werden, als Tokta Ahun merkte, daß der eine gefleckt war, es sich hier also um zahme Tiere handelte. Sie waren wahrscheinlich aus dem nächsten Mongolenlager durchgebrannt.
Aus der Seefahrt sollte jedoch nichts werden, denn soweit der Blick reichte, war der Spiegel des Sees mit einer Eisdecke überzogen. Da wir aber das Boot einmal mitgenommen hatten, sollte seine eine Hälfte wenigstens als Schlitten dienen. Sein Holzrahmen gab vorzügliche Kufen ab, und in dieser leichten Equipage wurde ich von Tokta Ahun und Chodai Kullu schnell und vergnügt über den See gezogen. Das Eis war ungleichmäßig, bald höckerig, bald mit einer dünnen Wasserschicht bedeckt, bald von Rissen durchfurcht. Der Schlitten hüpfte über alle Hindernisse hinweg, und ich glaubte, ich würde ein paar Lotungslinien über den ganzen See bekommen. Doch auf einmal fing die Eisdecke an zu knacken und in Wellenbewegung zu geraten. Tokta Ahun brach ein und hätte ein Bad genommen, wenn er sich nicht noch rechtzeitig an dem Boote gehalten hätte.
Nach einer ruhigen Nacht am Ufer dieses seichten Salzsumpfes kehrten wir am nächsten Tage wieder um und trafen die Karawane an den Quellen von Julgun-dung (Abb. 170).
[S. 5]
Während des Rasttages, den wir hier zubrachten, schickte ich Tokta Ahun nach dem Akato-tag hinauf, um zu erforschen, ob das sich im Nordosten unseres Lagers öffnende Tal von der Karawane passiert werden könne. Er kam am Abend mit dem Bescheid zurück, daß das Tal nach einem Passe hinaufgehe, von dem auf der Nordseite der Kette ein ebensolches Tal nach den unmittelbar südlich vom Astin-tag liegenden Ebenen hinabführe, daß dieser Weg also vorzüglich sei.
So brauchten wir am 17. Dezember nur seiner Spur zu folgen. Die Nacht war bis jetzt die kälteste in diesem Winter gewesen, −29,6 Grad kalt. Turdu Bai kehrte mit dem Boote nach Temirlik zurück.
Wir lassen diesen kümmerlichen Vegetationsgürtel, der der „Tamariskenquelle“ (Julgun-dung) ihren Namen gegeben hat, hinter uns zurück; der langsam nach dem Gebirge ansteigende Boden ist unfruchtbar und mit Schutt bedeckt. Wieder treten wir in die stillen Bergsäle durch ein 100 Meter breites Tor ein, wo eine 2 Meter tief eingeschnittene Rinne das Wasser abfließen läßt, das gelegentlich einmal auf diese trockenen Höhen herabregnet. Den ganzen Tag führte der Talgrund langsam aufwärts; er war so eben wie eine Asphaltstraße, machte aber scharfe Biegungen, in denen ich selten längere Peilungen als drei Minuten in derselben Richtung machen konnte, bis ein neuer Vorsprung die Aussicht auf die nächste Talbiegung verdeckte.
Das Material, aus dem der Akato-tag in dieser Gegend aufgebaut ist, besteht ausschließlich aus feinem gelbem Ton, der so locker ist, daß man schon mit der Hand Stücke davon abbrechen kann. Das Regenwasser hat also bei der Ausarbeitung des Terrains in wilde, phantastische Formen keine Schwierigkeiten zu überwinden. Unzählige kleine Täler und Hohlwege münden auf beiden Seiten mit dunkeln, oft nur meterbreiten Toren und lotrechten Wänden in dieses Tal ein. Alles ist steril, kalt und trocken. Auch das Haupttal (Abb. 171), dem wir folgen, ist manchmal so eng, daß ein paar von den Männern sich an den vorspringenden Ecken aufstellen müssen, damit die Kamele mit ihren Lasten nicht dagegenprallen.
Dann und wann öffnet sich der seltsame Hohlweg vor uns zu einer phantastischen Perspektive mit lotrechten, ja bisweilen überhängenden Kulissen. Heruntergestürzte Blöcke in jeder nur denkbaren Gestalt, wie Würfel, Kugeln und Tetraeder, liegen als Warnungszeichen mitten im Tale. Andere sind sichtlich auf dem Sprunge, herunterzufallen; man begreift nicht, was sie noch festhält; ein Windstoß oder ein leichter Regen würde genügen, um sie ins Rutschen zu bringen. Wir sind ordentlich beruhigt, wenn der ganze Zug an derartigen gefährlichen Stellen glücklich vorbeigekommen ist. Pyramiden, Mauern und Türme von Ton, Terrassen, Korridore und Grotten[S. 6] folgen einander in endloser Reihe. Die Karawane zieht mitten auf dem ebenen gelben Tonboden des Tales, auf dem die Kamele, wenn er feucht wäre, wie auf Eis ausgleiten würden, wo sie jetzt aber sicher gehen, ohne mit ihren weichen Fußschwielen eine Spur zu hinterlassen.
Allmählich nehmen die relativen Höhen ab, und das Tal verliert seinen Hohlwegcharakter. Bis an den Paß kamen wir nicht, lagerten aber in seiner Nähe. Überzeugt, daß wir nie im Leben hierher zurückkehren würden, verließen wir am Morgen in aller Frühe diesen stillen öden Lagerplatz. Tokta Ahun und noch einige waren vorausgegangen, um einen steilen, mühsam zu erklimmenden Abhang an der eigentlichen Paßschwelle mit Spaten zu bearbeiten (Abb. 172). Es wunderte mich, daß sie, statt in dem nach Norden führenden Haupttale hinaufzugehen, nach Osten in ein Seitental abgebogen waren, welches so schmal war, daß man an den Kamelen, wenn sie in den Biegungen warteten, nicht vorbeikommen konnte. Nun, der Führer würde wohl Bescheid wissen. Bald darauf befanden wir uns unter dem steilen Abhange des Passes, der schwierig aussah und auf dem die Spaten unter aufwirbelnden Staubwolken in voller Tätigkeit waren.
Jetzt mußte das erste Kamel heran, das sich mit einigen mühsamen Rucken hinaufarbeitete. Alle Männer schoben von hinten nach und stützten die Lasten. Einige Tiere fielen und mußten abgeladen werden, worauf ihre Lasten hinaufgetragen wurden. Das Kamel, das den viel Platz einnehmenden Holzvorrat trug, hatte es am schlimmsten, aber es machte seine Sache bis auf einen kleinen Kniefall gut.
Von dem Passe (3466 Meter) ging es nach Südosten, was mir sofort verdächtig vorkam; aber der Weg war ja rekognosziert, und Tokta Ahun stand dafür ein, daß das hinabgehende Tal, ebenfalls ein Hohlweg, bald nach Osten und Nordosten umbiegen und auf offenes Terrain führen würde. In den überraschendsten Zickzackbiegungen schlängelte es sich nach tiefer liegenden Gegenden hinunter.
Nur eine schwierige Passage erwarte uns noch, hieß es. Hier war das Tal wirklich so tief und eng, daß kaum ein Fußgänger sich hindurchzwängen konnte. Doch über die Halden auf der rechten Seite konnten wir die Kamele vorbeiführen.
Eine Strecke weiter machte jedoch der Zug Halt, und die Männer eilten an die Spitze. Der Korridor war hier so schmal, daß die Lasten auf beiden Seiten anstießen und die Kamele erst weiter konnten, nachdem die Wände mit Äxten bearbeitet worden waren. Unterdessen ging ich voraus und gelangte an eine Stelle, die noch schwieriger war. Der Hohlweg hatte sich wie eine schmale Rinne unter den Tonwänden der linken Talseite, die überhängende, gefährliche, zerrissene Gewölbe bildeten, eingeschnitten. Oberhalb[S. 7] des tiefen Grundes der Rinne gab es keinen Weg; wir mußten es dort unten versuchen. Doch gerade an dem schmalsten Punkte hatte kürzlich ein Bergrutsch stattgefunden. Gewaltige Blöcke und Tonstücke füllten die Passage aus und sperrten den Weg. Einige von ihnen konnten wir mit vereinten Kräften unter das Gewölbe rollen, und diejenigen, welche gar zu groß waren, wurden mit Spaten und Beilen zerstückelt. Die Seitenwände wurden erweitert, über die liegengebliebenen Bruchstücke bahnten die Pferde einen Weg, und die Kamele wurden vorsichtig und einzeln durch dieses Loch geführt, in welchem die Karawane im Falle eines neuen Bergrutsches lebendig begraben worden wäre. Am schwersten hatte es wie gewöhnlich das Brennholzkamel. Es blieb mitten im Loche stecken und machte eine so verzweifelte Anstrengung loszukommen, daß die Holzlast unter Lärm und Gepolter herunterfiel und ein paar Tonblöcke von den Wänden herabstürzten. Es sah unheimlich aus, als die ganze Gesellschaft in einer undurchdringlichen Staubwolke verschwand, und man konnte einen verhängnisvollen Bergrutsch befürchten.
Tokta Ahun machte ein klägliches Gesicht und gestand ein, daß er nicht bis an das Ende dieses heimtückischen Hohlweges geritten sei. Er war sehr niedergeschlagen, denn er pflegte darin sonst sehr gewissenhaft zu sein und völlig korrekte Auskunft zu geben.
Ich habe nie eine so eigentümliche Talform gesehen. Eigentlich sind es zwei Täler oder ein Tal mit zwei Stockwerken (Abb. 173). Das untere Stockwerk ist, von dem Boden des oberen gerechnet, 10 Meter tief und lotrecht eingesägt. Hierdurch entstehen auf den Seiten des unteren Tals Terrassen, die jedoch absolut unpassierbar sind. Auch das obere Tal wird nachher so eng, daß beide in ein tief in das Tonlager eingesägtes Tal verschmelzen, wo Dämmerung herrscht und man immerwährend in Gefahr schwebt, durch abstürzende Blöcke von ungeheuren Dimensionen erschlagen zu werden.
Wir schreiten mit unaufhörlichen Unterbrechungen vorwärts; bald müssen vorspringende Ecken weggehauen, bald hindernde Tonmassen aus dem Wege geräumt werden. Noch einige Schritte, und die Karawane macht Halt. Tokta Ahun meldet, daß das Tal gesperrt sei. Von den mehrere hundert Meter hohen Bergen auf beiden Seiten hatte ein Rutsch stattgefunden, der das Tal verstopfte. Doch temporäre Bächlein hatten sich unter dem herabgestürzten Material einen Durchgang gegraben, der einem Gletschertore glich; auf seiner Deckenwölbung würden wir wohl, falls sie nicht unter dem Gewichte der Kamele einstürzte, weiterziehen können.
Ich zog es jedoch vor, selbst zu rekognoszieren, bevor der Versuch gewagt wurde. Unweit dieser gefährlichen Brücke verschmälerte sich das Tal[S. 8] noch mehr und ging in eine zwei Fuß breite Spalte von 15 Meter Tiefe über. Schließlich wurde diese dunkel; heruntergefallene Blöcke bildeten ein Dach; der Abflußkanal des Wassers war hier unterirdisch und ähnelte einem steilen, gewundenen Grottengange, in welchem kaum eine Katze ihren Weg hätte finden können (Abb. 174, 175).
Jetzt war es klar: wir mußten umkehren. Die Karawane stand so zwischen den Tonwänden des Korridors eingeklemmt, daß das letzte Kamel rückwärtsgehen mußte, ehe Raum genug vorhanden war, daß es sich umdrehen konnte; ebenso wurde der Reihe nach mit den anderen verfahren. In der Dunkelheit ließen wir uns in einer kleinen Erweiterung nieder, wo man nicht vor gefährlichen Bergstürzen Angst zu haben brauchte. Die Tiere mußten fasten und dursten. Wie war diese seltsame Gegend finster, unheimlich und still! Dann und wann erklingt das schrille Läuten der Kamelglocken, wenn die Tiere den Kopf bewegen. Die Männer halten am Feuer Rat, und das Echo vervielfältigt ihre Stimmen; es klingt, als unterhalte man sich in einem Säulengange oder in einem Königssaale.
Es ist nicht angenehm, auf demselben Wege zurückzukehren, am allerwenigsten in einer Rinne, wo Tausende von Tonblöcken wie an einem Haare über unseren Köpfen hängen und die Kamele wie Käfer zu zerquetschen drohen. Hätte es in der Nacht einen größeren Bergsturz gegeben, so waren wir wie in einer Mausefalle gefangen gewesen.
Es kostete uns einen Tag, nach dem Punkte, wo das Tal sich geteilt hatte, zurückzukehren. Tokta Ahun und Mollah ritten inzwischen das Haupttal hinauf und kehrten abends mit der Nachricht zurück, daß sie nun wirklich einen Ausgang aus den verwickelten Labyrinthen des Akato-tag gefunden hätten.
Am 20. Dezember wurde ich geweckt, als es noch stockfinster war. Morgens wird jedoch weiter keine Beleuchtung spendiert als das freundliche, gemütliche Licht, welches das Feuer des Ofens, dessen Tür weit offen steht, ausströmt. Ein flackernder, roter Feuerschein verbreitet sich über das Innere der Jurte. Ich kleide mich schnell an und sehne mich bei der starken Kälte nach meinem heißen Tee.



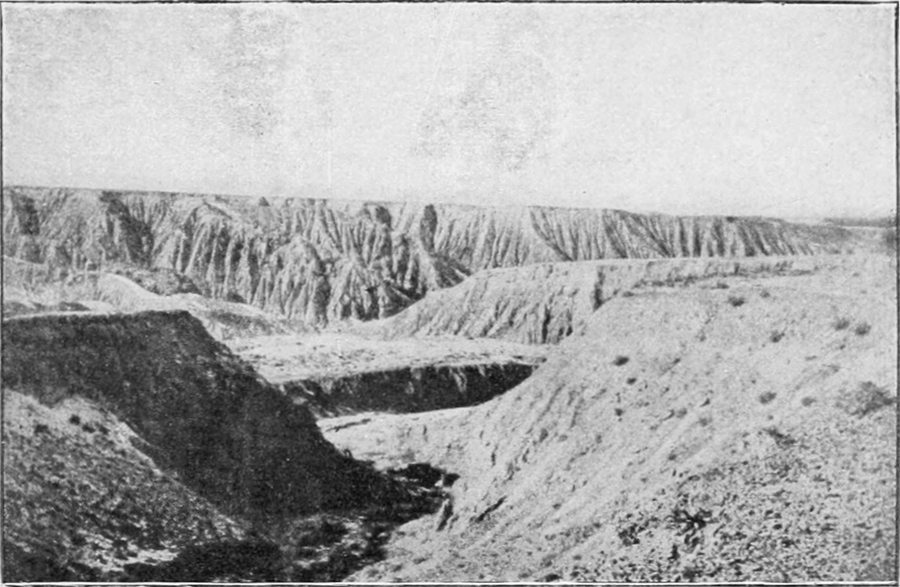


Schon in dunkler Nacht waren einige der Leute voraus nach dem Passe hinaufgeeilt, um dort einen Weg anzulegen. Jetzt folgten wir dem rechten Tale, das wirklich zu einem Passe führte. Auch dieser war auf der letzten Strecke greulich steil, und die Kamele konnten nur mit Hilfe der Leute hinaufkommen (Abb. 176). Die umfangreiche Aussicht zeigte sofort, daß wir uns auf dem Hauptkamme der Kette befanden (3698 Meter). Im Norden zieht sich der endlose Rücken des Astin-tag hin, im Süden der Tschimen-tag, im Südosten die Einöden von Zaidam, und ostwärts erblickt[S. 9] man etwas, von dem man nicht sagen kann, ob es ein Gebirge, Wolkengebilde, Nebel oder nur ein Wüstenreflex ist. Der Akato-tag ist anders als alle übrigen Bergsysteme in Tibet. Er ist ein unentwirrbares Durcheinander von Hügeln und Tonkuppeln, die aufs wildeste von unzähligen, tiefen und engen Schluchten durchsägt werden. Es ist eine leblose, düstere Gegend.
Als wir auf ebeneren Boden hinuntergelangt waren, fanden wir einen Pfad, der von menschlichen Wanderern herrühren mußte. Der Sicherheit halber hatte ich jedoch schon am Morgen einige Leute mit sechs Pferden nach Julgun-dung zurückgeschickt, um mehr Eis zu holen, da unser Eisvorrat zu sehr zusammengeschmolzen war.
Tokta Ahun hatte von einem Passe, dem Kara-dawan, auf dem Wege nach Anambar gesprochen. Als wir jetzt das breite, ebene Tal zwischen dem Akato- und dem Astin-tag in nordöstlicher Richtung durchquerten, galt es, den Weg nach diesem Passe ausfindig zu machen.
Bald fanden wir den schon gestern gesehenen Pfad wieder, aber jetzt sah er bedeutend breiter aus. Die durch Abnutzung verursachte Einsenkung des Bodens war deutlich zu sehen, besonders da, wo das Erdreich hart war, obwohl der Zahn der Zeit schon sehr an ihr genagt hatte. Auf Hügeln und Vorsprüngen an den Seiten waren Iles (Wegzeichen) in Gestalt kleiner Steinhaufen errichtet. Ohne Zweifel ist diese Straße von mongolischen Lhasapilgern in Zeiten von Unruhe und Unsicherheit in den sonst von ihnen durchreisten Gegenden benutzt worden.
In einer Rinne, in welcher wir zwischen den Hügeln hinzogen, verloren wir diesen Weg, und auch auf den Anhöhen waren keine Steinhaufen mehr zu sehen. Wir zogen jedoch in dem Tale weiter, und freundliche Mächte führten uns zu einer in dieser unendlich wüsten Gegend unerwarteten Entdeckung, zu einer von vortrefflicher Weide umgebenen kleinen Quelle (Abb. 177).
Die Quelle ist salzig, aber die Eisschollen unterhalb derselben sind süß. Sie erstrecken sich 150 Meter weit in das Tal hinein, wo mit ihnen auch die Vegetation aufhört.
Nachdem wir endlich auf ebenes Land geraten waren, gerieten wir dort in ein Terrain, das viel schlimmer war als die labyrinthähnlichen Gänge der Täler. Der Boden besteht aus salzhaltigem Tone, der Kammern, Rücken und Schwellen bildet, welche so hart wie Ziegel sind und unsern nach Nordosten laufenden Weg unter rechten Winkeln kreuzen. Man erhält den Eindruck, daß die Oberschicht des Erdreiches sich ausgedehnt haben muß und sich infolgedessen wie die Schale eines einschrumpfenden Apfels in Runzeln gelegt hat. Die Rücken sind hohl, und alle Risse gähnen[S. 10] schwarz. Ihre Höhe beträgt einen Meter, die Zwischenräume drei Meter. Wir ziehen zwischen ihnen durch, zwei Männern folgend, die mit Spaten vorausgehen.
Auch an diesem Abend erreichten wir eine Quelle mit Weide. Hier ging einsam ein wildes Kamel spazieren. Während wir im Kamischdickichte lagerten, birschte sich Schagdur an das Tier heran. Der Schuß widerhallte dumpf in der Dämmerung, und ich ritt nach dem Platze hin, von dem der an einem Vorderbeine verwundete Einsiedler vergeblich zu entfliehen suchte. Chodai Kullu machte ein Lasso und warf dem Kamel die Schlinge um den Hals, worauf es zu Boden gerissen und geschlachtet wurde. Jetzt hatten die Leute frisches Fleisch für mehrere Tage, und das prächtige Fett in den Höckern wurde auch mitgenommen. Nach Spuren und Dung zu urteilen, besuchen die wilden Kamele diese Quelle im Sommer in großen Herden.
Einen herrlicheren Weihnachtsabend konnte man sich in diesen kalten, öden Gegenden kaum wünschen. Die Luft war ruhig, der Himmel klar und blau. Nachdem Feuerung eingesammelt, ein paar Säcke mit Eis gefüllt und das Kamelfell zu Kopfkissen zerschnitten worden war, brachen wir auf und folgten den ganzen Tag dem alten Wege, dessen Steinhaufen wir bei der Quelle wiedergefunden hatten. Der Weg wurde bisweilen von bis zu zwanzig parallelen Pfaden bezeichnet, welche Zeugnis davon ablegten, daß Karawanen mit Kamelen und Pferden hier in ganzen Reihen gezogen sind. Vielleicht schrieb er sich aus einer Zeit her, als die weiter östlich wohnenden Mongolen ihre Herden in Temirlik weiden ließen. Erst in der Dämmerung gelangten wir an den Fuß des Astin-tag und schlugen unsere Zelte in der Mündung eines zwei Ketten trennenden Tales auf.
Als wir das Lager fertig hatten, wurde ein munter sprühendes Weihnachtsfeuer angezündet, das einzige, was an das große Fest in der Heimat erinnerte. Um mir die wehmütigen Gedanken, die an diesem Tage stets auf mich einstürmen, zu verjagen, rief ich Schagdur und weihte ihn in meinen Plan ein, den Versuch zu machen, nach Lhasa zu gelangen. Er war Feuer und Flamme dafür und glaubte, es würde uns gelingen, wenn wir uns vorschriftsmäßige Tracht und zuverlässige mongolische Reisekameraden zu verschaffen wüßten. Von nun an unterhielten wir uns oft abends über diese waghalsige Reise. Das Gespräch wurde russisch geführt, damit die Muselmänner nicht merkten, wovon die Rede war.
Während der letzten Tage des Jahrhunderts lenkten wir unsere Schritte in den Tälern zwischen den parallelen Ketten des Astin-tag beständig nach Nordosten. Die Kälte war scharf, und der Wind hielt noch immer an und brachte manchmal Schnee, der jedoch nur in den schattigen Schluchten liegen blieb. Die Berge glänzten mit ihrem weißen Schneegewande zwischen den[S. 11] Wolken hervor. Das Terrain war günstig; wir passierten eine Menge kleiner abflußloser Becken, deren Boden sich nach Regen in bald verdunstende Miniaturseen verwandelten. Zerstreut stehende Steppengrasbüschel, Teresken und Jappkak versahen uns mit Brennmaterial. Von Wild sahen wir in diesen Tagen nur Kamelspuren und einzelne Raben, die uns folgten. Tokta Ahun, der hier ein weniger guter Führer war als in den Kara-koschun-Sümpfen, fand den Kara-dawan nicht, ich kam aber ohne Hilfe durch das Gebirge.
Als ich am 27. Dezember in dem fürchterlich kalten Wintermorgen aus meiner Jurte schaute, fand ich den Boden mit einer ziemlich hohen Schneeschicht bedeckt, und das Schneetreiben dauerte den ganzen Tag an. Der Wind verfolgte uns ebenso eigensinnig wie im Sommer im inneren Tibet. Am 29. Dezember schliefen wir bei Sturm ein, erwachten am folgenden Morgen bei Sturm, ritten den ganzen Tag durch heulende Sturmböen und lagerten am Abend im Sturme. Es weht und zieht in der Jurte, die auf allen Seiten verankert werden muß, um nicht umzukippen, in welchem Falle der erhitzte Ofen die Filzdecken in Brand setzen und meine kostbaren Kartenblätter in alle Winde fliegen würden. Wir sehnten uns nach der Wüste, wo die Luft, wenigstens während der kalten Jahreszeit, nicht in beständigem Aufruhr ist, sondern wo gewissermaßen Waffenstillstand herrscht.
Einige der Quellen, an welchen wir lagerten, haben chinesische Namen: Lap-schi-tschen, Ku-schu-cha und Ja-ma-tschan. An den letztgenannten knüpft sich die Erinnerung an eine blutige Episode. Im Sommer 1896, um die Zeit, als ich mich das vorige Mal in Nordtibet befand, kamen die Reste der in der Gegend von Si-ning geschlagenen Armee der aufrührerischen Dunganen an diese Quelle. Die Chinesen schickten ihnen von Sa-tscheo ein Kriegsheer entgegen; es kam zum Kampfe, eine große Zahl Dunganen wurden erschlagen, andere wieder als Gefangene nach Sa-tscheo gebracht. Massen von menschlichen Skeletteilen lagen noch an der Quelle. Fünfhundert Dunganen mit Frauen und Kindern entkamen. Sie hatten eine Anzahl Kamele, Maulesel und Pferde bei sich, die sie aus Mangel an Lebensmitteln verzehrten. Während dieser Unruhen wurde von Abdall eine Gesandtschaft nach Sa-tscheo geschickt, bestehend aus einem Chinesen, einem Dunganen und zwei Muselmännern, nämlich Islam Ahun, einem Verwandten Tokta Ahuns, und Erke Dschan, dem älteren Bruder des Nias Baki Bek, eines unserer Freunde in Kum-tschappgan. Als diese vier Männer durch das Astin-tag-Gebiet zurückkehrten, trafen sie dort mit den Dunganen zusammen und wurden von ihnen an der Ja-ma-tschan-Quelle getötet. Die 500 Dunganen zogen nach Abdall, wo sie durch ein ihnen entgegentretendes[S. 12] Heer gezwungen wurden, die Waffen zu strecken. Dann wurden sie nach Kara-kum, einer neuangelegten Kolonie, gebracht, wo sie noch heute in Frieden leben und den Beweis liefern, daß die Chinesen gegen ihre rebellischen Untertanen nicht immer barbarisch sind.
An der Ja-ma-tschan-Quelle steht eine 1½ Meter hohe Steinpyramide, welche eine Tafel mit chinesischen Schriftzeichen trägt — ob damit die Erinnerung an den kläglichen Sieg über eine Handvoll ganz erschöpfter Dunganen bewahrt oder ausgedrückt werden soll, daß diese arme Gegend zum Reiche der Mitte gehört, ist mir unbekannt.
Vor etwa 30 Jahren hielten sich in diesen Gebirgsgegenden oft dunganische Jäger auf. Die einzigen Spuren, die sie hinterlassen haben, waren einige Fuchsfallen, von den Muselmännern „Kasgak“ genannt. Diese sehen genau aus wie Gräber oder längliche Steinhaufen und bilden einen Tunnel; am inneren Ende hängt ein großer Stein so lose, daß er herunterfällt und den Fuchs erschlägt, der in die Falle kriecht, um sich ein in einer Schlinge hängendes Fleischstück zu holen. Durch den Verkauf von Fuchsfellen hatten diese Jäger einen ziemlich guten Verdienst.
In der Nacht auf den 31. Dezember hielt der Sturm mit furchtbarer Wut an. Die Stangen fielen von der Kuppel der Jurte herunter, und diese mußte provisorisch mit Stricken festgebunden werden. Das Feuer muß ausgehen, und man taut erst auf, wenn man in seinem warmen Pelzneste liegt; dann aber kann es draußen toben, soviel es will. Es war morgens trotz des klaren Himmels dunkel, und man hörte nur das Heulen des um die Ecken pfeifenden Windes. Das Jahrhundert endete in diesen Gegenden mit einem richtigen Säkularsturme. Das Reiten ist unter solchen Umständen eine Tortur. Man kämpft vergebens mit der Kälte und kann kaum die Lebensgeister wachhalten. Man wird schläfrig und betäubt, die Glieder erstarren sozusagen in der Stellung, die man zu Pferde einnimmt, und es bedarf einer Kraftanstrengung, um aus dem Sattel zu kommen. Die Neujahrsnacht war sehr kalt und sternenklar, und der Mond stand wie eine elektrische Bogenlampe am Himmel. Ich las die Bibeltexte und die Psalmen, die am letzten Abende des Jahres in allen Kirchen Schwedens gesungen werden, und wartete in meiner Einsamkeit die Wende des Jahrhunderts ab. Es ist ein großer Anblick, wenn das Jahrhundert in die Nacht der Zeiten hinabsinkt! Hier läuteten keine Kirchenglocken; nur der Sturm, dem der Wechsel der Jahrhunderte nichts anhaben kann, sang mit brausenden Orgeltönen seinen wehmütigen Trauermarsch.
Am 1. Januar 1901 stürzten mit unverminderter Kraft unerschöpfliche Kaskaden von Luft durch die Täler. Von einer kleinen Paßschwelle erblickten wir das gewaltige Bergmassiv des Anambaruin-ula. Der[S. 13] Anambaruin-gol ist ein Fluß, der hier die Astin-tag-Kette durchbricht, um in die Sandwüste hinauszugehen und dort zu sterben. Die Gegend pflegt oft, besonders im Sommer, von Mongolen besucht zu werden, und als wir nachher in einiger Entfernung ein grasendes Pferd umherlaufen sahen, nahmen wir fest an, daß wir jetzt mit Mongolen zusammentreffen würden. Das Tier betrachtete uns mit scheuen Blicken, als wir unsere Zelte in der Talweitung am Flußufer aufschlugen. Doch wie gründlich wir auch am nächsten Tage partienweise die Gegend abstreiften, von Mongolen war keine Spur zu entdecken; sie waren augenscheinlich schon lange fortgezogen.
Für uns war es eine Enttäuschung, sie nicht zu finden und auf ihre Auskunft über die Gegend verzichten zu müssen. Da wir jedoch Zeit hatten, beschloß ich, die Mongolen um jeden Preis ausfindig zu machen. Dieser Abstecher war auf 310 Kilometer zu veranschlagen; wir gingen dabei um den Gebirgsstock des Anambaruin-ula herum.
Um für die ersten Mongolen, die wir treffen würden, eine angenehme Überraschung in Bereitschaft zu haben, wollten wir das entlaufene Pferd mitnehmen. Es erwies sich aber als ganz unmöglich, das Tier einzufangen; nicht einmal mit Lasso und Treibjagd ließ es sich überrumpeln. Schließlich stürmte es talaufwärts davon. Es war in der Einsamkeit verwildert und so scheu wie ein Kulan.
[S. 14]
Jetzt schritt unser Zug mehrere Tage lang gerade nach Osten. Den ersten Tag ging es ein großartiges, zwischen wilden, nackten Felswänden eingeschnittenes Tal hinauf, in welchem der Anambaruin-gol, mit blauschimmerndem, glattem Eise bedeckt, im Winterschlafe lag (Abb. 178, 179, 180). Einige Steinhütten zeigten, daß Mongolen das Tal dann und wann besuchten. Gerade unter dem Passe, der die östliche Grenze des Tales bildet, ließen wir uns in der Kälte nieder. Eine Herde von 12 Archaris kletterte geschickt und mit affenartiger Sicherheit auf einigen Felsvorsprüngen neben unserem Wege umher. Während sie die Karawane betrachteten, schlich sich Schagdur unter ihren sicheren Aussichtspunkt. Der Schuß rollte wie ein Echo zwischen den Bergwänden, und ein kolossaler Widder taumelte haltlos aus einer Höhe von 50 Meter herunter. Es wird von diesen wilden Schafen erzählt, daß sie, wenn sie auf ihren Felsenpfaden stolpern und ausgleiten, immer auf die Hörner fallen und dadurch die Wucht des Anpralls dämpfen. Schagdurs Opfer gehorchte diesem Gesetze sogar im Tode, denn er schlug mit den Hörnern polternd auf das Geröll auf. Unser Weg war lang gewesen, und im Lager war viel zu tun. Erst um Mitternacht kamen die Leute mit dem Archari, das sie auf ein Kamel geladen hatten, an. Es war mörderisch kalt in dem Winde, −28,5 Grad. Man glaubte, die Kälte in der klaren Nachtluft förmlich zittern zu sehen, und der Mond stand hoch und hell über den Schneefeldern der Gebirge.
Am folgenden Tag überschritten wir noch einen Paß und gelangten in die Gegenden des Gebirges, aus denen die Sommerflüsse südwärts nach dem Zaidambecken gehen. An einer Stelle sahen wir dessen Sandwüste zwischen isolierten, mächtigen Bergkomplexen.
So wanderten wir durch diese wilde Gebirgswelt nach Osten weiter. Wir hatten unter der Kälte und dem Winde zu leiden, es fehlte an Feuerungsmaterial, und ein paar Packleitern gingen darauf. Die Tiere[S. 15] hatten es auch nicht besser, denn die Weideplätze waren ebenso selten wie spärlich, und sogar die Quellen waren knapp. Den Kamelen macht es nichts aus, ein paar Tage zu dursten, die Pferde aber kauten Schnee, wenn sich ihnen weiter nichts bot. Im Norden erhebt sich das mächtige Massiv des Anambaruin-ula, im Süden ein kleinerer Bergrücken. Als es am 6. Januar Tag wurde, sahen wir offene Ebenen im Süden und Südosten und vor uns hatten wir jetzt das Hochlandbecken, das Särtäng heißt und von Särtängmongolen bewohnt wird, die mit den Bewohnern von Zaidam stammverwandt sind.
Fern im Osten sieht man den Bulungir-nor und die Wasserläufe, die sich in diesen kleinen See ergießen. Die vortrefflichen Weiden, die uns nach dem platten Lande zogen, waren jetzt freilich gelb, aber unsere Tiere würden sich nichtsdestoweniger dort sattfressen können, und wir wollten sie, obwohl es schon zu dämmern anfing, gern noch zum Abend erreichen. Einige schwarze Punkte hier und dort hielten wir für Zelte und Herden, aber die Entfernung war zu groß, um etwas deutlich erkennen zu können, und nach einer Weile hüllte sich das Land in Dunkelheit. Schagdur und Mollah sprengten voraus; eine Stunde später erhellte ein Feuer die Nacht; sie hatten augenscheinlich den Rand der Steppe erreicht und dort trockenes Gras und Gestrüpp in Brand gesteckt. Die langsam gehende Karawane brauchte noch zwei Stunden, um dorthin zu gelangen; als wir aber einmal da waren, durften die Tiere ungeknebelt die ganze Nacht grasen. In solchen Gegenden laufen sie nicht fort.
Als ich am folgenden Morgen geweckt wurde, hatten die Leute schon weiter im Süden einige Zeltlager entdeckt, nach denen wir unsere Schritte hinlenkten. Zuerst gelangten wir an drei Jurten, um welche herum große Herden von Rindern, Pferden und Schafen weideten. Eine alte Frau kam herausgelaufen und empfing uns ohne eine Spur von Furcht; sie fuhr, während sie schwatzte, ganz ruhig mit ihrer Handarbeit — Schnurdrehen — fort. Doch bat sie uns, ja nicht hier zu bleiben, denn hier seien nur Frauen und Kinder zu Hause; wir zogen deshalb weiter, bis wir drei andere Jurten erreichten, wo zwei Männer versicherten, daß wir willkommen seien und unsere Zelte bei ihnen aufschlagen könnten.
Wir hatten es gut bei diesen freundlichen, gastfreien Mongolen von Sando, die uns verkauften, was wir an Proviant brauchten, aber keine Karawanentiere abgeben konnten. Die Gegend war übrigens sehr spärlich bevölkert; nur einige wenige Jurten waren auf der Ebene zu sehen. Eine große Karawane war kürzlich nach dem Tempel von Kum-bum und eine zweite nach Sa-tscheo aufgebrochen. Die Mongolen, die noch hier waren, besuchten uns alle. Ich frischte bald das Mongolische, das ich auf meiner[S. 16] früheren Reise gelernt hatte, wieder auf, und überdies war Schagdur ein vorzüglicher Dolmetscher; es war ja seine Muttersprache, die er hier zu seiner Freude wiederfand.
Nach einigen angenehmen Rasttagen, während welcher die Kälte auf −32,5 Grad hinunterging, traten wir den Rückweg nach dem Anambaruin-gol an, diesmal aber auf der Nordseite des Gebirgsstockes gleichen Namens. In vier Tagen zogen wir nach Norden über diese Kette, welche die Fortsetzung des Astin-tag bildet. Wir lagerten zuerst am Bulungir-nor, wo die Wölfe rings um unser Lager heulten, nachher in bergigen Gegenden. Der Hauptpaß Scho-ovo (der kleine Obo) ist eine scharf ausgeprägte Schwelle, und besonders der Nordabhang ist ungeheuer steil. Die Kamele mußten, um nicht kopfüber in den Abgrund zu stürzen, einzeln geführt werden. Ein mächtiger Fluß rauscht im Sommer durch das nördliche Quertal und hat nur zu deutliche Spuren seiner aushöhlenden, einsägenden Tätigkeit hinterlassen. Rebhühner kamen in Menge vor, und ich lebte während der ganzen Reise durch den Anambar-ula von nichts anderem, obgleich wir Schaffleisch vollauf hatten.
Von dem kleinen, am Nordfuße des Gebirges liegenden Aule Scho-ovo an ging unser Weg nach Westen. Wir waren hier von der Stadt Sa-tscheo oder Tung-chuan (von den Muselmännern Dung-chan genannt) nur noch eine Tagereise entfernt. Vielleicht war es ein Glück, daß wir diesen Ort während der Unruhen in China, von denen wir allerdings nichts gehört hatten, nicht besuchten. Unser Führer war ein netter alter Mongole (Abb. 181, 183), der die Gegend ganz genau kannte, uns fünf Kamele bis nach dem Anambaruin-gol vermietete und uns einen reichlichen Vorrat von Gerste, soviel wir transportieren konnten, verkaufte. Der Boden war jetzt überall mit Schnee bedeckt, aber nicht so hoch, daß unsere Tiere sich nicht an den Lagerplätzen an Gras hätten sattfressen können. Er war auch von unzähligen Schluchten durchsägt, die bis zu 10 Meter tief waren und steile, schwer zu erklimmende Wände hatten. Der nächste Lagerplatz hieß Dawato; dort tobte ein verwünschter Wind, der vom Gebirge herabstürzte. Es scheint eine Art lokaler Föhn zu sein, denn er hörte sofort auf, als wir am nächsten Tag einen kleinen Paß überschritten hatten, und er erhöhte die Minimaltemperatur auf −16 Grad.

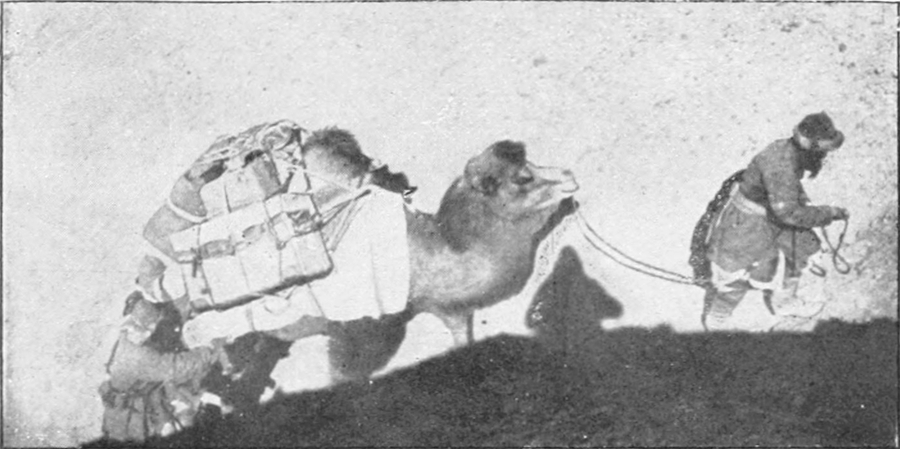
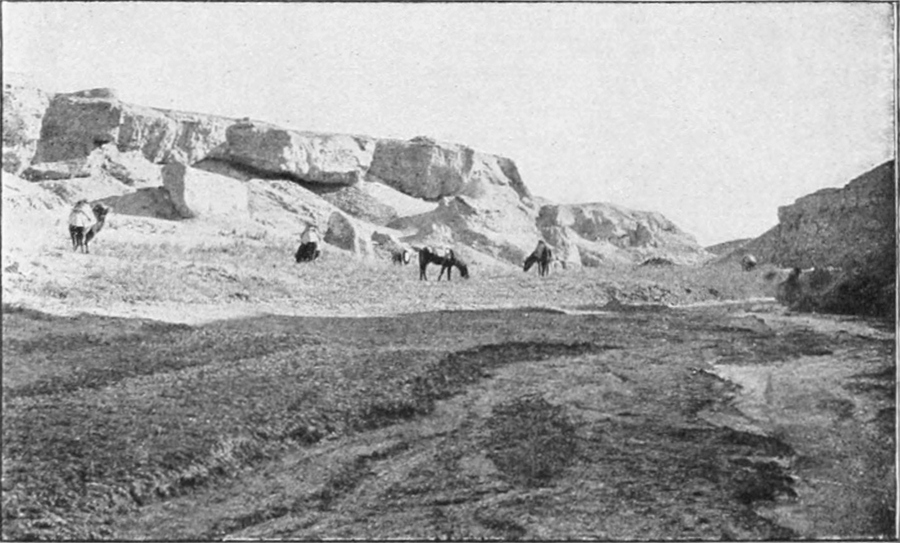
Am 18. Januar gelangten wir an das Tal von Dschong-duntsa, eine sehr breite, 50 Meter tief in mächtige Geröllbette eingeschnittene Furche (Abb. 182). Von dem Stocke des Anambaruin-ula gehen unzählige derartige Täler nach Norden, vereinigen sich nach und nach zu Hauptbetten und laufen in die Wüste hinaus, wo sie jedoch bald aufhören. Nur dadurch, daß wir eine kleine Schlucht, die in das obengenannte Haupttal[S. 17] ausmündet, hinuntergingen, konnten wir seinen Boden überhaupt erreichen (Abb. 184, 185, 186). Sie schlängelt sich wie ein Korridor, in dem das Echo hellklingt, zwischen lotrechten Geröllwänden hin. Sie hat ziemlich steiles Gefälle und wird immer enger und dunkler. Doch nach einer letzten Biegung wird es wieder hell, und das sonnenbeleuchtete Tal mit seiner Vegetation und seinem eisbedeckten Flusse strahlt uns wie durch eine geöffnete Pforte entgegen. Auf dem linken Ufer des Flusses lagerten wir in einer großartigen, phantastischen Natur.
Die Talmündungen, die vom Gebirgsstocke des Anambaruin-ula ausgehen, sind wahrhaft großartige, entzückende Gegenden. In einer von ihnen, die Lu-tschuentsa heißt, lagen in einem Walde von kleinen Weiden mächtige Eistafeln, an den Bachufern wuchs prachtvolles Gras, und Steinhütten und Gerstenfelder verkündeten, daß sich hier vor noch gar nicht langer Zeit Mongolen aufgehalten haben (Abb. 187, 188). Der Weg selbst ist um so schlechter, mit Riesenschluchten bis ins Unendliche und mit zahllosen kleinen Furchen dazwischen. Sie sind oft tief zwischen lotrechten Wänden eingeschnitten; das Ganze ist ein Meer von Geröll, malerisch, aber beschwerlich. Die Karawane verschwindet manchmal in diesen Rinnen und taucht an einer weniger steilen Stelle wieder auf.
Bei dem Lager am Gaschun-gol schoß Schagdur ein wildes Kamel. Diese Tiere kommen in der Gegend ziemlich häufig vor, bald nördlich von unserem Wege auf den untersten Abhängen des Gebirges und am Rande der Wüste, bald auch, merkwürdigerweise, in den südlichen Tälern, wo es meiner Meinung nach nicht schwer sein müßte, ganze Herden in Sackgassen, aus denen es keinen Ausweg gibt, hineinzutreiben. Wir sahen sie oft in Herden von 15–20 Tieren.
Am 24. Januar wurde die letzte Strecke bis Chan-ambal zurückgelegt, wo wir auf derselben Stelle wie vor drei Wochen lagerten. Nahe dabei trafen wir die einzige Karawane, die wir auf dieser ganzen viermonatigen Reise sahen, zwei Chinesen, die auf zehn Kamelen gedörrte und gefrorene Fische nach Sa-tscheo brachten. Sie kamen, wie sie sagten, aus Lovo-nur, d. h. Lop-nor. Ich wollte ein oder zwei Pakete ihrer Fische erstehen, aber sie weigerten sich hartnäckig, uns etwas zu verkaufen. Meine Leute schlugen vor, wir sollten uns ganz einfach nehmen, was wir brauchten, aber ich bin nicht für Gewalt und zog es vor, die Chinesen unbehelligt weiterziehen zu lassen.
Mit der Rückkehr an diesen Lagerplatz, der von Abdall gerechnet Nr. 131 war, hatten wir den Anambaruin-ula umgangen, aber den eigentlichen Zweck des ganzen Umweges, uns Kamele zu verschaffen, nicht erreicht. Wir hatten nicht einmal ein Pferd kaufen können, und unsere[S. 18] Karawane war durch den Umweg ermüdet worden. Die Kamele befanden sich noch in guter Verfassung, aber mehrere Pferde zeigten schon Symptome der Erschöpfung. Der Gewinn der Reise war, daß wir ein geographisch sehr merkwürdiges Land kennengelernt hatten.
Große Strecken unbekannten Landes lagen noch vor uns, und in der Zusammensetzung der Karawane mußte eine Änderung vorgenommen werden. Sechs Pferde, die nicht aussahen, als hätten sie noch Kräfte genug für zweimonatige Strapazen, wurden ausgeschieden, und alles, was sich entbehren ließ oder jetzt nicht notwendig war, von unserem Gepäck abgesondert, besonders alle Gesteinproben und Skelette. Mit dieser kleinen Karawane sollten Tokta Ahun und Ahmet nach Abdall zurückkehren. Ersterer hatte außerdem folgende wichtige Aufträge auszuführen. Mit den müden Pferden sollte er sich von Abdall nach Tscharchlik begeben und dort von Tscherdon und Islam Bai allerlei später für uns notwendige Proviantartikel erhalten, worüber ich ihm schriftlichen Befehl an die beiden mitgab. Sodann hatte er wieder nach Abdall zurückzukehren, um uns von dort aus entgegenzukommen, und den Postdschigiten, der der Verabredung gemäß während meiner Abwesenheit vom Generalkonsul in Kaschgar in Tscharchlik angelangt sein mußte, ebenfalls mitzunehmen. Der Dschigit sollte hierbei noch immer dafür verantwortlich sein, daß mir die Posttasche in unverletztem Zustande übergeben würde. Von Kum-tschappgan sollte Tokta Ahun drei volle Tagereisen am Nordufer des Kara-koschun entlangreiten, drei frische Pferde mitnehmen und in einer geeigneten Gegend ein Standlager errichten. Zwei Kähne und einige gut mit der Gegend bekannte einheimische Fischer hatte er ebenfalls mitzubringen.
Nachdem diese Hilfsexpedition einen guten, angenehmen Rastplatz ausgesucht, sollte sie dort eine Hütte bauen, ihre Netze auslegen und Enten fangen, damit wir, die aus der Wüste kommen würden, nach den Anstrengungen Obdach und Verpflegung vorfänden. Auf einem nach Norden weithin sichtbaren Hügel sollten sie zweimal täglich, um 12 Uhr mittags und nach Einbruch der Dunkelheit, ein Feuer anzünden, dessen Rauchwolken und Schein uns als Leuchtturm dienen könnten. An dem verabredeten Vereinigungspunkte drei Tagereisen nordöstlich von Kum-tschappgan mußten sie sich in spätestens 45 Tagen, vom 27. Januar an gerechnet, einfinden und sofort mit dem Signalisieren beginnen, sowie geduldig auf unsere Ankunft warten, falls wir aufgehalten werden sollten. Tokta Ahun war betrübt, daß er sich von uns trennen sollte, aber ich tröstete ihn damit, daß es sein Vorteil sein würde, wenn er seinen Auftrag gut ausführe.
So dezimiert, zogen wir am 27. Januar weiter, um die Wüste Gobi gerade nach Norden zu durchwandern. Wir marschierten also durch das[S. 19] Tal hinunter, das der Anambaruin-gol durch die Bergkette des Astin-tag geschnitten hat. An einer Flußbiegung standen drei von Äckern umgebene mongolische Steinhütten. Das Tal erweitert sich, die Berge auf seinen Seiten bilden isolierte Partien, Hügel und wellenförmiges Land, das schließlich in die Wüste übergeht. Auch der Fluß wird schwächer, seine Uferterrassen werden immer niedriger, seine Eisschollen immer dünner, und nur ein unbedeutendes Rinnsal rieselt noch unter ihnen. Der Schnee wird immer seltener, und es war deutlich zu beobachten, daß er bald ganz aufhören würde.
An dem Punkte, wo die letzten Eisschollen im Tale lagen, machten wir eine bedeutungsvolle Rast. Wo und wann würden wir das nächste Mal Wasser finden? Darüber schwebten wir in gänzlicher Ungewißheit. Der Sicherheit halber befahl ich, für 10 Tage Eis mitzunehmen. Die Eisdecke des Bettes wurde aufgebrochen und fünf Säcke mit dicken Scheiben gefüllt. Ein Sack reichte, unserer Ansicht nach, volle zwei Tage für Leute und Tiere.
Die schon vorher ansehnlichen Lasten der Kamele wurden hierdurch noch vergrößert, aber das Terrain war gut, und es ging eben und langsam bergab. Es ist herrlich, das Gebirge hinter sich lassen zu können und erst in einer freundlicheren Jahreszeit dorthin zurückzukehren.
Nur ich, Schagdur und Faisullah durften an diesem Tage reiten, doch sobald die Zugordnung in Gang gekommen war, sollten wir die vier Pferde abwechselnd benutzen.
Je weiter wir uns von der Bergkette entfernen, desto mehr schmelzen die Einzelheiten ihres Aufbaues zusammen; aber je weiter wir gelangen, desto deutlicher zeichnen sich dafür ihre beiden Rücken ab. Der hintere, den die Mongolen Tsagan-ula (das weiße Gebirge) nennen, erhebt sich hoch und dominierend mit seinem schön gezeichneten, schneebedeckten Kamme; der vordere, nördliche, den der Fluß durchbricht, steht schwarz da und hat gemäßigtere, sanftere Linien.
Das Terrain und die Landschaft verändern sich vollständig; das Geröll, das uns seit einem Monat zu schaffen machte, wird spärlicher und hört ganz auf, der Boden wird weicher, und wir können zwischen den Schneeflecken reiten, so daß die Pferde von den unangenehmen Schneesohlen, die sich unter den Hufen bilden, verschont bleiben. Hier und dort ist die aus Teresken und Tamarisken bestehende Steppenvegetation recht üppig. Im Norden versperren niedrige, rötliche Berge die Aussicht über das Wüstenmeer. Neben einem kleinen Hügel fanden wir einen vortrefflichen Platz für das Lager. Dürre Büschel versahen uns mit Kamelfutter und Feuerung, und in einer Spalte lag noch eine letzte Schneewehe, so[S. 20] daß wir den Eisvorrat nicht anzubrechen brauchten. Zwei wilde Kamele wurden von den Hunden in die Flucht gejagt, liefen aber so schnell längs des Fußes der Hügel hin, daß die Hunde, wie sehr sie sich auch anstrengten, so weit hinter ihnen zurückblieben, daß an ein Einholen gar nicht zu denken war.
Der nächste Tag brachte uns pfeifenden westlichen Sturm, der mit aufgewirbeltem Staub und schweren, grauen Wolken gesättigt war. Für die Pferde wurden einige Eimer Schnee über dem Feuer geschmolzen, die Kamele aber und die Hunde konnten sich selbst von den Schneewehen versehen. Wir näherten uns dem Fuße des Wüstengebirges. Die Steppenvegetation ist oft außerordentlich üppig. Sie besteht aus jenen holzigen, oft ziemlich hohen, Nadeln tragenden Sträuchern und Büschen, welche die Muselmänner „Tschakkande“ und „Köuruk“ nennen und die mit der gewöhnlichen Tamariske verwandt sind. Manchmal sind sie vertrocknet, und dann liegen ganze Wagenladungen vortrefflichen Brennmaterials bereit, so daß man oft in Versuchung gerät, nur um ihretwillen zu lagern.
Wir überschreiten ein sehr breites, aber wenig tief eingeschnittenes Bett, dem alle Gewässer der Gegend zuströmen. Das Bett geht nach Westnordwest, in der Richtung des Lop-nor-Beckens. Obwohl das Gefälle auf der anderen Seite außerordentlich stark wurde, war es für uns doch leicht, über den niedrigen Paß der Wüstenkette hinüberzukommen, auf dessen anderer Seite die Zelte zwischen weichen, trockenen und angenehmen Sanddünen aufgeschlagen wurden. Unterhalb des Passes begann jetzt auch „Suk-suk“ (Saksaul, Anabasis ammodendron) aufzutreten.
Während des Marsches am 29. Januar verloren wir uns wieder in einem Gewirr von nicht sehr hohen Bergen. Von neuem stießen wir auf einen deutlichen Weg aus früheren Zeiten. Am Boden war keine Spur mehr davon zu sehen; er war schon lange von der Zeit vertilgt worden, aber auf allen Hügeln und Vorsprüngen standen kleine Steinmale oder Wegzeichen, deren wir wohl 20 zählten. Gewöhnlich bestehen sie aus einer großen und einer kleinen Steinplatte, die sich aneinanderlehnen, oder auch aus einem würfelförmigen Steine, der zwei aufeinandergelegte runde Steine trägt. Daß es sich hier nicht um einen zufälligen Jägerpfad handelt, beweisen die Steinmale. Jäger finden sich überall zurecht und bleiben nicht ausschließlich auf bekannten Wegen, Steinmale aber sind nur für Reisende nötig, die sonst nicht wissen, wo der Weg geht. Wahrscheinlich war es die Fortsetzung des Weges, den wir schon im Astin-tag gesehen hatten, und ohne Zweifel ist er von Pilgern benutzt worden. Er wird wohl ziemlich alt sein; die Steinmale kann nur die Verwitterung vernichten, denn keine Stürme können sie hier mit Sand verschütten oder umwerfen.
[S. 21]
Nachdem wir noch einen kleinen Paß überschritten hatten, lag das gelbe Meer der Wüste vor uns. Seine Dünenwellen sahen unheimlich und bizarr aus. In der letzten Talmündung wurde Rast gemacht. Man hat hier das Gefühl, sich an der Küste des Wüstenmeers zu befinden. Auf einer Anhöhe thronte ein letztes Steinmal. Saksaule wuchsen hier üppig und erreichten eine Höhe von 3 Meter.
Die letzten Ausläufer auf beiden Seiten dieser Talmündung sind zur Hälfte versandet. Die Dünen klettern hoch an ihnen hinauf. Sie versinken in die unbekannte Tiefe des Wüstenmeers. An Niederschlägen fehlt es in diesen Wüstenbergen nicht. Von Zeit zu Zeit fällt hier Regen, dessen Wasser sich zu einem Bach vereinigt, der, wenn auch von kurzer Dauer, doch eine bedeutende Wassermenge führen zu können scheint. Und daß er eine achtunggebietende Kraft besitzt, sehen wir an seiner sich zwischen kolossalen Sanddünen hinschlängelnden Rinne. Bald läuft diese nach Osten, biegt aber, wenn sie auf einen Sandberg stößt, nordwärts ab, bald nach Westen, um, von einer anderen Düne abgedrängt, wieder nach Norden zu gehen. Ohne einen solchen natürlichen Korridor wäre es ziemlich schwer gewesen, sich einen Weg durch diesen gewaltigen Flugsandgürtel zu bahnen, und man erstaunt, daß die Erosion stark genug ist, den Sand zu bekämpfen.
Den ganzen Tag ging ich zu Fuß voraus, um nicht in dem ewigen, eisigen Winde zu erfrieren. Dann und wann guckt eine zur Hälfte begrabene Saksaulpflanze aus dem Sande. Die gestern noch außerordentlich zahlreichen Spuren von wilden Kamelen und Antilopen haben ganz aufgehört; die scheuen Tiere wollen das Terrain überschauen und hüten sich vor einer so schmalen, gefährlichen Passage. Noch mehrere Kilometer vom Fuße des Gebirges entfernt liegen Granitstücke von Kubikmetergröße auf dem Sande. Weshalb liegen sie da? Weshalb begräbt sie der Triebsand nicht? Dies muß seinen Grund in den Bahnen haben, die der Wind beschreibt und die keine Ablagerung in der Nähe eines solchen Hindernisses zulassen.
Allmählich wird das Bett weniger ausgeprägt, sein Boden ist oft versandet, und die Dünen auf den Seiten erreichen nicht mehr die himmelstürmende Höhe wie am Fuße des Gebirges. Die kleine Wüstenkette, die wir in zwei Pässen überschritten haben, gleicht einem Wellenbrecher, der die Ausbreitung des Flugsandes nach Süden unmöglich macht. Sie schützt den nördlich vom Astin-tag liegenden Steppengürtel.
Schließlich hörte das Bett zwischen den Dünen auf, bildete vorher aber noch eine Erweiterung, die einem kleinen See glich, obwohl keine Spuren von Wasser entdeckt werden konnten. Im Norden dieser Bodensenkung erhob sich ein hoher Dünenwall, und von seinem Kamme erblickten[S. 22] wir das eigentliche Wüstenmeer in seiner ganzen, großartigen Öde; es sah ebenso aus wie in so vielen anderen Gegenden, in denen ich die Wüste Gobi durchwandert hatte. Nicht die kleinste Pflanze überschritt die Grenze; im Norden, Osten und Westen sah man nichts als Sand, Sand und wieder Sand (Abb. 189, 192).
Wie gewöhnlich in den Sandwüsten ging ich zu Fuß voraus, und nur langsam konnte die Karawane meinen schnellen Schritten folgen. Ich glaubte an mein altes Wüstenglück und war überzeugt, daß ich auch jetzt die Meinen durch die Gefahren der Dünenberge lotsen würde. Ich hatte das Fernglas bei mir, suchte die ebensten Flächen aus und freute mich über die Einsamkeit und die große Stille.
Das heutige Lager wurde mitten in der Sandwüste aufgeschlagen, wo ringsherum nichts als Sand zu sehen war.
Während des folgenden Tagemarsches wurden die Dünen immer niedriger und gingen schließlich in den darunterliegenden Lehmboden über, der in mehrere ungleiche Etagen von nach Norden abfallenden Terrassen ausgearbeitet ist. Am 1. Februar wurde diese Landschaftsform noch ausgeprägter (Abb. 190). Die Terrassen zeigen wie Finger nach Nordnordost und sind oft 50 Meter hoch. Gegen Abend erreichten wir zu unserer freudigen Überraschung wieder einen Steppengürtel, wo Kamisch und Tamarisken üppig wucherten und Spuren von Wölfen, Antilopen und Kamelen einander kreuzten. Ein Brunnen gab in einer Tiefe von 1,14 Meter salzhaltiges aber trinkbares Wasser (Abb. 191). Es quoll jedoch so langsam aus dem auf blauem Ton ruhenden Sandlager, daß es nur den Appetit der Kamele nach „mehr“ reizte.
Noch einen Tag erfreuten wir uns des Steppengürtels und folgten den Pfaden der wilden Kamele nach Norden. Sogar eine Gruppe knorriger Pappeln wurde passiert. Doch nur in einer von ihnen war noch ein Fünkchen Leben; die übrigen waren lauter geschlagene Helden.
Bei dem Lager, das hier aufgeschlagen wurde, es war Nr. 138, hatten wir alles, dessen wir bedurften, und wir verbrachten hier zwei sehr notwendige Ruhetage. Während ich eine Sonnenobservation machte, buken die Männer Brot und hielten große Wäsche. Ein sehr ergiebiger Brunnen spendete den Kamelen für lange Zeit Wasser. Sie tranken je sieben Eimer. Das Wasser war fast ganz süß, und dadurch, daß wir es in dem offenen Becken gefrieren ließen, konnten wir unseren Eisvorrat vergrößern.
Hinter diesem Punkte folgte wieder sterile Wüste, aus deren lockerem Lehmboden vom Winde sehr eigentümliche, bis zu 8 Meter hohe Kegel und Würfel geformt worden sind, die oft täuschende Ähnlichkeit mit Ruinen von Häusern und Mauern haben. Am Abend wurde ein wichtiger Punkt[S. 23] erreicht, und jetzt kam Mollahs Wegkenntnis zum erstenmal zur Geltung. Er war mehrmals mit Karawanen von Abdall nach Sa-tscheo und zurück geritten, hatte dabei stets den Astin-joll (den unteren Weg) durch die Wüste benutzt und kannte dort alle Brunnen und ihre Namen. An einem der letzteren, Atschik-kuduk (der salzige Brunnen), schlugen wir jetzt unsere Zelte auf. Er verdiente seinen Namen, denn das Wasser war selbst für die Kamele absolut untrinkbar. Spuren in dem feuchten, salzhaltigen Boden verrieten, daß vor gar nicht langer Zeit eine Karawane von Abdall nach Sa-tscheo hier vorbeigezogen war und ohne Zweifel Fische, welche die Chinesen sehr lieben, transportiert hatte.
Dieser Wüstenweg ist schon von Kosloff, Bonin und möglicherweise auch von Marco Polo bereist worden. Es war meine Absicht, ihn nur zu kreuzen und direkt nach Norden weiterzuziehen, aber die Klugheit gebot uns doch, uns nicht in unbekannte Wüstengegenden hineinzuwagen, ohne mit einem genügenden Eisvorrat versehen zu sein. Der nächste Brunnen im Westen war der Tograk-kuduk (Pappelbrunnen); dort sollte das Wasser nach Mollahs Versicherung gut sein. Wir begaben uns also dorthin und ruhten einen Tag, an dem ein bedeutender Eisvorrat von dem Brunnen geholt wurde (Abb. 193). Es war keine Kunst, die Säcke zu füllen, da die Kälte noch −27,5 Grad betrug. Bei Tage war es allerdings nur ein paar Grad kalt.
Als wir uns am 8. Februar nordwärts auf eine lange, ziemlich waghalsige Reise ohne Rasttage begaben, hatten wir also für Menschen und Tiere auf mindestens zehn Tage Wasser.
Durch dichtes Schilf, das von der Kälte gelb und dürr geworden ist und knisternd bricht, wenn wir hindurchschreiten, geht es einem unbekannten Lande entgegen, aus dem nie zuvor eine Kunde zur Kenntnis der Europäer und ebensowenig der Asiaten gelangt ist. Ich ging, wie gewöhnlich, weit voraus. Unzählige Spuren von wilden Kamelen und Antilopen zeigen sich in allen Richtungen, Kulane aber gibt es in dieser Gegend nicht; die Luft ist wohl zu dicht für ihren geräumigen Brustkorb. Auf einmal hört der Vegetationsgürtel auf und endet mit einem Labyrinth von Lehmkegeln, die tote Tamarisken tragen. In einer Bodensenkung, wo das Erdreich feucht aussah, hielt ich es für der Mühe wert, noch einen Brunnen zu graben. Im Norden erhob sich eine wohl 70 Meter hohe Terrasse. In eine ihrer Talmündungen wollten wir hineinziehen.
Die Karawanenglocken kommen immer näher. Die Weide war an dieser Stelle gut, und die Kamele sollten noch einmal eine stärkende Mahlzeit haben. Der Brunnen gab leidliches Wasser, und aus der Winterkälte machten wir uns wenig; sie wurde durch prächtige Feuer gemildert.
[S. 24]
Ein passendes Tal lockte uns in seine Mündung hinein, und einen ganzen Tag ritten wir durch seine Rinne nach Norden. Der Boden hebt sich außerordentlich langsam, für das Auge geradezu unmerklich. Nach vorhandenen Karten von Innerasien müßte hier eine gewaltige Bergkette liegen, aber die Anhöhen, die wir jetzt auf allen Seiten sahen, waren so unbedeutend, daß sie kaum den Namen Berge verdienten. In einer kleinen Schlucht fand ich Stücke eines uralten Eisentopfes von sphärischer Form und einen Dreifuß, der unten einen Ring hatte. Offenbar waren hier in früheren Zeiten Chinesen oder Mongolen vorbeigekommen. Waren wir hier vielleicht wieder auf die Fortsetzung des Weges, den wir im Astin-tag gesehen hatten, gestoßen, oder war dies ein alter Weg nach Chami?
Daß wir uns in einer Gegend befanden, wo einstmals menschliche Verbindungsstraßen gelegen haben mußten, wurde uns während der folgenden Tagereise völlig klar. In dem breiten, offenen Tale, dem wir nach Norden folgten, zeigten sich nämlich oft Steinmale und Steinhaufen. Da, wo das Tal in flaches, wellenförmiges Terrain auslief, teilte sich der alte Weg. Eine Reihe von Steinmalen erstreckte sich nach Westsüdwesten, eine zweite nach Nordwesten. Der erste dieser beiden Wege hat wahrscheinlich nach den Ruinen geführt, die wir früher am Nordufer des Lop-nor gefunden hatten. Der zweite, den wir einschlugen und der nach Turfan zu gehen schien, führte uns auf einen niedrigen, rötlichschimmernden Kamm von ganz verwittertem Granit. Fern im Norden wurde die Aussicht durch eine etwas höhere Kette versperrt. Die Landschaft ist seltsam, öde, verlassen und stumm. Wie die Menschenspuren uralt sind, ihre Bedeutung verloren haben und nur noch in den Steinmalen als Erinnerungen aus vergangenen Zeiten dastehen, so sind auch die Bergketten hier auf dem Wege, vom Erdboden vertilgt worden. Wenn man an Tibet gewöhnt ist, kann man sich beinahe nicht entschließen, diese kleinen Landrücken Berge zu nennen. Sie sind zerfallende Ruinen von einstmals hohen Bergketten, welche jetzt durch die Einwirkung der in der Atmosphäre wirkenden Kräfte Stück für Stück zerstört werden. Doch denselben von Osten nach Westen gerichteten Parallelismus wie in Tibet finden wir auch hier wieder.
In einer geschützten Spalte auf der Nordseite des Kammes fanden wir eine liegengebliebene Schneewehe, die den Kamelen sehr zupasse kam. Vielleicht hat dieser Schnee sie vor dem Verdursten gerettet, denn zum Wasser hatten wir noch sehr weit.
[S. 25]
Die ersten Anzeichen des Frühlings machten sich jetzt bemerklich, und die Winde waren nicht mehr ganz so schneidend kalt wie bisher. Die Minimaltemperatur stieg freilich selten über −20 Grad; aber unser langer Winter näherte sich doch seinem Ende. Im Juli des vorigen Jahres hatte er begonnen und ununterbrochen fortgedauert.
Am 11. Februar überschritten wir eine Bergkette von unbedeutender relativer Höhe. Wilde Kamele haben hier außerordentlich zahlreiche Spuren hinterlassen. Sie schienen oft nach der obenerwähnten Schneewehe, der keine weiteren folgten, zu gehen. Wahrscheinlich hat die Erfahrung die Tiere gelehrt, daß die geringe Schneemenge, die hier gelegentlich fällt, an jener Stelle die größte Aussicht hat, liegenzubleiben.
Am 12. gingen wir in einer fabelhaft öden Gegend, die nur selten durch eine Kamelspur belebt wurde, nach Nordnordosten. In der Ferne sieht man auf allen Seiten einzelne, niedrige Hügel, aber ziemlich lange Zeit ist es unmöglich festzustellen, in welcher Richtung der Boden fällt. Es gibt hier allerdings flache, gewundene Bachbetten, aber sie sind trocken wie Zunder, und oft hat es den Anschein, als müßten Jahrzehnte vergangen sein, seit sie zuletzt Wasser geführt haben. Der Blick reicht unendlich weit nach allen Seiten hin. Da keine Veränderung eintrat und keine Hoffnung vorhanden schien, daß wir hier Quellen oder Schnee finden könnten, schwenkten wir nach Nordwesten und Westen ab.
Die beiden folgenden Tagemärsche gingen nach Südwesten. Ich hielt mit dem Kurse immerfort auf Altimisch-bulak zu, da wir ja einen Bogen nach Nordosten gemacht hatten. Unsere Lage war kritisch; der noch vorhandene Eisvorrat reichte freilich für uns und die Pferde noch mehrere Tage, aber die Kamele konnten keinen Tropfen mehr bekommen, und unser ganzes Streben war darauf gerichtet, diese unermüdlichen Veteranen um jeden Preis zu retten. Die Spuren der wilden Kamele wurden nunmehr stets auf der Karte verzeichnet. Ich glaubte, daß man aus ihren Richtungen[S. 26] Schlüsse auf die Lage von Quellen und Weideplätzen würde ziehen können. Die Spuren gingen meistens nach Nordwesten oder Südosten. Im Südosten dehnen sich die Kamischsteppen am Astin-joll aus, die wir schon durchquert hatten, und im Nordwesten gab es wahrscheinlich Quellen, die nur den Kamelen bekannt waren. Ich ging meistens zu Fuß und ruhte mich nur zeitweise im Sattel aus. Wenn es wirklich darauf ankam, eine Situation zu retten, hatte ich keine Ruhe zum Reiten. Die Kamele sind unerschütterlich ruhig und geduldig; nachts liegen sie geknebelt, keinen Grashalm bietet ihnen diese wüste Gegend, aber noch haben wir Vorrat von der Gerste der Mongolen.
Am 16. Februar sah ich ein, daß wir, wenn wir eine Katastrophe vermeiden wollten, direkt nach Süden gehen und versuchen müßten, den Wüstenweg mit seinen salzigen Brunnen wieder zu erreichen. Vergeblich spähten wir nach einer liegengebliebenen Schneewehe umher. Wir mußten nach dem flachen Lande hinunter, wo wir wenigstens versuchen konnten, einen Brunnen zu graben. Ich erstieg einen Paß in einer unbedeutenden Kette. Die Aussicht war nichts weniger als ermutigend, denn auf allen Seiten zeigten sich kleine Landrücken; es war dieselbe Mondlandschaft wie immer, dieselben trockenen Hügel ohne eine Spur von Gras, aus dem man auf eine gewisse Feuchtigkeit des Bodens hätte schließen können.
In einem breiten Tale sahen wir 57 frische Kamelspuren. Sie sammelten sich fächerförmig von allen Seiten und vereinigten sich zu einer Heerstraße, die ohne Zweifel nach einer Quelle führte. Nachher sahen wir noch 30 Spuren, die alle nach der großen Heerstraße gingen. Wir machten einen Augenblick Halt und hielten Kriegsrat. Gewiß war es, daß es hier nach einer Quelle ging, aber wie weit war es dorthin? Vielleicht mehrere lange Tagemärsche. Würde es nicht besser sein, nach Altimisch-bulak, das wir wenigstens kannten, zu ziehen? Wir folgten diesen Spuren nicht, so verlockend sie auch waren. Ganz kürzlich waren sie wie helle Stempel in den Boden gedrückt worden, aber merkwürdigerweise ließen sich die Kamele selbst nicht sehen. Bis in die unendliche Ferne lag das Land leer und schweigend da. Es war, als ob unsichtbare Geister diese Spuren hervorgerufen hätten. Ganze Karawanen von wilden Kamelen waren hier kürzlich gezogen, aber kein Tier war zu erblicken. Die Spuren führten nach Norden, vielleicht nach der Pawan-bulak, einer Quelle, von der Abdu Rehim, wie er mir im vorigen Jahre mitgeteilt hatte, gehört, die er aber nicht besucht hatte.
17. Februar. Unsere Lage fängt an, recht bedenklich zu werden. Die Kamele haben seit zehn Tagen außer einigen Mundvoll Schnee, die wir vor einer Woche fanden, nichts zum Löschen ihres Durstes bekommen. Ihre Kräfte können nicht bis in alle Ewigkeit ausdauern.
[S. 27]
Während unseres heutigen Marsches ließen wir die kleinen Ketten, die wir auf dem Zuge nach Norden überschritten hatten, der Reihe nach hinter uns zurück. Sie laufen eine nach der anderen im Westen aus und verschwinden dort spurlos; sie stehen also nicht einmal in fortlaufender Verbindung mit dem Kurruk-tag, obgleich sie zu demselben orographischen System gehören. Fern im Westen sahen wir die Ketten des Kurruk-tag; sie waren höher und größer als die bisher von uns überschrittenen. Da wir in ihrer Nähe größere Aussicht hatten Wasser zu finden als in der Wüste, richteten wir den Kurs dorthin und zogen nach Westen.
Nachdem ich die äußersten Vorsprünge des Gebirges hinter mir gelassen hatte, gelangte ich auf ganz ebenen salzhaltigen Boden hinunter, der jedoch auch Höcker in Gestalt von höchstens 2 Meter hohen Rücken und Anschwellungen hatte. Die Wüste erstreckt sich im Südwesten bis ins Unendliche, und auch im Nordosten wird ihr Horizont durch keine Berge verdunkelt.
Nachdem ich fünf Stunden zu Fuß gegangen war, wartete ich auf die Karawane. Das Terrain wurde nachher schlechter als die Sandwüste. Es waren dieselben Jardang oder Lehmrücken, die wir von der Lopwüste her kannten; hier aber waren sie bis zu 6 Meter hoch und 10 Meter breit. Sie haben eine nordsüdliche Richtung und liegen in unzähligen Reihen. Gäbe es nicht hie und da kleine Unterbrechungen durch Lücken, so wäre das Terrain vollkommen unpassierbar, denn ihre Seiten sind senkrecht. Wir müssen halbe, ja ganze Kilometer zwischen ihnen zurücklegen, ehe die nächste Lücke uns erlaubt, einige zehn Meter in unserer Richtung zu gehen. Hier nützt alle Geduld nichts; solch ein Terrain kann den Menschen zur Verzweiflung bringen.
Schließlich gelang es mir aber doch, uns aus diesem zeitraubenden Labyrinth hinauszulotsen. Bei dem zwischen einigen Hügeln aufgeschlagenen Lager war das organische Leben nicht einmal durch eine vom Winde verschlagene Tamariskennadel vertreten.
Todmüde krieche ich in meine Filzdecken und Pelze, habe aber noch lange nicht ausgeschlafen, wenn der Kosak mich weckt. Schon bei Tagesgrauen herrschte halber Nordsturm, der am Nachmittag in einen ohne Rast und Ruh heulenden und pfeifenden Buran erster Ordnung ausartete, und zwar in einen, der dicht am Erdboden hinfegt, Staub, Sand und kleine Steine mitweht und uns eiskalt gerade in die Seite schlägt. Wie man auch geht, immer wird man steif vor Kälte; die Hände schwellen auf und verlieren das Gefühl. Dies ist eine neue Unannehmlichkeit, die sich zu der Besorgnis um die Kamele und der Sehnsucht nach Wasser gesellt. Die Drangsale sammeln sich bösen Geistern gleich um unsere Karawane. Das[S. 28] Terrain ist abscheulich, unzählige Hügel müssen rechtwinklig gekreuzt werden.
Ich ging voraus und schleppte die Meinen 40 Kilometer weit mit. Unser Feuerungsvorrat war längst zu Ende, und kein Span war zu entdecken. Nichts weiter als Steine, Kies und Sand in dieser tückischen Mausefalle, die uns festhalten will und vor deren teuflischen Absichten wir unser Leben retten müssen. Die Kette, auf die mein Kurs gerichtet ist und an deren Fuße wir eine Quelle zu finden hofften, scheint zurückzurücken und vor uns zu fliehen. Sie verschwand jetzt vollständig im Nebel der Staubwolken; gegen Abend erschien sie daher unerreichbarer denn je. Die Kamele bewahrten trotz dieses forcierten Marsches ihre aufrechte, königliche Haltung und, obwohl sie keinen Stengel zu fressen, keinen Tropfen Wasser zu trinken bekamen, gingen sie doch mit hocherhobenem Kopfe und großen, nie unsicheren Schritten vorwärts.
Wir lagerten in der Dämmerung in einem offenen Tale, das keinen Schutz vor dem Sturm gewährte. Die Jurte bekam drei Überzüge von Filzdecken, aber der Ofen ließ sich aus Mangel an Brennholz nicht benutzen. Das bißchen Wärme, welches ich selbst, mein treuer Reisekamerad Jolldasch und das flackernde Licht verbreiten, wehen die Windstöße fort. Ein Sandwall wird rings um den unteren Jurtenrand aufgeworfen, aber trotzdem ist es drinnen so kalt wie in einem Keller. Von dem Eise sind nur noch einige Stücke übrig. Meine armen Begleiter begnügten sich mit einem Souper von einigen Stückchen Eis und Brot und krochen dann so schnell wie möglich unter ihre Filzteppiche; eine Holzlatte, die geopfert wurde, reichte nur zum Wärmen meines Tees.
Während draußen der Sturm die ganze Nacht tobte, schlief ich gut und ruhig in meinen Pelzen, fand es aber am Morgen des 19. Februars recht kalt, als ich ohne das gewöhnliche Morgenfeuer aufstehen mußte. Sobald ich nach einem Becher Tee und einem Stück Brot fertig war, eilte ich zu Fuß voraus. Wasser, Wasser! Das war der einzige Gedanke, der alle beherrschte; wir mußten um jeden Preis eine Quelle finden, denn die Kamele hatten seit zwölf Tagen nichts getrunken. Unsere Lage war wirklich kritisch; fanden wir kein Wasser, so würden die Kamele eines nach dem anderen sterben, gerade wie in der Wüste Takla-makan. Hier hatten wir jedoch den Vorteil, daß die Luft kalt und der Boden hart und eben war und uns erlaubte, die Gegenden in langen Tagemärschen zu durchmessen.
Ich hielt noch immer auf die Quelle Altimisch-bulak zu, deren Lage ich seit dem vorigen Jahre kannte. Doch nach Abdu Rehim sollte es östlich von ihr noch drei Quellen geben, und diese waren es, auf die ich jetzt[S. 29] hoffte und die ich suchte. Wie leicht aber konnten sie hinter Bodenerhebungen verborgen, hinter kleinen Kämmen versteckt oder tief in einer vom Wege aus unsichtbaren Bodensenke liegen. Wir konnten ahnungslos an ihnen vorbeigehen und uns wieder in dieses Meer von Einöden hineinverlieren. Sehr beeinträchtigt wurden wir auch durch den Sturm, der uns nur die allernächsten Gegenstände unterscheiden ließ. Entferntere Berge und Anhöhen verhüllte der Nebel; ich konnte mich daher nicht der Karten vom Vorjahre zur Orientierung bedienen. In der Takla-makan wußten wir wenigstens, daß wir stets an den Chotan-darja gelangen würden, gleichviel auf welchem Wege wir nach Osten gingen, und nach dem Zuge im Bett des Kerijaflusses mußten wir schließlich den Tarim erreichen, wenn wir nur nördlichen Kurs einhielten. Dort handelte es sich um Linien, hier aber um Punkte, an denen man in der staubgesättigten Luft leicht vorübergehen konnte, und hätten wir dies getan, so würden wir die Gegenden des Tarim nie wiedergesehen haben.
Mit steigendem Interesse beobachteten wir die oft ziemlich frischen Spuren der wilden Kamele, die nur im losen Sande vom Winde ausgelöscht, sonst aber deutlich waren. Man weiß, daß die Tiere vom Wasser kommen oder nach Wasser gehen und daß die Spur, ob man sie nach dieser oder jener Richtung hin verfolgt, früher oder später an eine Quelle führen muß. Aber es kann Tage und Wochen dauern.
Ich fühlte mich stets versucht, den Kamelpfaden zu folgen, und tat es mehrere Male. Sie sind sehr sonderbar. Ohne die geringste Veranlassung machen sie scharfe Biegungen im rechten Winkel; wenn sie mich aber gar zu sehr in die Irre führen, verlasse ich sie voller Ärger, aber nur, um bald auf einen neuen Pfad zu geraten. Im großen und ganzen liefen die Spuren von Norden nach Süden. Sah ich nach Norden, so erblickte das Auge eine rotbraune, sterile Bergwand, während im Süden nur die unabsehbare Wüste lag. Also war es am besten, westwärtszugehen und nach Abdu Rehims drei Quellen zu suchen.
Ich ging, als brennte es hinter mir, und ließ die Karawane weit hinter mir zurück. Meine in Schweden gemachten Stiefel hingen nach den 300 zu Fuß zurückgelegten Kilometern kaum noch in den Nähten zusammen, und meine Füße waren voller Blasen und schmerzten mich sehr. Schagdur, der mir sonst mein Reitpferd nachzubringen pflegte, ließ sich nicht blicken. Ich hatte beschlossen, nicht eher Halt zu machen, als bis ich Wasser gefunden hatte; ich wurde heute 36 Jahre alt und erwartete zum Abend eine angenehme Überraschung. Die Kamelspuren wurden nach Westen zu immer zahlreicher und bestärkten meine Hoffnung. Ich konnte jetzt keine zwei Minuten gehen, ohne eine Spur zu kreuzen.
[S. 30]
Schließlich gelangte ich an einen niedrigen Bergrücken, der mich zwang, eine südwestliche und südsüdwestliche Richtung einzuschlagen; ich ging daher in ein ausgetrocknetes Bett hinunter, in dem kürzlich 30 Kamele gewandert waren. Da ich hier eine Tamariske fand und Fährten von Hasen und Antilopen erblickte, blieb ich eine Weile an einer geschützten Stelle stehen. Diese Tiere können sich nicht sehr weit vom Wasser entfernen.
Jetzt kam Schagdur, und wir beratschlagten. Im Süden zeigten sich mehrere Tamarisken; dorthin lenkten wir unsere Schritte. Der Boden war hier stark feucht, aber auch mit einer dicken Salzkruste überzogen, und der Brunnen, der gegraben wurde, als die Karawane dort angelangt war, lieferte eine konzentrierte Salzlösung. Wir gingen daher nach Südwesten weiter. Der Sturm schob von hinten nach.
Ich eilte mit Schagdur vorwärts. Mein Schimmel folgte mir von selbst wie ein Hund, und Jolldasch schnüffelte und suchte überall umher. Nun folgten wir der Spur einer Herde von 20 Kamelen. So kamen wir mitten vor einen Talschlund, der auf unserer rechten Seite zwischen 3 und 4 Meter hohen Terrassen gähnte. In dieser ziemlich breiten, trompetenförmigen Mündung vereinigten sich alle Kamelspuren der Gegend zu einem Bündel oder einer Heerstraße, die in das Tal hineinging. Ich folgte ihr und war noch nicht zehn Minuten gegangen, als ich Jolldasch an einer weißglänzenden Eisscholle saugen sah!
Wir waren gerettet und hatten einen neuen Haltpunkt gewonnen, an dem die Karawane sich für die nächste Wüstenstrecke kräftigen konnte!
Die Quelle war wie gewöhnlich salzig, aber die Eisscholle, die nur 12 Meter Durchmesser hatte und 10 Zentimeter dick war, war ganz süß. Merkwürdigerweise hatte die Quelle nicht mehr als zwei kleinen, auf niedrigen Kegeln wachsenden Tamarisken Leben gegeben.
Schagdur blieb erstaunt vor dem Eise stehen und glaubte fast, daß ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise von dieser im Tale versteckten Quelle Kenntnis gehabt haben müsse, da ich direkt dorthingegangen war.
Oben auf der linken Uferterrasse erhob sich eine kleine halbmondförmige, einer Brustwehr oder einem Schirme gleichende Mauer, hinter welcher entschieden Jäger auf die wilden Kamele, die an der Quelle tranken, zu lauern pflegten.
Nun ließen wir uns nieder und zündeten ein Feuer an. Die Karawanenleute waren ebenfalls erstaunt und außerordentlich erfreut. Alle segneten diese rettende Eisscholle, von der wir mit neuen Eisvorräten nach Altimisch-bulak ziehen konnten. Erst aber bedurften wir einiger Rasttage nach dem Eilmarsche, dessen Wirkungen alle in den Beinen spürten. Faisullah und Li Loje gingen talaufwärts, um dort nach Weide auszuschauen,[S. 31] und kamen mit einigen dürren Stauden wieder, welche die Kamele sich gut schmecken ließen. Von dem Eise sollten sie erst fressen, nachdem sie sich von dem Marsche ausgeruht hatten, aber die Pferde durften sofort an seiner porösen Fläche knabbern.
Es war recht lustig, die Kamele abends mit kleingehackten Eisstücken zu füttern. Sie standen geduldig wartend im Kreise, und ein Stück nach dem anderen wurde zwischen ihren Zähnen zermalmt. Sie knabberten das Eis wie kleine Kinder Kandiszucker, und ihre Augen glänzten vor Freude und Zufriedenheit. Für uns wurden einige Säcke mit großen Eisscheiben gefüllt. Die Scholle war ergiebiger, als wir anfänglich geglaubt hatten und genügte überreichlich für unsere Bedürfnisse; aber die wilden Kamele, die sich während unseres Aufenthaltes der Quelle nahten, mußten unverrichteter Sache wieder umkehren.
Am 22. Februar legten wir nur 20 Kilometer zurück. Infolge des Nebels täuscht man sich unaufhörlich in der Entfernung. Wir lagerten in einer kleinen Oase von Tamarisken und Kamisch. Die Sträucher waren ziemlich dicht, aber trocken und lieferten uns Material zu größeren Feuern, als wir seit lange gehabt hatten.
Die Landschaft verändert sich von einem Tage zum anderen nur wenig und ist höchst einförmig. Alle Berge bleiben rechts liegen. Die Ausläufer des Kurruk-tag zeigen sich als abgebrochene Ketten, und wir passieren eine nach der anderen. Wir haben also gefunden, daß dieser Gebirgszug nach Osten hin immer niedriger und unbedeutender wird, ebenso wie das Land in jener Richtung steriler und die Quellen seltener und salziger werden.
Alles ist still und öde, nur der unermüdliche Wind fegt am Boden hin. Ich wanderte gedankenvoll durch dieses unbekannte Land und folgte mechanisch einer Ansammlung von Kamelspuren, die mich an eine neue Quelle mit einer weithin glänzenden Eisscholle führte. Hier treffen die Pfade der wilden Kamele gleich Radien aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Auch hier durften unsere Tiere eine Weile grasen; ich ging unterdessen nach Südwesten weiter.
Als ich zwischen niedrigen Hügeln talaufwärts ging, einem ziemlich tief in den Boden eingetretenen Pfade folgend, erblickte ich ein großes, schönes Kamel, das mich in dem Gegenwinde nicht witterte. Ich blieb stehen und wartete auf die Karawane, um Schagdur Gelegenheit zu geben, es zu schießen. Teils brauchten wir Fleisch, teils wollte ich ein vollständiges Skelett und eine Haut haben. Doch die Hunde verjagten das Tier, und so entging es der Gefahr. Schagdur war in der Hoffnung, dort eine Beute erwischen zu können, an der Quelle geblieben.
[S. 32]
Wieder kreuzten wir eine inselähnliche kleine Oase, wo die Tiere eine Stunde weiden durften, während ich meinen einsamen Spaziergang fortsetzte. Im Süden schimmerte es gelb aus dem Nebel, offenbar eine neue lockende Oase. In ihrem südlichen Teile erblickte ich 18 weidende Kamele und blieb wieder stehen, um auf die Karawane zu warten. Die wilden Kamele betrachteten die schwarze Reihe ihrer zahmen Verwandten mit unablässiger Aufmerksamkeit. Li Loje wurde zurückgeschickt, um Schagdur zu holen. Dieser kam atemlos an, war aber zu hitzig und schoß zu früh. Die Tiere verschwanden mit Windeseile in westlicher Richtung, und ich fürchtete, daß sie ihre Kameraden in Altimisch-bulak warnen würden und ich auf das Skelett verzichten müßte.
Wir lagerten an diesem herrlichen Platze, wo es Weide, Brennholz und Wasser im Überfluß gab. Es war die dritte von Abdu Rehims Quellen. Seine Angaben hatten sich als durchaus zuverlässig erwiesen.
24. Februar. Nach meinem Besteck und meinen topographischen Berechnungen müßte Altimisch-bulak in Westsüdwest 28 Kilometer von dieser Oase liegen. Ich führte also den Zug in dieser Richtung an, wurde aber von der nächsten, rechter Hand liegenden Bergkette gezwungen, einen westlicheren Kurs einzuhalten. Dies mußte die Kette sein, unterhalb welcher die Quelle von Altimisch-bulak liegt; hier konnte von einem Irrtum keine Rede sein. Wäre das Wetter nur klar gewesen, so hätten wir die Oase schon aus weiter Ferne erblicken müssen, nun aber verschwand alles im Staubnebel. Man hätte an der Oase vorbeigehen können, ohne sie zu sehen.
Doch mein Glücksstern lenkte meine Schritte, und die gelbe Weide schimmerte aus dem Nebel hervor (Abb. 194). Die Umrisse von fünf Kamelen zeichneten sich über dem Schilfdickicht ab. Schagdur entledigte sich seines Mantels und seiner Mütze und schlich sich dorthin. Mit dem Fernglase beobachtete ich den Verlauf der Jagd. Als der Schuß krachte, begann es sich im Schilfe zu regen, erst langsam, dann schneller, und schwarze Schattenrisse huschten über das Kamisch und verschwanden jenseits der Grenze der Oase. Es waren 14 Stück. Nach einem zweiten Schuß kam Schagdur triumphierend zu mir, um zu melden, daß er zwei Kamele erlegt habe. Das eine war ein junges Weibchen, das stehend photographiert und dann getötet wurde (Abb. 195). Das zweite war ein gewaltiges „Bughra“, das an dem Schusse sofort verendet war (Abb. 196). Sein Skelett und seine Haut sollten nach Stockholm gebracht werden.


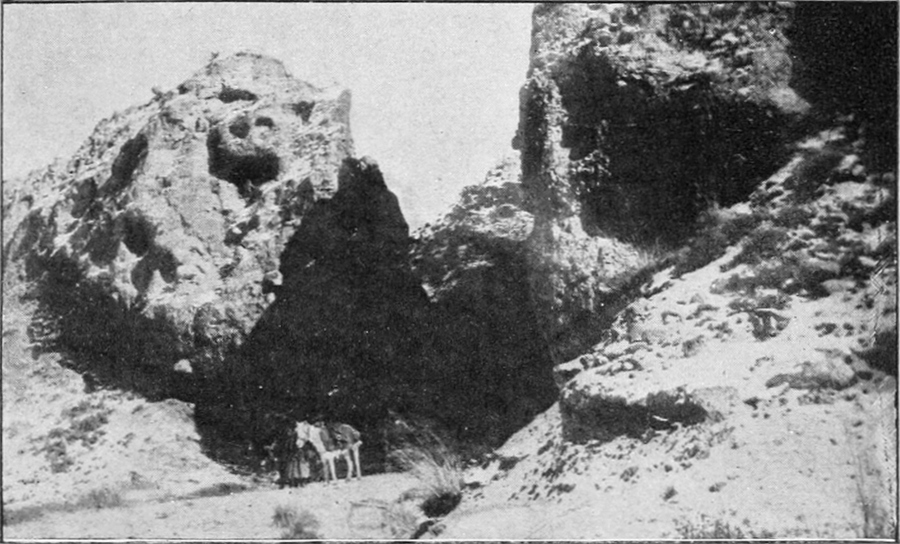
Den Muselmännern imponierte es außerordentlich, daß es mir trotz des Nebels gelungen war, Altimisch-bulak zu finden. Die zurückgelegte Entfernung betrug den letzten Tag 31 Kilometer; ich hatte mich also nur[S. 33] um 3 Kilometer verrechnet, was nicht viel ist, da die Länge der berechneten Strecke 2000 Kilometer betrug. Hier knüpften sich die astronomischen und topographischen Beobachtungsreihen an die des vorigen Jahres an, und es konnte mit den vorhandenen Daten nicht schwer sein, die Ruinen wiederzufinden.
Meine Jurte wurde in demselben Dickicht von Tamarisken und Kamisch, wo sie das Jahr vorher gestanden hatte, aufgeschlagen. Die Kamele und Pferde durften grasen. Es war ein gesegneter, glücklicher Tag.
Die noch übrigen Tage des Februars verbrachten wir in Ruhe an den Quellen von Altimisch-bulak (Abb. 197). Daß beständig ein Wind ging und das Land ewig in Nebel gehüllt war, störte uns wenig, denn wir hatten alles, was wir brauchten, und unsere Zelte lagen vor dem Winde geschützt. Der Brennholzreichtum war unerschöpflich, und das Feuer in meinem Ofen erlosch erst spät in der Nacht, wurde aber schon frühmorgens, ehe ich aufstand, wieder angezündet. Die Muselmänner fanden das Fleisch des jungen Kamelweibchens vortrefflich, und unsere Karawanentiere sah man in zerstreuten Gruppen behaglich weiden.
Ein ganzer Tag wurde auf Generalrepetition mit den Nivellierinstrumenten und den Männern, die bei dem Präzisionsnivellement durch die Wüste meine Gehilfen sein sollten, verwendet (Abb. 198). Der Umfang der Oase wurde mit Schritten ausgemessen; der vertikale Fehler auf dieser Strecke von 2756 Meter betrug nur 1 Millimeter. Das Resultat prophezeite also Gutes für das große Nivellement durch die Wüste auf einer Linie von mehr als 80 Kilometer Länge.
Eine kleine Episode mit Chodai Kullu, der bisher innerhalb der Karawanengemeinschaft gerade keine hervorragende Rolle gespielt hatte, muß der Vergessenheit entrissen werden. Der Mann galt für einen geschickten Jäger und besaß eine eigene Flinte, aber in den 14 Monaten, die er bei uns war, hatte keiner ihn auch nur einem Hasen etwas zuleide tun sehen. Man glaubte nicht, daß er mit dem Gewehre umzugehen wußte, und es erregte daher keine Verwunderung, als er es eines Tages um einen Spottpreis an Li Loje verkaufte, in dessen Händen es ebenso unschädlich blieb. Bei der Rückkehr nach Jangi-köll im vorigen Jahre hatte er versichert, daß er in Altimisch-bulak ein Kamel erlegt habe, und nun drangen seine Kameraden in ihn, er solle ihnen die Reste dieses Tieres zeigen. Er machte Ausflüchte und beteuerte, die Tat bei einer anderen Quelle in der Nachbarschaft verübt zu haben. Daran wollten die anderen aber durchaus nicht glauben, da Chodai Kullu über die Lage dieser Quelle keine Auskunft geben konnte. Sie machten sich immer über ihn lustig. Er war ein verträglicher, phlegmatischer Mensch, linkisch und jovial, und seine Gesichtszüge trugen einen vorwiegend komischen Ausdruck.
[S. 34]
Eines Morgens verschwand er vor Sonnenaufgang aus dem Lager, und die anderen, die den Tag über damit beschäftigt waren, das Skelett des von Schagdur erlegten Kameles zu reinigen, hatten keine Ahnung, wo er steckte. Sie vermuteten indessen, daß er auf die Jagd gegangen sei, denn eine Flinte fehlte.
In der Dämmerung fand er sich wieder ein und machte schon von weitem den Eindruck eines Triumphators. Wer wolle, könne ihn nach der Quelle begleiten und sich das Gerippe des im vorigen Jahre geschossenen Kamels ansehen, erklärte er ruhig. Die Quelle sei freilich in diesem Jahre ausgetrocknet, aber das Gerippe liege noch da, und was mehr sei, er habe auf seinem Streifzuge noch eine Quelle mit reichlichem Eisvorrat und Vegetation entdeckt. Dort habe er vier Kamele überrascht und ein Bughra geschossen. Während Chodai Kullu schmunzelnd umherging, war er in den Augen der anderen bedeutend gewachsen, und sie schämten sich sichtlich ihres offen ausgesprochenen Mißtrauens.
Nun wurde beschlossen, nach dieser Quelle zu ziehen, die ein geeigneterer, näherer Stützpunkt für die bevorstehenden Operationen gegen die Ruinen in der Wüste sein mußte. Sieben mit Eis gefüllte Tagare wurden wieder geleert, um die Kamele mit unnötigen Lasten zu verschonen.
Am 1. März sollte also Chodai Kullu seinen Ehrentag haben und uns den Weg nach der von ihm entdeckten Quelle zeigen. Er marschierte ganz selbstbewußt an der Spitze der Karawane unter fröhlichem Singen und mit einer so befriedigten Miene, als sei er Alleinherrscher über alle diese Wüsten und Oasen und ihre Bewohner, die wilden Kamele. Wir folgten seinen Schritten.
Der Weg führte nach Südwesten und Süden. Rasch haben wir die Oase vor uns (Abb. 199). Sie liegt so gut im Terrain versteckt, daß es unmöglich sein würde, sie zu finden, wenn man sie nicht kennte oder wie Chodai Kullu durch reinen Zufall dorthin geriet.
Während wir auf die anderen warteten, nahmen wir das erlegte Kamel genauer in Augenschein (Abb. 200, 201). Es lag in ganz natürlicher Stellung an dem Punkte, bis zu dem es noch hatte fliehen können, nachdem die heimtückische Kugel sein friedliches Weiden unterbrochen hatte, etwa hundert Schritte jenseits der Kamischgrenze der Oase. Wie verwundete und erschreckte Kamele zu tun pflegen, hatte es sein Heil gerade nach Süden, der Wüste zu, gesucht. Es war ein fettes, schönes Männchen. Eine Menge Zecken, die sich in seinem Pelze eingenistet hatten, zogen sich, nachdem das Blut erstarrt war, ratlos von dem Kadaver zurück.
Als die Temperatur in der Mittagsstunde auf +15 Grad stieg, fingen diese greulichen Milben wieder an, sich zwischen Büschen und Grashalmen[S. 35] zu bewegen. Sie kriechen in großer Anzahl innerhalb der Grenzen der kleinen Oasen umher, und man kann sich kaum vor ihnen schützen. Sie werden von den wilden Kamelen von einer Oase nach der anderen getragen und machen, in den Pelzen jener hängend, alle Reisen kostenlos mit.
Das Wasser der neuentdeckten Quelle, das in mehreren „Augen“ aus einem ziemlich tiefen Bett sprudelte, hatte eine Temperatur von +1,7 Grad und spezifisches Gewicht von 1,0232. Es ist so salzig, daß unsere zahmen Kamele sich durchaus nicht bewegen ließen, es zu kosten, was auch überflüssig war, da sich durch die Sonnenwärme kleine Süßwasserlachen auf der Oberfläche der Eisscholle gebildet hatten. Doch die wilden Kamele müssen im Sommer hiermit vorliebnehmen, ja vielleicht ziehen diese Wüstentiere das salzige Wasser dem süßen geradezu vor.
Das Eis war dick und rein, und neun Tagare wurden damit gefüllt. Die Oase kam uns wirklich außerordentlich gut zustatten. Sie lag den Ruinen 12 Kilometer näher und lieferte gute Weide, so daß ich alle drei Pferde und drei kränkliche Kamele unter Chodai Värdis Aufsicht hier zurücklassen konnte, während wir nach Süden aufbrachen.
Was die Verproviantierung des Mannes betraf, so erhielt er von unseren außerordentlich knappen Vorräten nur — eine Schachtel Zündhölzer, einen kleinen Eisentopf und ein bißchen Tee. Wasser hatte er in Überfluß, Fleisch konnte er von dem erlegten Kamel nehmen, mit den Zündhölzern konnte er sich Feuer anmachen, um seinen Tee zu kochen und seine Schnitzel zu braten. Nur ein kleines Mißgeschick traf ihn, wie er später erzählte, in der Einsamkeit. Als er am ersten Morgen erwachte, fehlten alle drei Pferde. Aus ihren Spuren sah er, daß sie sich auf eigene Hand nach Altimisch-bulak zurückbegeben hatten, weil dort das Gras noch besser war. Er mußte daher dorthin wandern und sie wieder holen und sie nachher strenger bewachen.
Am 2. März brach ich mit den sieben Kamelen auf und nahm das ganze Gepäck und die neun Eissäcke mit. In gewisser Beziehung wäre es besser gewesen, der Marschroute des vorigen Jahres von Altimisch-bulak nach den Ruinen, die dann leichter zu finden gewesen wären, zu folgen; aber auch auf diesem neuen Wege mußten wir sie finden können, obwohl man sie nicht eher sieht, als bis man dicht vor ihnen ist. Drei alte Steinmale zeigten, daß die Menschen, die einst die Ruinengegend bevölkerten, die kleine Oase gekannt haben. Wahrscheinlich haben sich von hier aus Jäger in den Kurruk-tag begeben.
Es dauerte nicht lange, bis wir merkten, daß wir uns dem Nordufer des ausgetrockneten Sees näherten. Erst verrieten zahlreiche Scherben von Tongefäßen das ehemalige Vorhandensein von Menschen in diesem Lande,[S. 36] darauf traten tote Tamarisken auf Kegeln und Hügeln auf, sodann die borstenähnlichen Stoppeln alter Kamischfelder und schließlich Schneckenschalen, letztere hier und dort in außerordentlicher Menge.
So sind wir denn wieder in der von Stürmen durchfurchten Tonwüste. Ich eilte zu Fuß weit voraus. Es war glühend heiß, und ich rastete eine Stunde in dem Schatten der überhängenden Tonscheibe einer Jardang. Als die Karawane mich eingeholt hatte, eilte ich weiter, bis ich einen geeigneten Lagerplatz erreichte. Doch auch hier mußte ich so lange warten, daß ich fürchtete, die Leute hätten meine Spur verloren. Toter Wald war in Menge vorhanden, und ich unterhielt mich damit, einen kolossalen Scheiterhaufen aufzustapeln, den ich dann anzündete. Von der Rauchsäule geleitet, kam endlich die Karawane in guter Ordnung herangezogen.
[S. 37]
Am Morgen des 3. März war es ziemlich kalt. Nach dem Besteck mußten wir von der Stelle, an welcher wir im vorigen Jahre auf die Ruinen gestoßen waren, noch 14 Kilometer entfernt sein. Es handelte sich nun um das Wiederfinden jener alten Häuser, in denen Menschen zu einer Zeit gewohnt hatten, in der das Klima und die Natur dieser Gegend noch ganz anders waren als jetzt und die Wüste keine Wüste, sondern ein reich bewachsenes Gebiet am nördlichen Ufer des von den Wassermassen des Kum-darja gebildeten Sees war. Wir schritten langsam vorwärts, nach allen Seiten umherspähend, um nicht an dem wichtigen Punkte, der jetzt Gegenstand einer gründlichen Untersuchung werden sollte, vorüberzugehen.
Gleich links von unserem Wege fand Schagdur die Ruinen zweier Häuser. Das östliche bildete ein Quadrat von 6,5 Meter Seiten, und seine 1 Meter dicken Mauern waren aus gebrannten Ziegeln in quadratischen Platten ausgeführt. Das aus Holz gebaute westliche Haus war schon sehr mitgenommen, aber man konnte sehen, daß es 26 Meter lang und ebenso breit wie das östliche gewesen war. In dem letzteren fanden wir eine kleine Kanonenkugel, einen kupfernen Gegenstand, der genau die Form einer Ruderklammer hatte, einige chinesische Münzen und zwei rote irdene Tassen.
Eine Strecke weiter, als wir uns nach meiner Karte in der unmittelbaren Nachbarschaft des Fundortes vom vorigen Jahre befinden mußten, machten Faisullah und ich mit den Kamelen Halt, während die anderen zur Erkundung der Gegend ausgeschickt wurden. Sie blieben mehrere Stunden fort, und da es kurz vor Sonnenuntergang war, beschloß ich, am Fuße eines Lehmturmes, der sich eine Stunde östlich von unserem Rastplatze erhob, zu lagern. In der Dämmerung langten wir dort an und befreiten zu zweit die Kamele von ihren Lasten, worauf ich mit Hilfe eines Seiles und einer Axt den Turm bestieg. Er war um ein Gerippe von Balken, Reisig und Kamisch herumgebaut, so daß ich oben auf der Spitze ein Signalfeuer anzünden konnte.
[S. 38]
Die Ausgeschickten kehrten jetzt gruppenweise zurück. Einige hatten ein von mehreren Hausruinen umgebenes hohes „Tora“ (Lehmturm) gefunden und empfahlen jenen Platz als Hauptquartier. Sie brachten als Beweis etwas Schrot, eine verrostete eiserne Kette, eine kupferne Lampe, Münzen, Scherben und einen Krug mit.
Bei Sonnenaufgang lenkten wir unsere Schritte nach dem neuen „Tora“ (Abb. 202) und lagerten unmittelbar im Südwesten davon, um Schutz von ihm zu haben, wenn sich ein Sturm erheben sollte. Unter einer nach Norden überhängenden Lehmterrasse wurden auf einigen Balken die Eissäcke aufgestapelt; dort war unser „Gletscher“, unser Eiskeller.
Nachdem die Kamele sich eine Weile ausgeruht hatten, sollten sie zu ihren Kameraden nach der Quelle zurückgeführt werden. Dieses verantwortungsvolle Geschäft wurde Li Loje anvertraut. Er sollte über Nacht an dem Punkte bleiben, wo das Terrain nach dem Gebirge anzusteigen beginnt. Soweit sollte der alte Faisullah mitgehen und dafür sorgen, daß der Jüngling in unsere Spur kam, dann aber schleunigst wieder zu uns zurückkehren. Li Loje hatte sich im übrigen an folgenden Befehl zu halten: er sollte in zwei Tagen nach der Quelle gehen, zwei Tage dort bleiben und schließlich mit der ganzen Karawane und einem großen Eisvorrat in weiteren zwei Tagen zurückkehren.
Als die Kamele zwischen den Jarterrassen verschwunden waren, war uns jegliche Transportmöglichkeit abgeschnitten. Unser Lager mußten sie jedoch leicht finden können. Der Turm war weithin sichtbar (Abb. 205), und am 9. März wollten wir auf seinen Zinnen ein Leuchtfeuer unterhalten. Nach ihrer Ankunft mußten wir sofort nach Süden weiterziehen, und es galt daher, die uns zur Verfügung stehenden sechs Tage nach Möglichkeit auszunutzen. Den ersten Tag benutzte ich zu einer astronomischen Bestimmung, während sämtliche Leute die Nachbarschaft abstreiften und sich erst am Abend mit ihren Berichten und Beobachtungen wieder einstellten.
Ich kam nur noch dazu, von der Spitze des Turmes ein paar Aufnahmen zu machen, die ich beigefügt habe (s. auch I, Abb. 86) und die einen deutlicheren Begriff von der Gegend geben als alle Beschreibungen. Im Vordergrund sieht man meine Jurte, die durch einige Balken vor dem Umfallen geschützt ist (Abb. 203). Im Hintergrund leuchtet die Wüste gelb und gleichförmig mit ihren scharfkantigen Tafeln und Jardangs von Lehm. Hier und dort erhebt sich ein mehr oder weniger von der Zeit zerstörtes Haus (Abb. 204); in seinem Inneren wohnen nur Stille und Tod. Die einzigen lebenden Wesen, die sich in Sehweite befanden, waren ich selbst und mein Hund Jolldasch.
[S. 39]
Es ist so still und feierlich wie auf einem Friedhof, der bis an den Horizont reicht. Man fühlt, daß das Leben hier einst in frischen Schlägen pulsiert hat, aber durch erbarmungslose Naturkräfte vernichtet worden ist. Der frühere Wald hat den Stürmen freies Feld gelassen, und die Sterne blicken auf Vergänglichkeit und Öde herab.
Es war unser erster Tag in dieser Gegend, die ich noch nicht hatte rekognoszieren können; ich wußte aber, daß ich vor einem großen, herrlichen Probleme stand. Würde diese geizige Erde, die sicherlich viele Geheimnisse zu verbergen hatte, mich etwas wissen lassen, das keine anderen Menschen auf Erden wußten? Würde sie uns einige ihrer Schätze schenken und mir auf die zahllosen Fragen, die gerade hier auf mich einstürmten, Antwort geben? Nun gut, ich würde jedenfalls tun, was ich konnte, um die schweigenden Ruinen zum Sprechen zu bringen, und mit ganz leeren Händen würden wir wohl nicht abzuziehen brauchen, wenn die Glocken das nächste Mal am Fuße des „Turmes der Stille“ läuteten. Ich hatte meinen ganzen ursprünglichen Reiseplan geändert und war auf Grund der von Ördek im vorigen Jahr gemachten wichtigen Entdeckung hierher zurückgekehrt. Dieser große Zeitverlust würde doch wohl nicht vergeblich gewesen sein?
5. März. Nach einer langen, ruhigen Nacht in diesem eigentümlichen Lager, das der frischen Quelle, die wir vor kurzem verlassen hatten, so unähnlich war und in dem uns nur der Eisvorrat am Leben erhalten konnte, machte ich einen Morgenspaziergang zwischen den Ruinen, während meine Leute schon damit beschäftigt waren, aus allen Kräften zu graben. Sie hatten das Eingeweide eines Hauses auf- und umgewühlt, aber nichts weiter gefunden als das Rad einer Arba und einige hübsch gedrechselte Pilaster. Im übrigen barg der Sand nur wertlose Dinge, die jedoch auch nicht jeglicher Bedeutung ermangelten, da sie stets zur Erklärung der Lebensweise der ehemaligen Bewohner beitrugen. Darunter waren rote Zeugstücke von derselben Sorte, wie sie die mongolischen Lamas noch heute tragen, Filzlappen, Büschel von braunen Menschenhaaren, Skeletteile von Schafen und Rindern, chinesische Schuhsohlen, ein Bleigefäß, merkwürdig gut erhaltene Stricke, Scherben von einfach ornamentierten Tongefäßen, ein Ohrgehänge, chinesische Münzen usw. In einem Hause, das wahrscheinlich als Stall gedient hatte, wurde ein dickes Lager von Pferde-, Rinder-, Schaf- und Kameldung durchgraben. Nur der Umstand, daß dieses Lager unter einer Schicht von Sand und Staub gelegen hat, macht es erklärlich, daß es nicht pulverisiert und vom Winde fortgetragen worden ist. Doch keine Schrift, nicht ein Buchstabe, der uns das Rätsel hätte lösen können; nur ein kleiner unbeschriebener, gelber Papierfetzen wurde[S. 40] gefunden. Ganz dicht beim Lager erhoben sich die Balken eines Hauses, in dessen Innerem wir jedoch nichts fanden.
Die Verhältnisse sind in diesem alten Orte ganz anders als in den Städten, die ich auf meiner vorigen Reise am Kerija-darja entdeckte. Dort liegen die Ruinen durch Sand geschützt, hier aber ist das Erdreich nackt. Was hier zurückgelassen oder vergessen worden ist, als die Einwohner von hier fortzogen, hat unbedeckt auf der Oberfläche des Bodens gelegen und ist vom Wetter und von den Winden angefressen und zerstört worden. Nur im Schutze der kleinen, höchstens 3 Meter hohen Lehmterrassen hat sich eine dünne Sandschicht angehäuft.
Der Turm, die imponierendste Ruine des Ortes, lockte mich besonders an, und ich ließ die Leute ihn in Angriff nehmen (Abb. 206). Er konnte ja, gleich einem Hünengrab, ein Geheimnis in seinem Inneren bergen. Es war jedoch gefährlich, an ihm zu rühren. Ein großes Stück seiner Spitze mußte erst mit Stricken und Stangen abgerissen werden; es stürzte herunter wie ein donnernder Wasserfall, ganze Wolken von braunem Staub aufrührend, der von dem ziemlich starken Nordostwind über die Wüste fortgewirbelt wurde (Abb. 207).
Sodann wurde von oben ein senkrechtes Loch, einem Brunnen vergleichbar, gegraben; einen Tunnel von der Seite zu machen, wäre ein zu großes Wagestück gewesen, denn der Turm war voller gefährlicher Risse, und sein trockenes, loses Material hätte leicht einstürzen können. Der 8,8 Meter hohe Turm war jedoch massiv und wurde nur von horizontalen Balken durchzogen, die den an der Sonne getrockneten Ziegeln Halt gaben. Nur bis zu 3 Meter Höhe von der Basis haben diese eine rötliche Färbung, als seien sie leichtem Feuer ausgesetzt gewesen.
Unterdessen zeichnete ich einen genauen Plan von dem Dorfe, dessen Häuser in einer Reihe liegen und stets von ungefähr Südosten nach Nordwesten gerichtet sind.
Einige Häuser sind ausschließlich aus Holz gebaut gewesen, und die senkrechten Wandplanken sind in Balkenrahmen, die unmittelbar auf dem Erdboden liegen, eingefügt gewesen. Bei anderen bestehen die Wände aus Kamischgarben, die mit Weiden zwischen Stangen und Pfosten eingeflochten sind. Schließlich sind noch ein paar Häuser von an der Sonne getrocknetem Lehm vorhanden.
Die meisten dieser alten Wohnungen sind eingestürzt, aber viele Balken und Pfosten stehen noch aufrecht, obwohl ihnen Wind und Sand recht übel mitgespielt haben (Abb. 208). Aus dem Aussehen des Bauholzes auf das Alter zu schließen, ist unmöglich. Wohl sieht es sehr alt aus und ist grau-weiß, rissig und zerbrechlich wie Glas, andererseits aber sollte man meinen, daß[S. 41] Stürme, Flugsand und Unterschiede von 80–90 Grad zwischen der niedrigsten Nachttemperatur des Winters und der höchsten Tagestemperatur in der Sommersonne das Material in verhältnismäßig kurzer Zeit ziemlich arg ruinieren können.
Drei Türrahmen standen noch. In einem von ihnen war sogar noch die Tür selbst an ihrem Platze, weit offen, wie sie der letzte Eigentümer beim Aufbruch nach einem anderen Wohnorte gelassen hatte. Sie war bis zur Hälfte in Sand und Staub gebettet.
Sämtliche Gebäude erheben sich auf kleinen Hügeln; daß sie aber ursprünglich auf ebenem Boden errichtet worden sind, davon ist man schon beim ersten Anblick völlig überzeugt, denn die Plattform des Hügels hat ganz dieselbe Fläche wie der Grundriß des Hauses. Die Teile des Bodens ringsumher, die das Bauholz nicht schützte, sind vom Wind ausgehöhlt worden und bildeten Einsenkungen. Da wohl 3 Meter von der Oberschicht des Lehmbodens weggehobelt worden sind, kann man sich denken, daß ziemlich lange Zeiträume verflossen sein müssen, seit das Dorf verlassen worden ist.
Um Faisullah den Weg nach dem Lager zu zeigen, zündeten wir am Abend einen gewaltigen Scheiterhaufen an. An der Basis des Turmes lagen Massen von Balken und Pfosten, die ihrerzeit einen Rundbau um ihn herum gebildet zu haben scheinen. Aus ihnen wurde ein Scheiterhaufen von riesenhaften Dimensionen aufgetürmt, und es war ein in hohem Grade phantastischer, großartiger Anblick, den alten, grauen Turm in feuerroter Beleuchtung, die die Wirkungen des Mondscheins beinahe ganz aufhob, zu sehen. Einige Leute schürten das Feuer mit langen Stangen, die anderen saßen niedergekauert am Fuße des Turmes. Dicke Rauchwolken und ganze Feuerwerke von Funken flogen nach Südwesten. In einer klaren Nacht mußte ein solches Feuer schon in einer Entfernung von mehreren Tagereisen sichtbar sein. Faisullah wurde auch durch seinen Schein auf den richtigen Weg geführt, nachdem er Li Loje geholfen hatte, die Spur nach der Quelle zu finden.
6. März. Als ich heute aufwachte, waren alle meine fünf Männer verschwunden, und ich mußte sehen, wie ich mit dem Feueranmachen und dem Essenkochen fertig wurde. Wir waren nämlich übereingekommen, daß es am klügsten wäre, wenn wir den ganzen Tag zum Auskundschaften einer besseren Stelle benutzten.
Die Leute sollten radial, jeder in einer anderen Richtung, gehen. Es wurde eine förmliche Treibjagd auf Ruinen, und die Leute interessierten sich so sehr dafür, daß sie viel zu lange aufblieben und sich beim Feuer darüber unterhielten. Sie hatten den ganzen Tag vor sich, und wenn sie[S. 42] sich vor Dunkelwerden nicht wieder einstellten, sollte ich sie mit einem Signalfeuer zurückrufen, dessen Holzstoß sie vor dem Aufbrechen aufzuschichten hatten. Schagdur hatte ich eine detaillierte Marschroute gegeben, die angab, wo der vorjährige Lagerplatz lag und wo die von Ördek gefundenen Ruinen zu suchen sein mußten.
Sonntagsruhe umgab mich auf allen Seiten, als ich erwachte; ich mußte an das Leben in der Laubhütte am Chotan-darja, als die Hirten in den Wald gegangen waren, denken. Ich photographierte mehrere Partien der Dorfruinen, nahm eine Mittagshöhe, beendigte die Planaufnahme und untersuchte die verschiedenen Schichten der Tonablagerungen.
Es waren ihrer sechs von verschiedener Dicke. Auffallend ist, daß einige Schneckenschalen und Pflanzenreste enthalten, andere aber nicht, was verschiedene klimatische Verhältnisse während verschiedener Perioden anzeigt. Vielleicht haben sich die von organischem Leben freien Schichten in salzigem Wasser gebildet. Da sich im alten See Lop-nor Sedimente von 9,6 Meter Dicke haben absetzen können, liegt die Vermutung nahe, daß der Kara-koschun, auch wenn die Ablagerung dort viel unbedeutender ist, eines Tages wird nach Norden zurückwandern müssen. Noch immer ist es derselbe See, der in die Nivellierung des Landes eingreift, aber er führt ein Nomadenleben; bald liegt er im nördlichen, bald im südlichen Teile der Wüste.
Mein Tag verlief in der Einsamkeit still und ruhig. Am Abend kamen die Kundschafter, vom Feuerschein geführt, einer nach dem anderen wieder. Schagdur traf erst um 9 Uhr ein; er war den ganzen Tag auf den Beinen gewesen, die anderen hatten die heißen Stunden gewiß verschlafen. Die Lehmterrassen hatten ihn in der Dunkelheit viele Purzelbäume machen lassen. Die Rinnen zwischen ihnen sehen wie schwarze Gräben aus, man kann ihre Tiefe nicht beurteilen und fällt infolgedessen oft wirklich in den Graben. Schagdur hatte sich daher gerade hinlegen und die Morgendämmerung abwarten wollen, als das Feuer aufgelodert war. Mein prächtiger Kosak hatte so lange gesucht, bis er sowohl das Ruinenlager vom vorigen Jahre wie Ördeks Fundort entdeckt hatte.
Der 7. März sollte zur Untersuchung des letzteren benutzt werden. Um 8 Uhr setzte ich mich mit allen Männern, außer Kutschuk, der für das Signalfeuer sorgen sollte, in Marsch. Schagdur war unser Führer.
Der Weg ging genau südlich von dem Lagerturme vom 3. März, in dessen Nähe wir eine tiefe Einsenkung kreuzten, die einem alten Kanale glich. Ein neues „Tora“ wurde entdeckt. Beinahe in jedem Dorfe der Gegend gibt es einen Lehmturm; hier und dort liegen Balken umher, die von dem Vorhandensein ehemaliger Häuser Kunde geben. Ein solcher Balken hatte 7,8 Meter Länge und 35 × 17 Zentimeter Stärke. Hier sind[S. 43] also in früheren Zeiten ebenso prächtige Pappeln gewachsen wie nur irgendwo in den Urwäldern des Tarim.
Das Terrain, auf welchem wir jetzt wanderten, ist sehr interessant und verdient eine flüchtige Beschreibung. Wir gehen nach Westnordwest und kreuzen alle Lehmterrassen auf und ab im Zickzack. In kleinen Gruppen stehen uralte Pappeln; ihre Gruppierung ist genau dieselbe wie am Kara-köll, am Tschiwillik-köll und an den unteren Armen und Wasserläufen des Tarim. Manchmal stehen sie in Linien, manchmal in Hainen. Wo sie fehlen, haben sichtlich Flußarme gelegen oder Seen sich ausgedehnt, und ihre Gruppierung zeigt den Verlauf der Ufer an. Sonst sind Kamischstoppeln außerordentlich häufig, aber nur 20 Zentimeter hoch. Die Stengel sind so von Staub und Sand durchdrungen, daß sie bei der Berührung wie Ton zerspringen, aber die Blätter, die jedoch seltener noch vorhanden sind, lassen sich noch biegen. Auch das Bauholz ist in dieser Gegend so voll Sand, daß es im Wasser untergeht.
So erreichten wir das Lager vom vorigen Jahre, das an den Kohlenhaufen von unseren Feuern leicht wieder zu erkennen war. Nach ein paar weiteren Kilometern waren wir an Ördeks Fundort. Hier fanden wir 8 Häuser, von denen nur drei so weit erhalten waren, daß ich von ihnen einen Plan aufnehmen konnte. Sie waren angelegt wie ein chinesisches Yamen (Amtslokal): ein Hauptgebäude und zwei große Flügelgebäude. Zwischen ihnen liegt ein viereckiger Hof, den im Südosten ein Plankenzaun mit einer Tür, deren Pfosten noch dalagen, einfriedigt.
Das ziemlich kleine Hauptgebäude ist entschieden ein Buddhatempel gewesen (Abb. 209). Hier war es, wo Ördek seinen Fund gemacht hatte; die Spuren seines Pferdes waren noch in einer Vertiefung zu sehen.
Die mitgenommenen Spaten wurden in den Sand gestochen, und nach einer Weile tauchte Buddha selbst auf, obwohl in wenig schmucker Inkarnation. Das Bild war von Holz und hatte noch Kopf und Arme. Ohne Zweifel war es nur das Gerippe einer tönernen Statue, die in gewöhnlicher Weise geschmückt und bemalt gewesen war.
Die beigefügten Bilder (Abb. 210, 211) geben dem Leser einen klareren Begriff von dem Aussehen der mitgebrachten Schnitzereien als alle Beschreibungen. Auf einige von ihnen will ich jedoch besonders aufmerksam machen. Auf einem Pfosten ist eine ganze Reihe stehender Buddhabilder dargestellt, auf einem anderen eine Reihe sitzender; jedes Bild hat über sich einen Heiligenschein, der einem Rundbogen gleicht. In einem Ornamente kommt zwischen Blättern und Ranken ein Fisch vor; seine Kiemendeckel und Schuppen sind vollkommen deutlich. Der Künstler würde nie auf den Gedanken geraten sein, einen so wenig dekorativen Gegenstand wie den Fisch in seinen[S. 44] Schnitzereien zu verwenden, wenn dieses Tier nicht von besonderer Bedeutung für die Gegend gewesen wäre und eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Bevölkerung gebildet hätte. Es wäre ja sonst höchst unmotiviert, statt der Vögel Fische mit Girlanden und Blättern zu verflechten. Gäbe es nicht andere, unwiderlegliche Beweise dafür, daß die Dörfer am Ufer eines Sees gelegen haben, so könnte man eine dahinzielende Vermutung schon auf Grund des Vorkommens des Fisches in der Ornamentik aufwerfen. So wie das Land jetzt aussieht, wäre der Fisch das letzte Tier, an das man denken würde.
Die Lotosblume bildet in diesen Schnitzereien ebenfalls ein hervortretendes, dankbares Motiv, sowohl in langen Reihen auf ziemlich großen Planken wie auf Scheiben von 50 Quadratzentimeter, die zwischen jene eingefügt gewesen sind.
Noch ein Fund von großer Bedeutung wurde hier gemacht. Schagdur grub mit seinem Spaten Erde auf und durchsuchte diese, wobei ein kleines Holzbrett zum Vorschein kam, das mit Schriftzeichen beschrieben war, die wir nicht lesen konnten. Er achtete nicht darauf, sondern warf das Brettchen als wertlos beiseite, aber durch reinen Zufall nahm ich es auf, weil mir das Holz unglaublich wohlerhalten vorkam. Jeder Buchstabe war scharf und deutlich mit Tusche aufgetragen, aber die Schrift war weder arabisch noch chinesisch, weder mongolisch noch tibetisch. Was hatten diese geheimnisvollen Worte wohl mitzuteilen? Ich nahm das Brettchen und bewahrte es so sorgfältig wie Gold.
Die Belohnung von 10 Sär, die ich dem versprochen hatte, der zuerst etwas Geschriebenes, gleichviel in welcher Gestalt, finden würde, fiel also Schagdur zu (Abb. 212). Nachdem derselbe Preis für den nächsten derartigen Fund versprochen worden war, gruben die Männer mit verdoppeltem Eifer in dem friedlichen Innern des armen Tempels, siebten den Sand durch die Finger und untersuchten jeden Span von beiden Seiten, aber ohne Erfolg. Nur die Schnur eines Rosenkranzes, einige chinesische Kupfermünzen und eine Menge flacher irdener Schalen, die wohl mit Opfergaben vor die Götter gestellt worden waren, kamen zum Vorschein.
Wie anders ist dieses Land jetzt gegen früher! Kein vom Winde verwehtes Blatt, nicht einmal eine Wüstenspinne ist zu sehen; die Skorpione, die verdorrte Pappeln lieben, würden hier vergeblich Schlupfwinkel suchen. Der Wind ist die einzige Kraft, die in diesem erstarrten, totenstillen Reiche Geräusch und Bewegung verursacht. Man würde hier nicht eine ganze Woche bleiben können, wenn man nicht, wie wir, Verbindung mit einer Quelle hätte.
Daß der kleine Tempel ein vollendetes Kunstwerk gewesen, geht aus[S. 45] all den kleinen und großen Schnitzereien, die wir ausgruben, deutlich hervor. Zu einem Ganzen zusammengefügt, haben sie mit ihren geschmackvoll und mühsam geschnitzten Ornamenten eine wahre Augenweide gebildet.
Und welch herrlicher Aufenthaltsort muß es gewesen sein, als der Tempel noch mit seiner zierlichen, wahrscheinlich ebenfalls bemalten Fassade prunkte und auf mehreren Seiten von dichtbelaubten Pappelhainen umgeben war, die nur durch Seebuchten, Kamischfelder und von gewundenen Kanälen bewässerte Äcker voneinander getrennt waren! Hier und dort lagen Dörfer zerstreut, und ihre Lehmtürme oder „Pao-tai“ waren hoch genug, um sich über den Wald zu erheben, damit sie mit ihren Signalfeuern in Kriegsgefahr von den Nachbardörfern aus gesehen werden konnten und die große Heerstraße, die hier vorbeiführte, anzeigten. Im Süden dehnte sich der gewaltige blaugrüne Wasserspiegel des Lop-nor aus, umrahmt von Hainen und mächtigen Schilf- und Binsenfeldern und reich an Fischen, Wildenten und Gänsen. Im Hintergrunde, gegen Norden, zeichnete sich wie jetzt bei klarem Wetter der Kurruk-tag ab, in welchem die hiesige Bevölkerung alle Quellen und Oasen, durch die früher sicherlich ein Weg nach Turfan führte, gekannt haben wird.
Wir Pilger einer späteren Zeit fühlten sofort, daß wir uns in einer Gegend befanden, die schöner und herrlicher als vielleicht irgendeine in dem heutigen Ostturkestan gewesen war. So künstlerisch und geschmackvoll verzierte Häuser gibt es jetzt in diesem Teile Asiens nicht, und das dichte, leuchtende Grün ließ die Architektur noch wirkungsvoller hervortreten.
Und jetzt! Nur unzählige Grabmale nach all dieser Herrlichkeit! Und warum? Weil der Fluß, der Tarim, sich ein anderes Bett grub und sein Wasser nach Süden schickte, um neue Seen zu bilden. Der alte See trocknete schnell aus, vielleicht schon in wenigen Jahren, der Wald und das Schilf lebten noch ziemlich lange von der Feuchtigkeit des Bodens, dann aber siechten auch sie allmählich dahin, wobei die Bäume, welche die längsten Wurzeln hatten, am zähesten waren; aber schließlich waren auch sie zum Tode verurteilt. Jetzt ist alles ein großer Friedhof, in welchem man jedoch auf den Grabinschriften von einer früheren, üppigen Vegetationsperiode liest.
Als wir, mit der Ernte des Tages zufrieden, mit dem Graben aufhörten, näherte sich die Sonne dem Horizont, und wir brachen auf. Der Wind erhob sich, der östliche Horizont war grau und düster, der Nebel verdichtete sich, ein heftiger Sturm schien im Anzug zu sein, und wir beschleunigten unsere Schritte, um das Lager noch vor Dunkelheit zu erreichen. Endlich tauchte der westliche Lagerturm auf, und nun mußten wir unseren Weg im Staubnebel selbst finden können. Der Wind fegte[S. 46] Sand- und Staubmassen durch die Rinnen; sie eilten vorwärts wie Wasser in seinem Bette, man glaubte förmlich zu sehen, wie der Wind an den Seiten und Rändern der Rinnen feilte, und man kann sich denken, welch kräftigen Bundesgenossen er in dem Flugsande hat, der das leicht zerstörbare Tonmaterial wie Sandpapier zerreibt.
In der Dämmerung erblickten wir den Schein von Kutschuks Signalfeuer, dessen Flammen immer höher aufloderten. Wir waren rechtzeitig zu Hause, ziemlich ermüdet von einem Spaziergange von 28 Kilometer, doch weniger von der Länge des Weges als von dem beschwerlichen Terrain. Wenn man den ganzen Tag hat dursten müssen, schmeckt ein großer Becher auf Eis gekühlten Wassers mit Zitronensäure und Zucker gar zu gut!
Am 8. durften alle ausschlafen. Der Buran war stärker geworden, die Luft war mit Staub gesättigt; heute wäre es unmöglich gewesen, die Tempelruine zu finden.
Durch die versprochenen Belohnungen angespornt, arbeiteten die Leute um das Lager herum mit ihren Spaten aus Leibeskräften, und jetzt sollten ihre Anstrengungen von einem Erfolg gekrönt werden, von dem ich kaum zu träumen gewagt hätte. Vergeblich hatten sie den Sand in vielen verlassenen Holzgebäuden untersucht, als sie ihre Aufmerksamkeit einem aus an der Sonne getrockneten Lehmziegeln erbauten Hause zuwandten, das einem Stalle mit drei Ständen glich (Abb. 213). Jedenfalls sah es im ganzen Dorfe am wenigsten verheißungsvoll aus. Aber gerade hier, in dem, von vorn gesehen, rechten Stande, fand Mollah einen kleinen zerknitterten Papierfetzen mit mehreren ganz deutlichen chinesischen Schriftzeichen.
Es ist nicht zuviel gesagt, daß der Inhalt dieses Standes nun buchstäblich durchgesiebt wurde. Zwei Fuß tief, unter Sand und Staub, stießen wir auf etwas, das ich einfach einen Kehrichthaufen oder eine Unratbucht nennen möchte, das aber diverse schöne Raritäten enthielt. Dort fanden wir Lumpen von Teppichen und Schuhzeug, Schafknochen, Körner und Stroh von Weizen und Reis, eine Menge Rückenwirbel von Fischen und unter all diesem Trödel — wohl ein paar hundert beschriebene Papierstücke nebst 42 Holzstäben, die der Form nach schmalen Linealen glichen und ebenfalls mit Schriftzeichen bedeckt waren.
Dieser Fund war ein Triumph. Sollte es übertrieben sein, ein so starkes Wort da zu gebrauchen, wo es sich nur um alte Papierblätter handelt? Nein, durchaus nicht! Ich sah voraus, daß diese Blätter ein kleines Stück Weltgeschichte enthalten und mir den Schlüssel zur Lösung des ganzen Lop-nor-Problems schenken würden. Die rein geographischen und geologischen Untersuchungen enthüllten wohl deutlich genug Tatsachen; sie zeigten, daß das Land früher so und so ausgesehen haben muß; hier[S. 47] in der Wüste hatte ja ein großer See sein Bett gehabt, und hier in den Ruinen hatten Menschen gewohnt.
Doch die Bruchstücke der Dokumente würden meinen mühsamen Untersuchungen Schwarz auf Weiß ihr Schlußzeugnis geben; sie würden den Stempel auf diese ganze Arbeit drücken, die seit Jahren Gegenstand meiner Arbeit und meiner Studien gewesen; sie würden erzählen, wann dieser See existierte und welche Menschen hier wohnten, unter welchen Verhältnissen sie lebten, mit welchen Teilen Innerasiens sie in Verbindung standen, ja vielleicht sogar, welchen Namen ihr Land führte. Dieses Land, das sozusagen vom Erdboden vertilgt worden ist, diese Menschen, deren Geschichte längst der Vergessenheit anheimgefallen und deren Geschicke vielleicht nicht einmal Annalen anvertraut worden sind, alles dieses würde, so hoffte ich, jetzt wieder ans Tageslicht gezogen werden. Ich stand vor einer Vergangenheit, die ich wieder ins Leben rufen würde. Wäre es auch nur ein kleines Volk, ein unbedeutender Staat gewesen, was machte das aus? Es war doch immer eine Lücke im menschlichen Wissen, die jetzt ausgefüllt werden würde.
Die Muselmänner hofften wie gewöhnlich Gold zu finden, aber ich hätte die zerrissenen, schmutzigen Brieffragmente nicht gegen große Schätze vertauscht.
Daß dies wirklich ein Kehrichtloch gewesen, ging daraus hervor, daß der Raum viel zu klein war, um als Zimmer habe dienen zu können, und daß alle Papiere nur Bruchstücke waren; sie waren zerrissen und fortgeworfen worden. Infolge dieses Umstandes hoffte ich auch, daß es lauter Lokalbriefe gewesen, deren Inhalt sich ausschließlich um die an diesem Orte herrschenden Verhältnisse drehen und für meine Studien von viel größerem Interesse sein würde als Folianten, die aus einer anderen Gegend stammten. —
Nach meiner Rückkehr nach Europa übergab ich dieses ganze Material dem gelehrten Sinologen Karl Himly in Wiesbaden, der es jetzt in Arbeit hat und seinerzeit eine besondere Abhandlung darüber veröffentlichen wird. Er machte schon bei der ersten Durchsicht mehrere interessante Entdeckungen und schrieb mir darüber unter anderem:
„Die vorhandenen Zeitangaben bewegen sich zwischen der Mitte des dritten und dem Anfange des vierten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Der Fundort scheint einem wohlhabenden chinesischen Kaufmanne gehört zu haben, der allerlei Lieferungen besorgt, Wagen und Lasttiere vermietet und die Beförderung von Briefen nach Tun-huang (Scha-tschôu) und dergleichen übernommen hat. Zu den Reisen nach dieser Stadt wurden Pferde, Wagen und Rinder benutzt. Einmal scheint von einem Feldzug die Rede zu sein, doch ohne Angabe der Zeit. Unter den Ortsnamen finden wir[S. 48] auch den, der das Land, um das es sich hier handelt, bezeichnet hat: Lôu-lan. Die Bewohner müssen auch Ackerbau getrieben haben, denn in den Briefen ist sehr oft die Rede von Getreidemaßen, wobei auch zuweilen die Getreideart angegeben ist. Vielleicht hat an der Stelle, wo die Schriftstücke ausgegraben worden sind, ein altes Steuereinnehmerhaus oder eine Art Getreidebank, wo Korn aufgekauft oder als Pfand angenommen worden ist, gestanden. Eigentümlich ist das Papier, das manchmal auf beiden Seiten beschrieben ist, was jetzt in China weder beim Schreiben noch im Druck üblich ist.
„Jedenfalls ist die mitgebrachte Sammlung, die auch für die Chinesen von großem Interesse ist, derart, daß sie noch lange das Interesse der Männer der Wissenschaft in Anspruch nehmen wird.
„Einige Blätter enthalten nur Schreibübungen, andere sind abgebrochene Sätze, aber die Abweichungen von der jetzigen Schrift sind im ganzen nicht groß. Die Stäbe haben den Vorteil vor den Papierblättern, daß sie einen oder mehrere Sätze, die abgeschlossen sind, enthalten, z. B., daß eine Antilope geliefert, so und soviel Korn abgegeben worden, so und soviele Menschen für einen Monat oder länger mit Lebensmitteln versorgt worden sind.
„Der Beamte, der hier residiert hat, scheint eine nicht unbedeutende Provinz verwaltet zu haben, was aus folgendem Satze zu schließen ist: «Von dem angelangten Kriegsheere sind 40 Beamte an der Grenze (oder dem Ufer?) zu empfangen, und die Höfe sind zahlreich.» Er scheint auch zwei eingeborene Fürsten neben sich gehabt zu haben.
„Die meisten Zeitangaben sind aus den Jahren 264–270 n. Chr. Im Jahre 265 starb Kaiser Yüan Ti aus dem Hause Wei, und im Norden folgte die Tsin-Herrschaft unter Wu-Ti, der bis zum Jahre 290 regierte.
„Von den leserlichen Kupfermünzen sind die meisten sogenannte Wu-tschu-Stücke. Diese Prägung war während der Periode von 118 v. Chr. bis 581 n. Chr. in Gebrauch. Ferner sind darunter zahlreiche Huo-thsüan-Münzen, die auf Wang-Mang zurückgehen, der zwischen den Jahren 9 und 23 n. Chr. die Macht in Händen hatte. Die Bezeichnungen der gefundenen Münzen widersprechen also den Zeitangaben der Papierfetzen und Stäbe nicht.“
Schon diese vorläufigen Mitteilungen zeigen, welch wichtige Aufklärungen man von der von mir mitgebrachten Sammlung erwarten kann. Sie bringen ein neues Licht in die politische und physische Geographie des innersten Asien während der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt und zeigen, welch ungeheure Veränderungen dieser Teil der Welt in 1600 Jahren erlitten hat.
[S. 49]
Der Name Lôu-lan kommt bei dem im 12. Jahrhundert lebenden arabischen Geographen Idrisi vor, und ein gelehrter Mandarin in Kaschgar, dem ich die Manuskripte zeigte, sagte mir, daß das Land um das jetzige Pitschan bei Turfan in alten Zeiten Lôu-lan geheißen habe. Im Verein mit den physikalisch-geographischen Untersuchungen, die ich in bezug auf die Wanderungen des Lop-nor-Sees ausführte, sind diese historischen Daten von unschätzbarem Wert. Sie geben nicht nur über das Land Lôu-lan am Nordufer des früheren Lopsees Auskunft, sondern verbreiten auch Licht über viele andere ungelöste Probleme in dieser Gegend, die auf halbem Wege zwischen China und dem Abendland liegt. Sie erzählen von regelmäßiger Post zwischen dem Lop-nor und Scha-tschôu, also von einer regelrechten Verbindungsstraße durch die Wüste Gobi. Der alte Weg von Korla längs des Ufers des Kontsche-darja, wo ich das vorige Mal eine ganze Reihe von Lehmtürmen (Pao-tai) und Festungen fand, erhält jetzt eine ganz andere Beleuchtung. Ich habe im ersten Bande S. 205–207 von den Ruinen in Jing-pen gesprochen — auch sie waren ganz gewiß eine wichtige Station auf dem alten Wege.
Daß in Lôu-lan Ackerbau hat getrieben werden können, ist von großem Interesse. Wie ist dies möglich gewesen? Vom Kurruk-tag kommt kein Bach, vom Himmel kein Tropfen Wasser. Das Klima wird sich verändert haben, sagt vielleicht jemand. Nein, durchaus nicht! Im Herzen eines Kontinents pflegt das Klima in anderthalb Jahrtausenden nicht solch kolossale Veränderungen zu erleiden. Kanäle müssen vom Flusse, dem Tarim oder Kum-darja, abgeleitet worden sein, Bewässerungskanäle von derselben Art wie überall in Ostturkestan. Getreidebanken gibt es noch jetzt in allen Städten Ostturkestans; sie stehen unter der Kontrolle der chinesischen Behörden und dienen zur gleichmäßigen Verteilung des Brotes unter die Eingeborenen. Ich fand allerdings nur 4 Dörfer, von denen das größte 19 Häuser hatte, aber es können noch mehr Ruinen in der Wüste liegen. Und wenn von Kriegsheeren, 40 Beamten und zahlreichen Höfen die Rede ist, hat man Grund, anzunehmen, daß Lôu-lan reich bevölkert gewesen ist. Die von uns gefundenen Ruinen würden dann von Amtslokalen und vornehmeren Wohnungen herrühren, und es ist ja auch wahrscheinlich, daß diese bei den Türmen gelegen haben, während die Hütten der Fischerbevölkerung an den Ufern lagen und natürlich in viel kürzerer Zeit zerstört worden sind.
9. März. Noch ein Tag blieb uns an diesem, ich hätte beinahe gesagt, heiligen alten Orte — jedenfalls einem Ort, an dem man von feierlicher Schwermut über die Vergänglichkeit alles Irdischen erfüllt wird und vor der Tatsache steht, daß Städte und Stämme von der Zeit wie Spreu vor dem Winde vom Erdboden verweht werden.
[S. 50]
Als ich aufstand, waren die Leute schon ein paar Stunden bei der Arbeit gewesen und brachten nun ihre Funde in meine Jurte (Abb. 214). Diese bestanden wie gestern aus Papierfetzen und Holzstäben, alle aus dem nordöstlichen Stande des Lehmhauses; in den beiden anderen wurde nichts gefunden. Fischgräten, Skeletteile von Haustieren, unter anderen von Schweinen, Lumpen, einige Pinselstiele, eine Peitsche, das Skelett einer Ratte und diverse andere Raritäten kamen auch zum Vorschein. Ein völlig unbeschädigter roter Tonkrug wurde ausgegraben (Abb. 215). Er war 70 Zentimeter hoch und 65 Zentimeter breit und besaß keine Henkel. Wahrscheinlich ist er in einem Weidenkorbe mit Henkel, der in der Nähe lag, getragen worden. Scherben von derartigen Gefäßen sind außerordentlich häufig.
Nachmittags kam die Karawane von der Quelle. Die Pferde sahen kümmerlich aus, aber die Kamele waren fett geworden. Sie trugen 10 Tagare und 11 Tulume Eis, welcher Vorrat ziemlich lange reichen würde.
[S. 51]
Da ich annehme, daß es meine Leser interessieren wird, einige Auskunft über das Land, das obigen Namen trägt, zu erhalten und zu erfahren, was bisher durch chinesische Quellen darüber bekannt war, so will ich im Anschluß an meine Entdeckungen einige von fachkundigster Seite herrührende Mitteilungen anführen. Es sind meine Freunde die Sinologen Karl Himly in Wiesbaden und George Macartney in Kaschgar, die zu Worte kommen, und zwar in den beiden vornehmsten geographischen Zeitschriften der Welt.
Himly hat in „Petermanns Mitteilungen“ (1902, Heft XII) einen Aufsatz, betitelt „Sven Hedins Ausgrabungen am alten Lop-nur“ veröffentlicht, worin er das von mir mitgebrachte Material vorläufig analysiert und daraus mehrere interessante Schlüsse zieht. Er schreibt:
„Der Name Lop-nur ist nicht von den jetzigen (türkischen) Bewohnern erfunden, wie ja auch «nur» = See ein mongolisches Wort ist. Vor Mitte des 18. Jahrhunderts verlief hier die Grenze der Khalkha- und der Westmongolen oder Kalmücken. Von den Chinesen wird jetzt nach Hedins Erkundung das Gebiet des neugegründeten Ortes Dural so genannt, wo ein chinesischer «Amban» seinen Sitz hat. Nach den Ausführungen in Petermanns Ergänzungsheft betrachtete Hedin den etwas weiter südöstlich befindlichen Kara-köl als Überbleibsel des alten Sees. Dieser war aber längst vor der Mongolenzeit den Chinesen bekannt gewesen und hatte verschiedene teils chinesische, teils einheimische Namen: Yen-tsö (chinesisch «Salzsee»), Puthschang-hai («hai» chinesisch = Meer), Yao-tsö, Lôu-lan-hai usw.; Lôu-lan aber war der Name eines Landes, welches trotz seiner Kleinheit wegen seiner Lage zwischen dem nördlichen und dem südlichen Weg von China nach dem Westen schon zur Zeit der Kämpfe zwischen den chinesischen Kaisern aus dem Haus der Han und den Hiung-Nu seit dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine für dasselbe zuweilen verhängnisvolle Rolle gespielt hat, indem es bald auf die eine, bald auf die andere Seite gedrängt wurde. Der berühmte Wallfahrer Hüan-Tschuang berührte 645[S. 52] das Land auf seiner Rückreise aus Indien, nachdem er von Khoten aus die Wüste mit ihren damals schon in Trümmern liegenden Städten durchzogen hatte. Wenn schon die Wüste die Einwohner der Städte vertrieb und ihre Häuser verschüttete, mußte eine Vereinigung der Staubstürme mit den sich stauenden Gewässern die Gefahr noch vermehren. Nach dem Schuêiking-tschu sammelten sich die Gewässer des Sees nordöstlich von Schan-schan (Lôu-lan) und südwestlich von Lung-thschöng (Drachenstadt), welches im Zeitraum Tschi-ta (1308–11) durch eine Sturmflut zerstört wurde. Doch waren die Trümmer noch vorhanden.
„Vielleicht ist es nun diese alte Trümmerstätte, welche Hedin während seines letzten Aufenthalts in der Gegend des Lop-nur aufgefunden hat. Er begab sich nämlich, von einigen einheimischen Türken — Lopliks, die jedoch noch nie dort gewesen waren — und einem seiner Kosaken begleitet, von der Quelle Altimisch-bulak nach Süden und traf nach zwei kleinen Tagereisen in einer Entfernung von 81½ Kilometer vom Kara-koschun auf die Trümmer einer alten Stadt. Während von den meisten Häusern nur noch die Holzgerüste standen, war eines aus Lehm (oder Luftsteinen?) gebaut mit dicken Außen- und zwei Innenwänden, welche das Haus in drei Räume, einen breiteren mittleren und zwei kleinere an den Seiten teilten. In einem der letzteren wurden eine Menge Stäbe aus Tamariskenholz mit meist chinesischen Schriften und viele Papierfetzen, letztere teilweise auf einer, teilweise entgegen der jetzigen Sitte auf beiden Seiten beschrieben, unter einer Sand- (oder Löß-?)Schicht von höchstens zwei Fuß Dicke aufgefunden. Es befanden sich darunter auch kleine Klötzchen, welche gleichfalls beschrieben waren und meist augenscheinlich zum Zubinden bestimmte Vertiefungen zeigten. Daß diese Klötzchen als Deckel für darunter befindliche Briefschaften gedient hatten, war teils aus der Aufschrift zu entnehmen, teils hatten schon die im Januar 1901 von Stein am Niya-Flusse gemachten Funde an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriggelassen, wie man sich beim ersten Blick auf Tafel IX in seinem «Preliminary report on a journey of archaeological and topographical exploration in Chinese Turkestan» überzeugen kann. Unweit dieser Fundstelle fanden sich sehr wertvolle Holzschnitzereien mit geschmackvollen Verzierungen; die darunter vorkommenden Buddhabilder lassen auf das Vorhandensein eines Tempels schließen. In einem anderen Hause fanden sich Fischknochen in großer Menge, und unzählige Schnecken (Limnaea) lagen umher. Läßt dieser Umstand darauf schließen, daß hier das Ufer eines Sees war, so zeugte ein riesengroßes, aus fünf dicken Brettern bestehendes Rad vom Wagenverkehr zu Land. Die vier Türme aus Fachwerk, welche sich in der Umgebung fanden, mögen teils zur Verteidigung, teils am Weg als Feuer- oder Rauchtürme gedient[S. 53] haben, wie sie weit über das chinesische Reich zerstreut lagen, um vor dem herannahenden Feind zu warnen. Ein riesiger Wasserbehälter von rotem Ton, oben mit schmaler Öffnung versehen, hatte sich vollkommen erhalten.
„Unter den kleineren Fundstücken sind namentlich die Kupfermünzen bemerkenswert, die, bis auf eine chinesischen Ursprungs, auf eine bestimmte Reihe von Jahrhunderten hinweisen. Sie haben alle das bekannte viereckige Loch in der Mitte, an dem sie, zu Hunderten aufgereiht, an Stricken getragen zu werden pflegen. Die Bezeichnungen einer bestimmten Reihe von Jahren, welche frühestens im Jahre 376 n. Chr. begannen und vom Jahre 621 an nie mehr fehlten, finden sich auf keiner der Münzen. Die häufigste Aufschrift ist Wu tschu (5 Tschu oder 5/24 Liang oder Unzen) in alter Siegelschrift, in der die 5 einer römischen Zehn (X) ähnelt, und kommt von 118 v. Chr. bis 581 n. Chr. vor. Zuweilen haben die Münzen die Bezeichnung Huo-thsüan (nach Endlichers Übersetzung «Tauschmittel»), welche von 9–22 n. Chr. aus der Zeit des Wang-Mang angeführt wird. Eine Münze, in der das Loch ein längliches Viereck bildet, trägt die Aufschrift in Schriftzeichen, deren Erklärung der Zukunft vorbehalten werden muß.
Unter den anderen kleineren Gegenständen ist namentlich ein kleiner geschnittener Stein bemerkenswert, welcher den in Hedins Werk «Durch Asiens Wüsten» (erste Auflage, II, 33) abgebildeten «Gemmen aus Borasan» an die Seite zu stellen ist. Es heißt dort (II, S. 35) von der Fundstätte westlich von Khoten, die dortigen «Überreste einer hochentwickelten Kunstindustrie» beständen aus «kleinen Terracottagegenständen, Buddhabildern aus Bronze, Gemmen, Münzen usw., für den Archäologen von größter Bedeutung, da sie bewiesen, daß die durch griechischen Einfluß veredelte antike indische Kunst bis ins Herz von Asien gedrungen wäre». Hier nun handelt es sich augenscheinlich um einen Hermes, der als Gott der Wanderer seinen Weg durch Baktrien nach dem Innern von Asien gemacht hat. Kunstvolle dreikantige Pfeile oder flache kleinere, etwa für Geflügel bestimmte, beide von Bronze, Wirtel, ein mit Perlen usw. geschmückter Ohrring, Kupferdraht, eiserne Nägel, mit einem scharfen Gegenstand oben geöffnete Kaurimuscheln, Schellen (für die Pferde?) von Kupfer- und Messingblech, Bruchstücke von Glöckchen aus Bronze, Bernstein und Perlen aus solchem, kupferne Ringe, allerlei Gerät oder Bruchstücke davon aus verschiedenartigen Steinen oder Halbedelsteinen, worunter Nierstein (Nephrit) und Alabaster, verziertem grünem Glas usw., geben Kunde von der Bildungsstufe, auf welcher entweder der einheimische Gewerbefleiß stand, oder von dem Sinn, welchen man für die Erzeugnisse des fremden hatte.
„Hinsichtlich der Frage, um welchen Zeitraum es sich bei der Zerstörung des Ortes handeln dürfte und wie derselbe, d. h. die Stadt oder[S. 54] das Land, geheißen haben, sprechen die aufgefundenen Schriftstücke eine deutlichere Sprache. Sowohl auf den Stäben als auf den alten Papierfetzen kommt der Name Lôulan vor und zwar in einem Zusammenhang, der keinen Zweifel läßt, daß so der Ort der Bestimmung oder Aufbewahrung hieß. So stehen auf dem oberen Teile eines der Stäbe Angaben über nach Tun-Huang und Tsiu-Thsüan (Su-tschôu) abgesandte Briefe; auf dem unteren Teile ist der 15. Tag des 3. Monats im 6. Jahre des Zeitraums Thai-Schi, d. h. des 6. Jahres des Kaisers Tsin Wu Ti (270 n. Chr.) angegeben als Tag der Ankunft eines Briefes in Lôulan. Auf einem der Deckelklötzchen, welches die auf Tafel IX von Steins «Preliminary report» angegebene Gestalt hat, nur viel kleiner ist, finden sich der Fürst der See-Angelegenheiten und Frau (Tien-schi Wang Hou) in Lôulan als Empfänger angegeben. Die erste Zeitangabe ist vom Jahre 264, in welchem das Haus Wei das nördlichste der «drei Reiche» noch unter seiner Herrschaft hatte. Sonst finden sich noch die Jahre 266, 268, 269 und 270 angegeben, während sich unter den meist anscheinend mit Willen zerfetzten Papieren der Name Lôulan zweimal, wovon einmal aus einer geringfügigen Veranlassung des Inhalts, daß ein gewisser Ma aus Lôulan am 6. des 6. Monats nicht vorzusprechen brauche, und die Jahreszahl 310 in Verbindung mit der Stadt An-Si finden.
„Der Inhalt der verschiedenen schriftlichen Bemerkungen ist ein sehr verschiedenartiger. Es ist darin sonst noch von Getreidelieferungen, von Nachrichten aus Tun-Huang, Verkehr mit Kao-Tschang (dem alten Turfan), von gerichtlichen Verhandlungen usw. die Rede. Die Stäbe dienten augenscheinlich bald als Tagebücher, bald zu Mitteilungen oder Weisungen an Untergebene. Letzterer Art scheint ein abgebrochener kleinerer Stab gewesen zu sein mit der Mitteilung, daß von dem (pien? am Rand, an der Grenze, am Ufer?) angelangten Heer vierzig am Deich empfangene Anführer in den Gehöften Unterkunft finden könnten.
„Ein kleines Brettchen hat eine nicht chinesische Aufschrift, deren Schriftzeichen den Kharoshthi-Zeichen bei Stein (Taf. IX, X und XI bei Stein a. a. O.) ähneln, wie auch das Brettchen von zwei Deckeln von der auf Steins Tafel X veröffentlichten Art begleitet gewesen sein wird.
„Es ist nach dem allem kaum zu bezweifeln, daß hier das alte Lôulan war und am alten Lop-nur lag. Diese alte Stadt scheint Anfang des vierten Jahrhunderts vom Wüstensturm oder von den Gewässern, bezw. durch beide Gewalten zerstört worden zu sein. Man wird in der Nähe eine andere, die sogenannte Drachenstadt, gebaut haben, welche dann ihrerseits in den Jahren 1308–11 durch eine Sturmflut zugrunde ging.“
[S. 55]
Mein alter Freund von all meinen Besuchen in Kaschgar, George Macartney, der ebenfalls ein gründlicher Kenner der chinesischen Sprache ist, hat in der Märznummer 1903 des „Geographical Journal“ folgenden Aufsatz erscheinen lassen, den ich hier mit seiner Erlaubnis in extenso mitteile. Einige der historischen Ereignisse, deren Schauplatz Lôu-lan gewesen, passieren hier Revue und zeigen, daß dieses Land einst eine gewisse Bedeutung gehabt hat. Im Verein mit den von Himly gegebenen Mitteilungen und Übersetzungen gibt uns Macartneys Aufsatz Gelegenheit, uns eine ziemlich deutliche Vorstellung von diesem zweitausendjährigen Königreich zu machen. Macartneys Artikel trägt den Titel. „Notices, from Chinese sources, on the ancient Kingdom of Lau-lan or Shen-shen“ (Nachrichten aus chinesischen Quellen über das alte Königreich Lôu-lan oder Schen-Schen) und lautet folgendermaßen:
„In dem Vortrag, den Dr. Sven Hedin in London am 8. Dezember 1902 vor der Königl. Geographischen Gesellschaft über seine dreijährigen Forschungen in Zentralasien hielt, gab er uns eine lebhafte Schilderung von den Ruinen einer alten Stadt am Ufer des alten Lob-nor. Unter den Funden, die er von dieser Örtlichkeit mitgebracht hat, finden wir eine Anzahl chinesischer Manuskripte, die als dem zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. angehörend identifiziert worden sind. Einige von diesen Manuskripten tragen nicht allein das Datum, sondern auch den Namen des Ortes, an welchem sie geschrieben worden sind. Dieser Name ist Lau-lan, und die Kenntnis dieser Tatsache ist von besonderem Interesse. Der Name Lau-lan selbst ist den modernen chinesischen Geographen wohlbekannt, aber bis jetzt sind offenbar weder sie noch Gelehrte in Europa imstande gewesen, mit einiger Genauigkeit die Lage des Landes, das einstmals diesen Namen getragen hat, zu bestimmen. Herr A. Wylie, ein hervorragender Chinaforscher, hatte diese Lage im Jahre 1880 seinen Berechnungen nach auf 39° 40′ nördl. Breite und 94° 50′ östl. Länge angenommen. Dies würde einen Fehler von ungefähr 250 engl. Meilen (etwa 420 Kilometer) bedeuten, wenn ich recht verstanden habe, daß der Platz, wo Dr. Hedin die den Namen Lau-lan tragenden chinesischen Manuskripte gefunden hat, ungefähr auf 40° 40′ nördl. Breite und 90° östl. Länge lag. [Diese Zahlen sind beinahe richtig. Hedin.] Eine genauere Feststellung der Lage von Lau-lan, die jetzt selbstverständlich möglich ist, kann, wie ich hoffe, hinsichtlich anderer benachbarter Länder, deren alte Namen bekannt sind, über deren Lage sich aber die heutigen Geographen noch die Köpfe zerbrechen, zu wertvollen Ergebnissen führen.
„Wenn wir die Geschichte der ersten Hankaiser, das Tsien-Han-shu [ich lasse die englische Schreibweise der chinesischen Namen unverändert.[S. 56] Hedin], und die Aufzeichnungen, welche Fa-Heen und Hsian-Tsang hinterlassen haben, studieren, finden wir viele Orte mit Entfernungen erwähnt, als deren Ausgangspunkt Lau-lan angegeben ist.
„So erwähnt das Tsien-Han-shu (geschrieben, in runden Zahlen, zwischen 100 v. Chr. und 50 n. Chr.) folgende Entfernungen: Von Wu-ni (Hauptstadt von Lau-lan) nach Yang-kuan, dem «südlichen Sperrtor», (augenscheinlich in der Richtung von Tun-huang) 1600 Li; nach Chang-an 6100 Li; nach dem Verwaltungssitze (der Name fehlt) des chinesischen Gouverneurs 1785 Li; nach Si-an-fu 1365 Li; nach Keu-sze (Ouigour) in nordwestlicher Richtung 1890 Li.
„In der Beschreibung seiner Reisen gibt Fa-Heen (im fünften Jahrhundert n. Chr.) folgende Entfernungen an: von Shen-shen oder Lau-lan nach Tun-huang, etwa 17 Tagemärsche, 1500 Li; nach Wu-e (Uigur?) 15 Tagereisen zu Fuß in nordwestlicher Richtung.
„Von Hsian-Tsang erfahren wir, daß Lau-lan, das er auch Na-po-po nennt, 1000 Li nordöstlich von Chem-to-na oder Nimo liegt.
„Aus dem Obigen ergibt sich auch, daß der Ort Lau-lan als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Lage mehrerer anderer Orte dienen kann. Vielleicht können die obigen Angaben späteren archäologischen Forschern von Nutzen sein.
„Dies ist aber noch lange nicht alles, was wir aus chinesischen Quellen über Lau-lan erfahren können. Das Tsien-Han-shu erzählt uns, daß China mit diesem Lande unter der Regierung des Kaisers Wu-ti (140–87 v. Chr.) in Verbindung zu treten begann, um welche Zeit sich die Westgrenze des Reiches nicht über das Yang-kuan-Sperrtor (vielleicht bis Tun-Huang) und das Yü-Tor (das moderne Chia Yu Kuan?) hinaus erstreckt zu haben scheint. Das ausgedehnte Land, das hinter diesen Orten lag, wurde von den damaligen chinesischen Geographen mit dem unbestimmten Namen Si-yu (die Westregion) bezeichnet und soll nach ihnen in 36 verschiedene Königreiche geteilt gewesen sein. Man erzählt, daß von China zwei Wege nach dieser Gegend führten. «Der über Lau-lan, welcher längs des Flusses Po (des unteren Tarim?) auf der Nordseite des südlichen Gebirges (des Altyn Ustun Tagh?) hinläuft und westwärts nach Sa-sche (Yarkand) führt, ist der südliche Weg. Der, welcher über den Palast des Häuptlings in Keu-tse (im Ouigourreiche? 1890 Li von Lau-lan) führt und den Fluß Po in der Richtung des nördlichen Gebirges (Tien Shan) bis nach Su-leh (Kaschgar) begleitet, ist der nördliche Weg.»

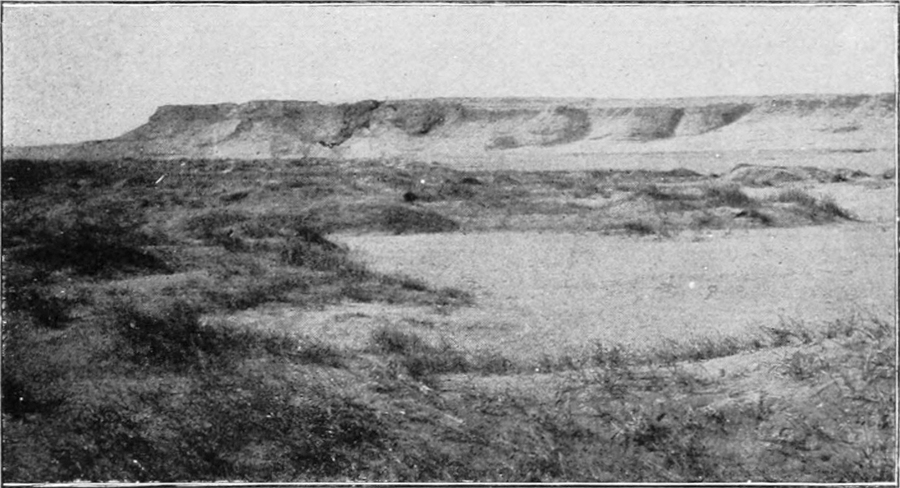

„Das Wassersystem des Tarimbeckens wird mit folgenden Worten beschrieben: «Der Fluß (Chotan-darja?) strömt nach Norden, bis er sich mit einem Flusse vom Tsung-ling (Zwiebelkette in Sarikol) vereinigt, und fließt[S. 57] dann nach Osten in den Pu-schang-hai (den Schilfsee), der auch der Salzsumpf genannt wird. Dieser liegt über 300 Li von dem Yü-Tore und dem Sperrtore Yang-kuan und ist 300 Li lang und breit. Das Wasser ist stationär und nimmt weder im Winter noch im Sommer ab oder zu. Der Fluß soll sodann unter der Erde weiterfließen und bei Tseih-shih wieder zutage treten, von wo an er den Gelben Fluß Chinas bildet.»
„Das Folgende ist ein Auszug des Berichtes, den wir in dem Tsien-Han-shu über die politischen Verhältnisse zwischen China und Lau-lan während des ersten Jahrhunderts vor Christi Geburt finden.
„Kaiser Wu-ti, heißt es, wünschte, mit Ta-wan und den umliegenden Ländern Verbindung zu unterhalten, und schickte wiederholt Gesandte dorthin. Der Weg derselben ging über Lau-lan, aber die Einwohner von Lau-lan beunruhigten im Verein mit dem Ku-tse-Volke die Reise der Beamten und griffen Wang-Kuei, einen der Gesandten, an und raubten ihn aus. Doch nicht genug damit, die Bewohner von Lau-lan machten sich den Chinesen auch dadurch verhaßt, daß sie den Heun-nu (Hunnen) als Spione dienten und diesen wiederholt bei der Ausplünderung chinesischer Reisender halfen. Dergleichen konnte nicht geduldet werden. Daher rüstete Wu-ti eine Expedition gegen den feindlich gesinnten Staat aus. Chao Po-nu wurde mit einem Heere von 10000 Mann ausgesandt, um das Ku-tse-Volk zu strafen, während der Gesandte Wang-Kuei, der wiederholt unter den Übergriffen der Lau-laner gelitten hatte, Befehl erhielt, Chao Po-nu als Unterfeldherr zu begleiten. An der Spitze von 700 Mann leichter Kavallerie vorrückend, nahm dieser den König von Lau-lan gefangen, eroberte Ku-tse und jagte, auf das Ansehen seines Kriegsheeres vertrauend, auch den Staaten, die Vasallen von Wu-sun und Ta-wan waren, Respekt ein. Die Lau-laner unterwarfen sich bald und schickten Tribut an Kaiser Wu-ti. Doch ihre Unterwerfung erboste ihre Bundesgenossen, die Hunnen, und es dauerte gar nicht lange, so wurden sie von diesen angegriffen. Daher schickte der König von Lau-lan, um seine beiden mächtigen Nachbarn zu besänftigen, einen seiner Söhne als Geisel zu den Hunnen und einen zweiten dem Kaiser von China. So endete die erste Episode der Beziehungen zwischen China und dem Königreiche von Lau-lan.
„Aber noch mehr Unruhen standen Lau-lan bevor. Kaiser Wu-ti mußte aus irgendeinem Grunde noch eine Strafexpedition gegen Ta-wan und die Hunnen schicken. Die Hunnen fanden das chinesische Heer so furchtbar, daß sie es für das Klügste hielten, jeden direkten Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden, was sie aber nicht hinderte, in Lau-lan, dessen Bewohner noch immer mit ihnen im Bunde standen, Truppen in Hinterhalte zu legen. Diese Truppen beunruhigten Wu-tis Armee unaufhörlich. Die[S. 58] Chinesen kamen bald dahinter, daß die Lau-laner im geheimen Bundesgenossen der Hunnen waren, und infolgedessen wurde General Jen-wan ausgesandt, um sie zu züchtigen. Jen-wan drang bis an das Stadttor vor, welches ihm geöffnet wurde, und machte dem König Vorwürfe über seine Verräterei. Der König antwortete entschuldigend: «Wenn ein kleiner Staat zwischen zwei großen Reichen liegt, zwingt ihn die Notwendigkeit, mit beiden im Bunde zu stehen, sonst hat er nie Frieden; jetzt aber wünsche ich, mein Königreich den Grenzen des chinesischen Reiches einzuverleiben.» Diesen Worten vertrauend, setzte ihn der Kaiser wieder auf den Thron und beauftragte ihn, ein wachsames Auge auf die Bewegungen der Hunnen zu haben.
„Der König starb im Jahre 92 v. Chr. Eine Thronfolgefrage entstand. Man wird sich erinnern, daß einer der Söhne des verstorbenen Königs sich als Geisel am chinesischen Hofe befand. Nun schickten die Lau-laner eine Petition an den Kaiser, er möge ihnen den als Geisel gesandten Prinzen wiederschicken, damit dieser den ledigen Thron besteige. Der Prinz hatte sich jedoch nicht der Gunst des Kaisers erfreut; er war tatsächlich die ganze Zeit, die er in China weilte, im Palaste des Seidenwurmhauses in einer seinem Range entsprechenden Haft gefangen gehalten worden. Daher fand die Petition bei Wu-ti kein williges Ohr, sondern er gab die diplomatische Antwort: «Ich liebe den Prinzen, meinen Gast, sehr und bin nicht gesonnen, ihn von meiner Seite zu lassen.» Der Kaiser schlug dann den Bittstellern vor, sie sollten den nächsten Sohn des toten Königs mit der Königswürde bekleiden.
„Das taten die Lau-laner auch. Aber der neue König regierte nur kurze Zeit, und als er starb, wurde die Nachfolgerfrage wieder brennend. Diesmal dachten die Hunnen, die, wie wir wissen, auch einen Lau-lan-Prinzen als Geisel an ihrem Hofe hatten, daß dies eine passende Gelegenheit sei, ihren verlorenen Einfluß auf diesen Staat wiederzuerlangen. Deshalb schickten sie den Prinzen zurück und setzten ihn auf den Thron. Dieser gelungene Handstreich beunruhigte die Chinesen, die ihren Einfluß durch Bestechungen und Intrigen wiederzugewinnen suchten. Sie machten keinen direkten Versuch, den Schützling der Hunnen zu entthronen, schickten aber an ihn einen Gesandten, der ihn aufforderte, dem chinesischen Hofe einen Besuch abzustatten, wo ihm, wie der Gesandte sagte, der Kaiser reiche Geschenke machen würde. Der Kaiser und der Gesandte konnten jedoch nicht ahnen, daß sie hier auch mit der Verschlagenheit einer Frau zu rechnen hatten. Die Stiefmutter des Königs war dort und riet ihm, indem sie sagte: “«Dein königlicher Vorgänger sandte zwei Söhne als Geiseln nach China; keiner von ihnen ist je zurückgekehrt; ist es da billig, daß du gehen[S. 59] sollst?» Daher verabschiedete der König den Gesandten mit dem Bescheid, daß «die Angelegenheiten des Reiches ihn, da er den Thron erst eben bestiegen habe, noch derartig in Anspruch nähmen, daß er den chinesischen Hof nicht eher als in zwei Jahren besuchen könne».
„Obgleich das Verhältnis zwischen dem neuen König und dem Kaiser ohne Zweifel gespannt war, war es noch nicht zu offenen Feindseligkeiten zwischen ihnen gekommen. Nun aber kam das Ereignis, welches der Unabhängigkeit des Staates Lau-lan ein Ende machen sollte. Am Ostrande von Lau-lan, wo dieses Land an China grenzte, scheint eine Örtlichkeit, der Peh-lung-Wall genannt, gelegen zu haben. Dieser Platz lag auf der großen Heerstraße von China über Lau-lan nach den westlichen Ländern; er litt an Dürre und hatte keine Weiden. Die Lau-laner wurden oft von den Chinesen aufgefordert, Führer, Wasser und Proviant nach diesem Platze zu schicken, wenn durchreisende Beamte dessen bedurften. Hierbei wurden die Ortseinwohner oft von chinesischen Soldaten brutal behandelt. Dadurch entstanden Reibungen; aber die Lage wurde noch verschlimmert durch die Hunnen, welche die Lau-laner immer im geheimen gegen die Chinesen aufhetzten. Schließlich beschlossen die Lau-laner, alle freundschaftlichen Beziehungen zu Wu-ti abzubrechen, und ermordeten einige seiner Gesandten, als diese durch das Gebiet von Lau-lan reisten. Diese Verräterei wurde dem chinesischen Hofe durch Hui Tu-chi, den jüngeren Bruder des Königs, hinterbracht, welcher, nachdem er sich unter die Oberhoheit des Han-Kaisers gestellt hatte, mit dem Plane umging, seinen älteren Bruder vom Throne zu stoßen. Infolgedessen wurde im Jahre 77 v. Chr. der chinesische General Fu-keae-tsu ausgeschickt, um dem König das Leben zu nehmen. Fu-keae-tsu wählte sich schleunigst einige Begleiter aus und begab sich nach Lau-lan. Er hatte vorher das Gerücht verbreiten lassen, daß er beauftragt sei, zu freundschaftlichen Untersuchungen nach einem Nachbarstaate zu reisen, und daß er dem König Geschenke zu überbringen habe. Fu-keae-tsu wurde bei seiner Ankunft von dem König, der nichts Böses ahnte, zu einem großartigen Feste eingeladen. Als der König betrunken war, gab Fu seinen Begleitern ein Zeichen, und nun wurde der König von hinten erstochen. Sein Kopf wurde vom Leibe getrennt und über dem Nordtore der Stadt aufgehängt. Zur Belohnung für seinen Verrat wurde Hui Tu-chi an Stelle seines Bruders zum König eingesetzt und das Königreich unter dem neuen Namen Shen-Shen, auf den der Lehnsbrief ausgefertigt wurde, wiederhergestellt. Damit dem Ansehen des neuen Regenten nichts mangeln sollte, erhielt er eine Dame des kaiserlichen Hofes zur Gemahlin, und als Hui Tu-chi die chinesische Hauptstadt verließ, um sich in sein Reich zu begeben, wurden ihm beim Abschied reiche Ehrenbezeigungen erwiesen. Auf[S. 60] diese Weise gelangte er auf den Thron. Doch er fühlte sich in seiner neuen Stellung nicht sicher. Weil er ein chinesischer Schützling war, betrachtete ihn das Volk, über welches er herrschen sollte, mit Mißtrauen. Außerdem hatte der tote König einen Sohn hinterlassen, und Hui Tu-chi lebte in beständiger Furcht, von diesem ermordet zu werden. Daher forderte Hui Tu-chi den Kaiser auf, in Lau-lan eine Militärkolonie zu errichten, und zwar in der Stadt E-tun, wo das Land, wie er sagte, «reich war und guten Ertrag gab». Dies geschah, und der Kaiser schickte einen Reiterobersten mit 40 Mann nach E-tun, um «die Felder zu bestellen und das Volk zu beruhigen». So gelang es dem großen Han-Monarchen, seine Macht über das Land Lau-lan oder Shen-shen zu erstrecken.
„Um die Zeit, als diese Chroniken geschrieben wurden, was wahrscheinlich um Christi Geburt herum geschah, zählte, wie uns berichtet wird, das Königreich Shen-shen 1570 Familien, was neben 2912 Mann geübten Truppen eine Bevölkerung von 14100 Personen ausmachte.
„Hinsichtlich der physischen Charakterzüge des Landes sagt das Tsien-Han-shu (von Herrn A. Wylie ins Englische übersetzt):
„«Das Land ist sandig und salzig, und es gibt dort wenig angebaute Felder. In betreff des Getreides und der Ackerbauerzeugnisse ist die Gegend auf die benachbarten Reiche angewiesen. Das Land bringt Nephrit, Binsen in Menge, Tamarisken, Elaecocca vernicia und weißes Gras hervor. Die Bevölkerung treibt ihr Vieh überall auf die Weide, wo es genügend Wasser und Gras finden kann. Die Leute besitzen Esel, Pferde und Kamele. Sie können für Kriegsbedarf dieselbe Art Waffen anfertigen wie die Leute in Tso-kiang.»
„Soweit gehen also die in dem Tsien-Han-shu enthaltenen Nachrichten. Hören wir, was Fa-Heen von Lau-lan sagt, durch welches Land er im fünften Jahrhundert n. Chr. reiste, als er sich von China nach Indien begab, um sich die heiligen Bücher des Buddhismus zu verschaffen. Die englische Übersetzung ist von Dr. J. Legge.
„«Nachdem sie 17 Tage gereist waren, welche Entfernung wir auf etwa 1500 Li (von Tun-huang) schätzen können, erreichten die Pilger das Königreich Shen-shen, ein kupiertes, hügeliges Land mit magerem, unfruchtbarem Boden. Die Kleidungsstücke der gewöhnlichen Leute sind einfach und gleichen den in unserem Lande Han gewebten; einige tragen Filz und andere Serge oder härene Stoffe. Der König gehorchte unserem Gesetze, und in dem Königreiche gibt es wohl mehr als 4000 Mönche, die alle das Hinayana (das kleine Erlösungsmittel) studieren. Die breiteren Schichten der Bevölkerung dieses und anderer Königreiche in dieser Gegend, wie auch die Sramanen (Mönche) leben alle auf indische Weise, diese jedoch strenger, jene[S. 61] etwas freier. Hier hielten sich die Pilger ungefähr einen Monat auf und setzten dann ihre Reise fort, worauf sie ein fünfzehntägiger Marsch nach Nordwesten nach dem Lande Wu-e führte. Hier gab es über 4000 Mönche, die alle das Hinayana studierten.»“
„Hsian-Tsang (629–645 n. Chr.) passierte zweihundert Jahre nach Fa-Heen auf der Rückreise von Indien Lau-lan, aber seine Nachrichten von dem Lande sind außerordentlich dürftig. Wir erfahren nur, daß er, nachdem er die mit Mauern umgebene, aber verlassene Stadt Tsche-mo-to-na oder Nimo verlassen hatte, 1000 Li in nordöstlicher Richtung reiste und Na-po-po erreichte, welches dasselbe ist wie Lau-lan.“
Aus diesen von Macartney zusammengestellten Angaben ersehen wir, daß Lôu-lan seinerzeit eine gewisse Bedeutung hatte. Wahrscheinlich würde man durch fortgesetzte Ausgrabungen noch reichere Funde machen können als die, von denen ich kurz berichtet habe.
[S. 62]
Am 10. März frühmorgens wurde es im Lager unruhig; wir wollten von unserer festen Operationsbasis aufbrechen und die stille Stadt wieder ihrer tausendjährigen Ruhe überlassen. Wird je wieder ein abendländischer Pilger in den Mauern von Lôu-lan zu Gaste sein?
Drei Eissäcke wurden den Kamelen geopfert, die kauen durften, soviel sie wollten; die Last war auf jeden Fall zu schwer. Die eingeheimste Ernte an Schnitzereien und anderen Dingen wurde zu Packen gebunden und das Gepäck geordnet. Die Karawane sollte hier in zwei Partien geteilt werden. Ich wollte südwärts gehen, um ein Präzisionsnivellement durch die Wüste nach dem Kara-koschun auszuführen. Als Begleiter hatte ich Schagdur, Kutschuk, Chodai Kullu und Chodai Värdi ausersehen. Wir brauchten nur vier Kamele, eines für das Gepäck und drei für Eis (Abb. 216). Ich nahm nur das Unentbehrlichste an Proviant und Kleidern, Instrumente, alles zum Nivellieren Nötige, die halbe Jurte und das halbe Bett mit; die Leute konnten unter freiem Himmel schlafen. Die Frühlingswärme war bereits so stark, daß der Ofen überflüssig war. Der Proviant wog nicht viel. Das Wenige, was noch an Reis und Brot da war, wurde in für acht Tage berechnete Rationen geteilt.
Der übrige Teil der Karawane, Faisullah, Li Loje und Mollah, sechs Kamele, drei Pferde, die drei Hunde und das ganze schwerere Gepäck nebst Eis und Proviant für vier Tage sollten allein weiterziehen.
Faisullah, der im vorigen Jahre die Wüstendurchquerung von Altimisch-bulak an mitgemacht hatte, mußte nach Kum-tschappgan, wo wir uns wieder treffen wollten, hinfinden können. Er hatte Befehl, sich direkt dorthin zu begeben und dort auf unsere Ankunft zu warten. Der Sicherheit halber erhielt er gründlichen Unterricht, wie er sich vom Kompaß nach Südwesten führen lassen müsse. Ich war von Faisullahs Klugheit und Vorsicht überzeugt, hielt es aber doch für besser, alle Kartenblätter von dieser Reise, die Manuskripte und Stäbe aus Lôu-lan, meine Notizbücher[S. 63] und die Beobachtungsjournale selbst mitzunehmen. Obgleich Faisullah, wie wir noch hören werden, ein höchst unerwartetes Abenteuer hatte, wären die kostbaren Papiere bei ihm doch sicherer gewesen als bei mir, wie sich noch zeigen wird!
Während die beiden Karawanen beladen wurden, brach ich auf. Faisullah und seine beiden Kameraden halfen Chodai Värdi, der Befehl hatte, uns mit unseren vier Kamelen nachzukommen und sich am Abend bereitzuhalten, das Lager aufzuschlagen.
Zum Ausgangspunkte des Nivellements wählte ich den Platz an der Basis des Turmes, wo meine Jurte gestanden hatte. Hier wurde die 4 Meter hohe Nivellierlatte zum ersten Male aufgerichtet. Sie wurde stets auf eine Platte gestellt, um nicht einzusinken, wenn sie halb umgedreht wurde. Schagdur handhabte sie während der ganzen Wanderung auf mustergültige Weise. Das Fernrohr wurde 100 Meter südlich von ihr aufgestellt, und ich machte meine erste Ablesung, worauf Schagdur am Fernrohr vorbeiging und die Latte zum zweiten Male 100 Meter südlich davon aufstellte — und so weiter, Tag für Tag, bis an den Kara-koschun, wohin wir 81½ Kilometer hatten!
Der Abstand zwischen Fernrohr und Stange wurde von Kutschuk und Chodai Kullu mit einem 50 Meter langen Bandmaße gemessen, das also jedesmal zweimal auf der Erde abrollte. Das Fernrohr mit seinem Stativ wurde beim Weitergehen von Kutschuk getragen. Ich selbst hatte die Ablesungen, Kompaßpeilungen, Marschroute und Aufzeichnungen über den Charakter des Terrains zu machen.
Bevor die Leute an diese für sie neue Arbeit gewöhnt waren, kamen wir nur langsam weiter; aber nicht lange dauerte es, so ging alles seinen regelrechten Gang, und es gab keine unnötigen Verzögerungen mehr.
In dieser Richtung, von Lôu-lan nach Süden, war es sehr deutlich zu merken, daß wir die Uferlinie des früheren Sees passierten. Die toten Bäume, Sträucher und Schilfstoppeln hörten mit einem Schlag auf, und nun waren wir auf ödem, graugelbem Lehmboden ohne alle Vegetation, wo wir uns ohne Zweifel auf einem alten Seeboden befanden.
Einundneunzigmal waren die Stange und das Fernrohr vorgerückt, bevor wir es, nach einem Marsche von 9140 Meter, an der Zeit hielten zu lagern. Es fing an dämmerig zu werden. Aber Chodai Värdi mit den vier Kamelen war nicht zu erblicken. Wir spähten von Hügeln und Kegeln nach ihm aus, doch der Mann war spurlos verschwunden. Hatte er sich verirrt? Hatte er mich mißverstanden und Faisullah begleitet oder war er bei den Ruinen geblieben?
[S. 64]
An einem Punkte, wo wieder dürres Holz auftrat, zündeten wir auf einem Hügel ein großes Signalfeuer an. Schagdur begab sich trotz der Dunkelheit auf die Suche. Ich war in größter Unruhe. Wenn Chodai Värdi sich verirrt hatte, war er verloren. Er war noch nie in der Gegend gewesen und hatte keine Ahnung, wohin er gehen mußte, um nach dem Kara-koschun zu gelangen. Und fanden wir ihn nicht wieder, so würde natürlich auch unsere Lage — ohne Wasser und ohne Nahrung — kritisch sein; es war bis an den See noch so weit, daß unsere Kräfte schwerlich so weit reichen konnten, und nach der isolierten Quelle zurückzukehren, wäre ebenso verzweifelt gewesen. Doch am meisten von allem quälte mich der Gedanke: sollten alle Resultate einer viermonatigen Wanderung nur durch die Dummheit eines Dieners verlorengehen?
Wir zerbrachen uns den Kopf und lauschten und stapelten alles, was Holz hieß, auf das Feuer, das hoch und wild in der sonst undurchdringlichen Dunkelheit flammte. Kein Laut war zu hören. Die Wüste lag so tot und öde da, als gehörte sie nicht einem von Menschen bewohnten Planeten an. Statt uns nach der anstrengenden Arbeit und Fußwanderung des Tages an Wasser laben können, hielt uns nun diese unheimliche, düstere Unruhe gepackt. Es bedurfte jetzt nur noch eines Nebelsturmes — dann wäre alles verloren gewesen!
So schlimm sollte es nicht werden. Im nächtlichen Dunkel ertönten tappende Schritte: Chodai Värdi kam mit den Kamelen wohlbehalten an! Ich war froh, nichts eingebüßt zu haben, so daß ich ganz vergaß, ihm seine wohlverdiente Schelte zukommen zu lassen. Er erklärte, daß er durch die Form der Lehmterrassen gezwungen worden sei, sich zu weit nach rechts zu halten, und nachher weder uns noch eine Spur habe wiederfinden können. Als er abends im Südwesten ein Feuer gesehen habe, sei ihm endlich klar geworden, daß er sich auf Irrwegen befinde — dies war nämlich Faisullahs Feuer. Er sei also umgekehrt und habe schon aus sehr weiter Ferne unser Feuer erblickt, auf das er nun losgesteuert sei. Es war wirklich ein Wunder, daß keines der Kamele sich beim Überschreiten dieser unzähligen, finsteren, gähnenden Gräben in der Dunkelheit die Beine gebrochen hatte.
In aller Eile wurde das Lager aufgeschlagen und der Kessel auf das Feuer gesetzt. Schagdur war und blieb fort, und Chodai Kullu wurde mit der Flinte ausgeschickt, um einige Signalschüsse abzufeuern. Daß er weit ging, konnte man hören, da die Schüsse allmählich immer schwächer wurden und schließlich in der Ferne erstarben. Doch er kam unverrichteter Sache wieder, und wir gingen zur Ruhe.
Daß dieses Abenteuer noch so ablief, war eine Fügung der Vorsehung; aber daß ein Mensch wie Chodai Värdi, der sonst stets gesunden Verstand[S. 65] gezeigt, so unglaublich dumm sein konnte, ist unerklärlich. Er war 12 Stunden kreuz und quer in der Wüste umhergeirrt, während wir nur 9,1 Kilometer zurückgelegt hatten. Vom Lager konnte man sogar noch den Lehmturm von Lôu-lan sehen. Um Schagdur hatte ich nicht Angst. Ich kannte ihn zur Genüge, um zu wissen, daß er sich allein nach dem Kara-koschun durchschlagen würde. Er hatte stets einen Kompaß bei sich und wußte auf meinen Karten gut Bescheid.
Am folgenden Morgen erwachte ich bei einem vollen Sturm, der dicke Sandwolken durch die Rinne trieb, in der wir lagerten; sie zogen in ihr dahin wie Wasser in seinem Bette, und der Sand feilte die Seiten der Lehmterrassen. Die öde Landschaft sah in dieser neuen Beleuchtung, die der des gestrigen Feuers so unähnlich war, geradezu schauerlich fremd aus. Nivellieren war ganz unmöglich; wir mußten liegenbleiben. Schagdur fand sich nicht ein; er hatte in dem heimtückischen Sturme offenbar unsere Spur verloren.
Am Vormittag hielt ich mich meistens bei den Kamelen auf. Ich saß bei ihnen, streichelte ihnen den Kopf und klopfte ihnen den Rücken. Wenn sie nur geahnt hätten, wie ich sie schätzte, wie dankbar ich ihnen für die Dienste war, die sie mir geleistet hatten, und wie leid es mir tat, daß ich sie einem Führer anvertraut hatte, der sie nutzlos gequält und ihre empfindlichen Fußschwielen unnötigerweise in der harten Lehmwüste angestrengt hatte. Ruhig, zufrieden und würdig wie immer lagen sie da und glaubten wohl, es sei notwendig gewesen, 40 Kilometer in der Wüste umherzuirren. Ohne Rücksicht auf die Folgen ließ ich ihnen einen Sack Kamisch und einen Sack Eis geben. Doch welch ein Lohn wartete ihrer später! Alle, außer einem, starben in Tibet.
Mein Erstaunen war grenzenlos, als um die Mittagszeit Schagdur mit leichten, elastischen Schritten aus dem Staubnebel auftauchte! Der prächtige Junge, der einen ganzen Stamm von Muselmännern aufwiegt, war, seit er uns am vorigen Abend um 5 Uhr verlassen hatte, unausgesetzt auf den Beinen gewesen. In der Nacht hatte er Faisullahs Feuer gesehen und war dorthingeeilt. Ich hatte nämlich Faisullah befohlen, das Feuer bis spät in die Nacht zu unterhalten, nur um der Kuriosität halber feststellen zu können, ob es bei uns auf 20 Kilometer Abstand sichtbar wäre. Von Faisullah hatte Schagdur einen kleinen Vorrat Reis und Eis erhalten, denn, als sich jetzt der Sturm erhob, hatten sie gefürchtet, daß er uns nicht wiederfinden würde.
Er wollte es versuchen. Glücklicherweise hatte er auf dem Hinwege die Kompaßpeilungen aufgezeichnet. Ein paarmal hatte er die Spur von Chodai Värdis Kamelen gesehen, sie dann aber wieder verloren.
[S. 66]
Daß er uns fand, war ein Meisterstück sondergleichen. Nur ein Burjat, der sein Leben unter freiem Himmel in der Wildnis zugebracht hat und dazu Kosak ist, bringt derartiges fertig. Denn man muß bedenken, daß die Lager 20 Kilometer voneinander entfernt lagen, der Boden eben wie eine Wasserfläche war und man im Nebelsturme höchstens 50 Meter weit vor sich sehen konnte und alle Spuren zugeweht waren. Wenn ein Mensch solche Beweise von Tüchtigkeit, Klugheit und Treue gibt, kann man ihm alles anvertrauen — und das tat ich später auch ein paarmal.
Es machte uns freilich einen Strich durch die Rechnung, daß wir einen ganzen Tag verloren, doch was tat das, da der Himmel mir den schweren Verlust, der mir drohte, erspart hatte? Wir versuchten unseren Weg fortzusetzen, aber es ging nicht. Wenn der Wind 11 Meter in der Sekunde macht, schwankt die Stange und kann abbrechen, und das Fernrohr zittert auf seinem Stativ. Wir mußten uns gedulden und noch eine Nacht auf diesem wüsten Platze zubringen.
Am 12. März war ein herrlicher Tag, und wir begannen früh, arbeiteten bis Sonnenuntergang und hielten nur um 1 Uhr zehn Minuten Rast zur Ablesung der meteorologischen Instrumente. Jetzt führte Chodai Kullu die Kamele, mußte aber ganz in unserer Nähe bleiben. Der Weg ging nach Südsüdosten. Die Winderosionsfurchen ziehen sich nach Südwesten, und wir mußten über die zwischen ihnen liegenden Rücken hinüber. Für uns Fußgänger ging es wohl an, aber für die Kamele war es sehr ermüdend. Sie mußten in weiten Umwegen geführt werden, während wir mit den Instrumenten in geraden Linien vorrückten.
Abwechslung bietet sich dem Auge nicht mehr, aber das kann man in einer Wüste auch nicht verlangen. Ein Unterschied gegen die westlichere Linie des vorigen Jahres war, daß wir hier weniger, ja fast gar keinen Sand hatten. In den Rinnen ist der Boden oft mit einer fußdicken Schicht von feinem Staub bedeckt, in den man einsinkt wie in Wasser. Meistens haben wir jedoch harten Lehmboden, und bald schmerzen uns von dem ewigen Springen die Füße.
Gegen Sonnenuntergang mußte Chodai Kullu vorausgehen und das Lager aufschlagen, so daß alles fertig war, als wir mit der Tagesarbeit aufhörten. Der Fixpunkt, wo die Arbeit unterbrochen und am folgenden Morgen wiederaufgenommen werden muß, wird so gewählt, daß irgendwelche Verrückung während der Nacht ausgeschlossen ist.
Mit wachsendem Interesse rechnete ich abends aus, was die Zahlenreihen zu sagen hatten. Heute zeigten sie mir, daß wir auf 11201 Meter 2,466 Meter gefallen waren. Ich würde diese ermüdende, die Geduld auf[S. 67] die Probe stellende Arbeit nicht ausgehalten haben, wenn ich nicht eine wichtige Entdeckung erwartet hätte. Die nivellierte Linie sollte das entscheidende Urteil über das Lop-nor-Problem fällen. Ihr Profil würde zeigen, ob es möglich oder unmöglich war, daß im nördlichen Teile der Wüste Lop ein See gelegen hat.
Frühauf und gleich an die Arbeit, ist jetzt morgens die Losung.
Der Boden wurde heute günstiger. Die Jardang folgen nicht mehr so dicht aufeinander und sind niedriger, wir brauchen nicht soviel zu klettern. Aber Schneckenschalen sind allgemein, manchmal ist der Boden von ihnen ganz weißgetüpfelt. Kleine Höcker auf der Oberfläche abgerechnet, ist der Boden so eben wie ein Fußboden.
War diese Gegend für das Auge trostlos und einförmig, so war sie für das Nivellement um so bequemer. Keine Hindernisse stellten sich uns in den Weg; wir gingen in gerader Linie, rasch und ohne Unterbrechung. Wenn das Fernrohr mit der Wasserwage eingestellt ist und ich es um den Horizont führe, liegt dieser überall in genau demselben Abstande von den horizontalen Fäden des Fadenkreuzes.
Fünf Scharen Enten streichen gen Norden. Kutschuk vermutete witzig, daß unsere Entsatzexpedition unter Tokta Ahun sie vom Nordufer des Kara-koschun vertrieben habe. Wahrscheinlich ist, daß die Enten sich im Winter an diesem See und im Sommer am Bagrasch-köll aufhalten. Eine Eintagsfliege machte eine Runde um uns und verschwand wie ein funkelnder Smaragd in südlicher Richtung.
Während dieses Tages stiegen wir 2,763 Meter und befanden uns 0,11 Meter höher als im Ausgangspunkte in Lôu-lan. Wir waren mit anderen Worten auf 32 Kilometer Wegstrecke 11 Zentimeter gestiegen! Schon in diesem Lager hatte ich also den Schlüssel des Lop-nor-Problems gefunden. Die beiden ersten Tage waren wir gefallen, den dritten gestiegen; wir hatten also eine deutliche Depression überschritten, und diese ist es, die das ehemalige Bett des Lop-nor repräsentiert. Das Resultat der Arbeit der folgenden Tage würde auf diesen Schluß nicht mehr einwirken. Wir waren durch ein Becken gegangen, gleichviel in welchem Niveau sich der Kara-koschun im Verhältnis zum Ausgangspunkte befinden mochte; und daß dieses Becken einst Wasser enthalten hatte, wurde durch die Schneckenschalen und viele andere bereits erwähnte Umstände bewiesen.
Mit dem Schlage 7 Uhr ertönte ein pfeifendes Brausen im Nordosten, und ein paar Minuten später fuhr der schwarze Sturm mit ungezügelter Wut über den Boden, der ihm nicht das geringste Hindernis in den Weg stellte. Die Sonne war in außergewöhnlicher Weise in dichten Wolken untergegangen, und der Tag war drückend schwül gewesen. Alle[S. 68] notwendigen Vorsichtsmaßregeln wurden getroffen, der Fixpunkt festgeschlossen, die Jurte gründlich festgemacht, die Feuer ausgelöscht und, nachdem die Kamele mit den Köpfen auf die vom Winde abgewandte Seite gebracht worden waren, bereitete sich jeder auf das, was kommen sollte, vor; es wurde still im Lager, und nur der Sturm heulte um uns herum. Der Flugsand drang durch das Zelttuch; draußen war es stockfinster, und keine Sterne waren zu sehen.
Jeden Abend um 9 Uhr stellte Schagdur das Kochthermometer, das ich stets selbst ablas. Als er von meiner Jurte nach seinem Schlafplatze neben der Küchengeschirr enthaltenden Kiste zurückkehren wollte, fand er sich, trotzdem es nur 15 Schritte waren, nicht zurecht und verirrte sich. Eine halbe Stunde später hörte ich schwaches Rufen aus einer ganz anderen Richtung. Ich rief aus vollem Halse, und Schagdur fand sich so nach der Jurte zurück. Er war die ganze Zeit gekrochen, denn Stehen war unmöglich, und pechfinster war es auf allen Seiten. Nur auf folgende Weise konnte er seinen Platz finden; ich hielt eine kleine Spalte im Zelttuche offen, und den Blick auf diese gerichtet, kroch er rückwärts, bis er bei der Kiste anlangte. Wer nie einen solchen Sturm erlebt hat, kann sich keinen Begriff davon machen. Man wird verdreht und will nur gehen, immerzu gehen, weiß aber nicht, wohin der Weg führt; der Ortssinn scheint gelähmt zu sein, man geht im Kreise, glaubt aber in gerader Linie zu gehen. Es ist eine Art Wüstensturmkrankheit, die näher mit der Platzkrankheit als mit See- und Bergkrankheit verwandt ist; sie schlägt sich auf das Gehirn. Wäre Chodai Värdi von solch einem Sturme überfallen worden, so wäre er verloren gewesen.
Am folgenden Morgen waren die Folgen des schwarzen Sturmes deutlich erkennbar. Um meine Jurte hatte der Sand eine Ringdüne gebildet, und auch hinter den Köpfen der Kamele hatten sich große Sandhaufen gebildet. Sobald sich ein Hindernis im Wege des Flugsandes erhebt, entstehen Dünen; sonst treibt er nach Westen.
Glücklicherweise hörte der Sturm um 11 Uhr auf, und wir konnten nach Süden weiterziehen.
Die Wüste ist trostlos einförmig; der Boden besteht aus einem Gemenge, das die Eingeborenen „Schor“ nennen. Sand, Staub, Kalk und Salz, alles erstarrt und zu einer ziegelharten Masse zusammengebacken. Das Salz ist manchmal in dünnen Schollen abgesondert. Als das Wasser verschwunden war, scheint diese Masse sich durch Austrocknen ausgedehnt zu haben, denn sie ist zu unzähligen, nach allen möglichen Richtungen laufenden Wülsten aufgesprungen; die Höhe dieser beträgt manchmal 75 Zentimeter. Hier gibt es absolut keine Spur von vegetativem oder[S. 69] animalem Leben, nicht einmal eine Schneckenschale. Es ist offenbar der Boden eines Salzsees, und wir wissen auch, daß die Chinesen den Lop-nor in alten Zeiten den „Salzsee“ genannt haben. Auch der Kara-koschun hat abgeschnürte Teile, deren Wasser salzig ist, und im Süden dieses Sees sieht der früher überschwemmte Boden genau so aus wie hier — am südlichen Ufergebiete des alten Lop-nor.
Die Steigung fährt fort, obgleich nur mit 0,644 Meter auf 11250 Meter. In dem heutigen Lager befanden wir uns also um 0,754 Meter über dem Ausgangpunkte. Dies schien des Guten zuviel zu werden; der Kara-koschun konnte doch nicht höher liegen als Lôu-lan! Alle meine Gedanken und Grübeleien drehten sich um diese interessante Nivellierungslinie. Die folgenden Tage, deren Verlauf ich mit Spannung entgegensah, würden zeigen, ob wir nicht eine flache Protuberanz oder Wasserscheide zwischen dem früheren und dem jetzigen Seebecken zu passieren hatten.
15. März. Schor, den ganzen Tag Schor, tödlich einförmig! Kein Gegenstand, auf den man das Fernrohr richten könnte, nichts, was lockt, als die Sehnsucht, aus dieser langweiligen Wüste herauszukommen!
Das Wetter jedoch war herrlich, und um 1 Uhr stieg die Temperatur nur auf +11 Grad. Aber unsere Lage war insofern kritisch, als wir kaum noch etwas zu essen hatten. Der Reisvorrat hatte ein Ende genommen, nur ein kleiner Beutel mit geröstetem Mehle war noch da; die Männer hatten Tee, ich Kaffee und Zucker, — das war alles. Die Kamele hielten sich vortrefflich; sie mußten die Polsterung ihrer Packsättel auffressen. Trinkwasser war zur Genüge vorhanden, hatte aber von den Ziegenlederschläuchen einen widerlichen Beigeschmack angenommen. Noch schwammen einige Eisstücke darin, und nur diese waren genießbar.
Vergeblich suchten wir am Horizont nach einer Rauchsäule von Tokta Ahuns Signalfeuern. Schagdur spähte mit dem Feldstecher, ich mit dem Fernrohr danach aus, aber nichts war zu sehen. Eine kleine Abwechslung bot sich uns zu Ende des Marsches, indem wir an einigen, halb in den Schorboden eingebetteten Pappelstämmen vorbeikamen. Es war Treibholz, das einst, als das Land unter Wasser stand, hierher geschwemmt worden war.
Das heutige Nivellierungsresultat war 0,304 Meter Fall auf 16226 Meter. Nach einer ebeneren Landschaft kann man auf der Oberfläche der Erde lange suchen! 30 Zentimeter Gefälle auf 16 Kilometer!
Wir hatten also die vermutete Protuberanz passiert, und aller Wahrscheinlichkeit nach würde das Gelände nun nach dem südlichen Seebecken fallen.
Als wir am Morgen des 16. aufbrachen, mußten wir nach der vorjährigen Marschroute nicht viel mehr als 20 Kilometer vom Kara-koschun entfernt sein. Wir erhielten auch bald die ersten Anzeichen von „Land“;[S. 70] wir begannen zu merken, daß wir uns dem Strande des Wüstenmeeres nahten. Die äußersten „Schären“ bestanden aus ein paar toten oder sterbenden Tamarisken. Diese traten nach und nach häufiger auf, und ihre treuen Begleiter, eine kleine einen Meter hohe Sanddüne auf der vor dem Winde geschützten Seite jedes Strauches, waren unseren schmerzenden Füßen sehr willkommen.
Enten streiften in Menge umher, aber ihre Bahnen waren merkwürdig unregelmäßig. Bald flogen sie nach Süden, bald nach Norden, bald kamen sie von Südwesten, um sich nach Südosten zu begeben, nachdem sie über uns einen Kreis beschrieben, als machten sie nur einen Ausflug oder eine Rekognoszierung. Was bezwecken sie damit? Sind sie Herolde oder Kundschafter, die ausgeschickt werden, um zu sehen, ob sich im Norden neue Seen gebildet haben? Ahnen sie am Ende, daß der Lop-nor im Begriffe steht, sein Bett wieder zu verlegen? Sie haben sicher gemerkt, daß es im Kara-koschun zu eng und die offenen Wasserflächen immer seltener werden.
Die Berechnung der heutigen Nivellierung ergab einen Fall von 2,172 Meter auf eine Strecke von 16000 Meter. Wir hatten also offenbar Fühlung mit dem Becken des Kara-koschun, der südlichen Depression der Lopwüste.
Der 17. März wurde für uns ein Freudentag. Die Entfernung bis nach dem See konnte nicht mehr groß sein, erschien uns aber endlos, weil keine Anzeichen seine Nähe verkündeten. Die Zahlenreihen vergrößerten sich langsam, und wir alle waren müde, was kein Wunder ist, wenn man sich nicht satt essen kann.
Dann aber zeigten sich im Süden verschiedene Entenscharen, die zwischen Osten und Westen kreisten, ja sogar einige Falken. Als die Latte zum siebzehnten Male auf einer Sanddüne aufgerichtet wurde, blieben die Männer stehen, zeigten nach Süden und riefen: „Wasser, Wasser auf allen Seiten!“ Wir waren dem See so nahe, daß schon beim neunzehnten Male die Latte unmittelbar am Wasserrande aufgestellt werden konnte.
So standen wir denn schließlich, wie aus den Wolken gefallen, am Endpunkte dieser ermüdenden, Geduld erfordernden, aber bedeutungsvollen Nivellierarbeit. Es war ein unbeschreiblich schönes und herrliches Gefühl, denn jetzt konnten wir ein neues Kapitel beginnen und neuen Schicksalen entgegengehen!
Wie war das Nordufer des Kara-koschun hier unähnlich dem Punkte, an dem wir es im vorigen Jahre erreicht hatten. Der Strand war vollständig kahl und öde und wurde von einem sehr unbedeutenden Sandgürtel begleitet. Frei und offen lag der Wasserspiegel da. Das Wasser war[S. 71] merklich salzhaltig, aber jedenfalls besser als die faulige Suppe, die wir in unseren Ziegenschläuchen hatten.
Das Lager wurde unmittelbar am Ufer aufgeschlagen. Die Kamele warfen einen ruhigen, forschenden Blick auf das Wasser. Es war eine kalte öde Landschaft, jedoch verglichen mit den sterilen Gegenden, die wir eben durchzogen hatten, war sie ein Paradies.
Sobald wir die Nivellierungsinstrumente aus der Hand gelegt hatten, erhielt Chodai Kullu Befehl, nach Südwesten aufzubrechen und, ohne zu rasten, Tag und Nacht zu gehen, bis er Tokta Ahuns Entsatzkarawane, die nicht weit entfernt sein konnte, fände. Daß sie hier nicht hatte vorbei- und nach Nordosten weitergezogen sein können, war ersichtlich, da sich im Erdboden nicht die geringste menschliche Spur zeigte. Der Kundschafter verschwand in dem dichten Nebel; er hatte keinen Proviant mit, aber an Wasser brauchte er keinen Mangel zu leiden. Wir sollten warten, wo wir waren.
Jetzt begann wieder das Leben à la Robinson Crusoe. Unser erster Gedanke war, uns etwas Eßbares zu verschaffen. Schagdur zog mit der Schrotflinte aus und kam mit zwei fetten Enten wieder, die wir brüderlich teilten. Kutschuk wollte nicht hinter ihm zurückstehen; er wollte sein Glück im See versuchen. Ein improvisiertes Boot wurde hergestellt, — es war nicht das erstemal, daß ich mich als Schiffsbaumeister versuchte. Den Hauptbestandteil bildete meine wasserdichte Instrumentkiste. An ihren Langseiten wurden die Hälften der jetzt überflüssig gewordenen Nivellierlatte und an diesen die leeren Schläuche festgebunden. In diesem etwas unbequemen Fahrzeuge, das mit einem Spaten gerudert wurde, navigierte Kutschuk auf den flachen Sümpfen. Fische sah er jedoch nicht. Das Wasser war zu salzig, und es fehlte dem See an Vegetation.
Unterdessen rechnete ich das Resultat des Nivellements aus. Wir waren noch 55 Zentimeter gefallen. Es stellte sich demnach heraus, daß das Nordufer des Kara-koschun 2,272 Meter unter dem Ausgangspunkt in Lôu-lan liegt; im ganzen hatte der Fall kaum 2⅓ Meter auf 81,6 Kilometer betragen. Ich hatte nicht nur bewiesen, daß infolge des Reliefs des Landes ein See im nördlichen Teile der Lopwüste existiert haben kann, sondern auch, daß ein solcher dort tatsächlich sein Bett gehabt hat.
Hier ist nicht der Ort, diese merkwürdige Linie in ihren Einzelheiten zu analysieren. Ich will nur daran erinnern, daß, obgleich der Ausgangspunkt wie der Endpunkt willkürlich waren, die Linie selbst doch ihre unanfechtbare Beweiskraft behält. Der Ausgangspunkt wurde zufällig von unserem Lager in Lôu-lan gewählt, der Endpunkt am Spiegel des Kara-koschun, der veränderlich ist; der See war in dieser Jahreszeit ansehnlich gefallen. Wenn[S. 72] das Wasser der Eisschmelze hierher gelangt, steigt er wieder und dann verringert sich der Höhenunterschied noch mehr. Damit jedoch eine solche Linie vollen Wert habe, ist erforderlich, daß man nach dem Ausgangspunkte zurückkehrt und eine Kontrolle der Ablesungen erhält, deren Summe ±0 sein soll. Entsteht ein Fehler, so kann er auf die ganze Linie verteilt werden. Aber die Zeit erlaubte mir nicht umzukehren, und die Jahreszeit war auch schon zu weit vorgeschritten. Ihren Hauptzweck hatte auch die einfache Nivellierungslinie erfüllt, indem sie das Vorhandensein einer Depression bewiesen hatte.
Ganz passend für uns erhob sich der vierte Sandsturm des Frühlings am Abend. Wäre er um die Mittagszeit gekommen, so wären wir gezwungen gewesen, die Arbeit zu unterbrechen und in der Nähe des Sees zu bleiben und zu warten — und das wäre ein langes Warten geworden. Denn während der beiden Tage und drei Nächte, die wir am Ufer lagerten, ging ein heftiger Wind; die Luft war so dick wie trübes Wasser, und der Sand regnete in meine Jurte.
Es reute mich, daß ich Chodai Kullu hatte gehen lassen; wir vermuteten aber, daß er die Nacht irgendwo untergekrochen sein würde. Das Einzige, was er bei sich hatte, waren Streichhölzer zum Anzünden von Signalfeuern, aber so wie das Wetter jetzt war, hätte man ein Feuer keine 200 Meter weit sehen können. An einem Punkte am Strande, wo altes, welkes Schilf von den Stürmen nach Südwesten niedergebrochen war, steckten wir dieses in Brand. Der dicke Rauch würde vielleicht nach dem Lager der Entsatzkarawane hintreiben und unsere Ankunft signalisieren.
Als Chodai Kullu auch am zweiten Tage nichts von sich hören ließ, wurden wir unruhig. Hier war entschieden irgendetwas nicht in Ordnung. Vergebens spähten wir am Strande umher; aber keine anderen Erscheinungen als unsere eigenen Kamele tauchten aus dem Nebel auf. Wir konnten nicht lange so untätig liegen bleiben. Glücklicherweise schoß Schagdur fünf Enten, die sofort am Feuer gebraten und verzehrt wurden, obwohl sie stark mit Flugsand gepfeffert waren.
Am allermeisten plagte mich die Sehnsucht nach der Post, denn auch sie mußte sich in Tokta Ahuns Lager befinden. Der Tag war endlos lang, und kein Kundschafter ließ sich blicken. Die Lage wurde nicht angenehmer durch den ewig umherwirbelnden Flugsand, der gegen die Jurte klatschte wie feiner Staubregen gegen eine Kutsche.
Auch am 19. März verhinderte mich der Sturm, eine wünschenswerte Breitenbestimmung zu machen. Wie schon erwähnt, haben wir keinen Reis mehr, und wir sind fürchterlich hungrig — so schlecht hatte ich es seit den Takla-makan-Tagen im Jahre 1895 nicht mehr gehabt.



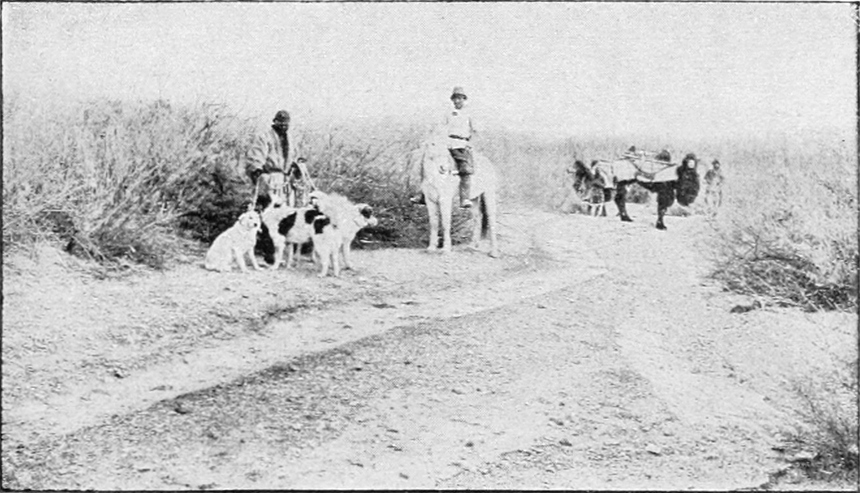
[S. 73]
Schagdur machte auf einem Ausfluge eine unerwartete Entdeckung. Er hatte weiter westlich einen See gefunden, der sich nach Nordwesten und Norden erstreckte, und längs des Ufers hatte er Chodai Kullus Fußspuren gesehen. Wir befanden uns augenscheinlich in einem Labyrinth von verwickelten Wasserflächen. Vielleicht hatten sie auch Tokta Ahun den Weg verlegt. Jetzt mußte ein Entschluß gefaßt werden. Wie wäre es, wenn wir uns um die anderen gar nicht kümmerten und östlich und südlich um den Kara-koschun herum auf eigene Hand nach Abdall zögen? Doch nein, wir hatten keinen Proviant, und in wenigen Tagen würde unsere Lage verzweifelt sein. Für alle Fälle mußte sich Kutschuk nach Osten begeben und rekognoszieren. Er kam wieder, nachdem er 11 Kilometer zurückgelegt hatte, hatte einige alte, längstverlassene Kamischhütten gefunden, einen Hügel bestiegen und dort die offene Wasserfläche gar bald im Nebel verschwinden sehen.
Am Morgen des 20. war es klar, daß wir nicht länger auf Chodai Kullu rechnen durften. Ohne Zweifel hatte er die anderen überhaupt nicht gefunden, und es wäre ein Glück, wenn es ihm wenigstens gelungen wäre, menschliche Wohnungen zu erreichen, bevor er vor Hunger zusammenbrach.
Als wir von diesem unwirtlichen Strande, den wir zuerst mit so hoffnungsvollen Gefühlen erblickt hatten, eilfertig aufbrachen, war der Himmel noch grau und schwer. Am Ufer hatte sich ein schmaler Eisrand von 2 Zentimeter Dicke gebildet, womit ein halber Sack gefüllt wurde, und es war schön, daß man nicht mehr nötig hatte, sich das noch in den Schläuchen vorhandene, fast untrinkbare Wasser hinunterzuquälen.
Die Kamele waren ausgeruht und hatten leichte Lasten, so daß wir schnell marschieren konnten. Wider Erwarten zwang uns das Seeufer nach Nordwesten und Norden zu gehen. Links hatten wir die größten Wasserflächen, die ich je im Kara-koschun gesehen habe, rechts die Wüste. Diese Seen aber waren seicht; die Enten, die zu Tausenden vorkamen, schnatterten und tauchten weit vom Strande.
Nach mehrstündigem Marsch bestieg ich mein altes Reitkamel vom vorigen Jahre. Ich beherrschte nun einen weiteren Horizont als die Fußgänger und konnte sie rechtzeitig warnen, nicht gerade auf Sümpfe und Kanäle loszugehen.
Etwa 80 Meter vom jetzigen Seeufer erblickten wir in dem schmalen Dünengürtel wieder Spuren von menschlichem Besuch. Es waren zwei bis an den Dachfirst im Sande begrabene Kamischhütten. Gegen die eine war ein Kahn gelehnt, dessen Vordersteven zwei Fuß weit aus dem Sande hervorguckte. Der Fund war von Interesse. Die Hütten, das Boot, die Hausgeräte, die wir fanden, zeigten, daß sich Fischerfamilien wahrscheinlich[S. 74] noch vor wenigen Jahrzehnten in dieser Gegend aufgehalten hatten.
Mein erster Gedanke war, zu versuchen, ob sich nicht aus dem Kahne Nutzen ziehen ließe. Die Leute machten sich sofort daran, ihn auszugraben. Wäre er noch gut im Stande, so könnte man ihn zum Rekognoszieren, Fischen und Tiefenloten gebrauchen. Sie hatten 2 Meter von ihm freigelegt, als sich eine klaffende Spalte zeigte; er wurde nun unbarmherzig der Vernichtung, die schon einen Teil seines Rumpfes verzehrt hatte, wieder überlassen.
Endlich bog das Seeufer gerade nach Westen ab, und wir machten es ebenso. An seinem Rande stand das Schilf etwas dichter. Schagdur konnte noch eine verlassene Hütte als Deckung benutzen, als er eine Schar Enten beschlich. Er kehrte mit nicht weniger als sieben von ihnen zurück und wurde mit Jubel empfangen — wir konnten damit gut zwei Tage lang die Lebensgeister aufrechterhalten.
Unser See sah noch immer sehr umfangreich aus; sein Südufer war nicht zu sehen, sondern verschwand im Nebel.
Chodai Kullus Spur war fast den ganzen Tag deutlich zu erkennen. Doch als der See auch in dieser Richtung aufhörte und wir über ödes Land nach Südwesten zogen, zeigte es sich, daß der Mann nach Nordwesten gegangen war. War er verrückt geworden? Hatte er wieder in die Wüste hineingewollt? Jedenfalls mußten wir seine irrende, vergeblich suchende Spur verlassen, um mit den Seen in Fühlung zu bleiben. An einigen salzigen Tümpeln, wo die Kamelweide gut und Brennholz reichlich war, lagerten wir und bedienten uns des am Morgen mitgenommenen Eisvorrates.
Spät am Abend, als die Luft ein wenig klarer geworden war, zündeten wir wieder große Feuer von dürren Tamarisken an. Doch sie loderten auf, sprühten, glühten und verkohlten, ohne Antwort zu erhalten. Still war die Nacht, kein verdächtiges Geräusch war zu hören, keine Reiter kamen mit frohen Nachrichten ins Lager angesprengt, und keine Spur von einem Kundschafter war zu entdecken. Meine Besorgnis und Ungeduld wurden immer größer. Auf Chodai Kullu rechneten wir nicht mehr. Faisullah mußte jetzt glücklich in Kum-tschappgan angekommen sein. Warum ließ aber Tokta Ahun nichts von sich hören? Er hatte, als wir uns am Anambaruin-gol trennten, Befehl erhalten, uns hier rechtzeitig entgegenzukommen. Er mußte bereits seit mehreren Tagen am See sein. Warum ließ er sich denn nicht blicken? Ich wußte, daß ich mich auf ihn unbedingt verlassen konnte. War ihm auf der Rückreise nach Tscharchlik ein Unglück zugestoßen und hatte er diesen Ort überhaupt nicht erreicht? Oder hatte[S. 75] er sich nur durch diese seltsamen, wandernden Seen, die sich von einem Jahr zum anderen bis zur Unkenntlichkeit verändern, auf eine falsche Straße locken lassen? Wann würden wir Antwort auf alle diese Fragen erhalten? Dunkel umhüllte uns die Nacht, und die ersterbenden Feuer ließen nur noch schwache Rauchsäulen aufsteigen.
Am nächsten Tage ging es in derselben Richtung weiter, bald an See- und Buchtufern entlang, bald über kahle Steppen. Schagdur kroch, einer wilden Katze gleich, den Enten nach und erlegte wieder einige. Ein wilder Eber rannte in so wildem Laufe durch das Schilf, daß der Staub hoch aufwirbelte. Er war gar nicht scheu; es war ja auch nie ein Flintenlauf auf ihn gerichtet gewesen, da er zu seinem eigenen Heil nach dem Koran ein unreines Tier ist.
So gelangten wir an einen neuen See, wo das Schilf dichter war als bisher. Ich ritt auf meinem sicheren, wiegenden Kamele und nahm die Umrisse dieser unbeständigen Seen auf einer Karte auf, wohl wissend, daß die Verteilung von Wasser und Land hier in ein, zwei Jahren ganz anders aussehen würde.
Jetzt gebot uns ein schmaler Wasserarm Halt, der uns den ganzen Rest des Tages völlig verdarb. Er war nur ein paar Meter breit und wenig tief, aber sein Boden bestand aus so weichem, gefährlichem Schlamm, daß wir nicht daran denken konnten, die Kamele hinüberzuführen. Wir umgingen ihn südwärts und waren bald auf allen Seiten von Wasser umgeben. Im Norden dehnten sich neue Seen aus. Als wir lagerten, nachdem wir vergeblich nach einem Ausweg aus diesem Labyrinth gesucht hatten, war das Land nur nach der Seite, von der wir gekommen waren, hin offen, und obgleich wir nach Südwesten sollten, mußten wir am Morgen doch nach Nordnordosten zurückgehen.
Nie hat der Kara-koschun in so hohem Grade wie jetzt auf mich den Eindruck eines Sumpfes gemacht. Er besteht hier nicht aus wirklichen Seen, sondern nur aus seichten Überschwemmungen.
Während der Nacht hatten sich neue Wasserarme gebildet, und wir mußten früh aufbrechen, um nicht ganz auf einer Insel eingesperrt zu werden. Wir selbst hätten wohl über das Wasser kommen können, aber die Kamele! Dieser eigentümliche Schor-Boden, der ziegelhart wird, sobald er trocknet, wird breiweich, sobald er überschwemmt wird.
Es erfordert mehr als Geduld, in seinen eigenen Fußspuren wieder zurückzugehen und statt Terrain zu gewinnen, schon gewonnenes wieder zu verlieren.
An einem breiten Wasserarme sahen wir wieder Chodai Kullus Spur. Er war entschieden hinübergeschwommen, denn die Spur verschwand nachher.[S. 76] Wo mochte der Arme geblieben sein? Jetzt waren es fünf Tage, seit ich ihn fortgeschickt hatte. Daß er, wenn er überhaupt noch lebte, nicht zurückkommen würde, war klar, denn ich hatte ihm gesagt, daß wir, wenn er zu lange ausbleibe, östlich und südlich um den Kara-koschun herumgehen würden.
Am 23. März wanderten wir längst einer durch kleine Stromarme miteinander verbundenen Seenkette nach Nordosten weiter. Ich ging weit voraus. Die Gegend war unfruchtbar. Ich sah mit eigenen Augen, wie der Kara-koschun nach Norden und Nordosten, nach dem alten Bette des Lop-nor zurückgesogen wurde. Konnte ich wohl einen deutlicheren Beweis dafür erhalten, daß meine Theorien von 1896 richtig waren? Es wurde mir immer klarer, daß sowohl Tokta Ahun wie Chodai Kullu und möglicherweise auch Faisullah sich bei den Veränderungen, die in diesem Jahre hier vor sich gegangen waren, nicht hatten zurechtfinden können. Was sie vorfanden, stimmte durchaus nicht überein mit den Beschreibungen, die ich ihnen gemacht hatte.
Müde und traurig machte ich an einem Punkte Halt, wo der Wasserarm sich auf 7 Meter verengte, um sich bald darauf in einen See zu ergießen (Abb. 217). Als die Karawane angelangt war, wurde die Stelle untersucht. Der Boden trug uns, denn er bestand aus hartem, blauem Ton, und an den feuchten Ufern sanken die Kamele nicht mehr als einen Fuß tief ein.
Um zu erfahren, wie das Land im Norden aussah, schickte ich Schagdur auf Kundschaft aus. Nach einer guten Weile tauchte er am Ostufer des unteren Sees auf und winkte uns wie toll, dorthin zu kommen. Ich zog es jedoch vor, mündlichen Bescheid abzuwarten, weshalb Schagdur sich auf die Beine machte. Als er atemlos in Hörweite gekommen war, deutete er nach Südwesten und rief. „Reiter, Reiter!“
Richtig: in einer Staubwolke erschienen zwei Reiter, die sich uns so schnell näherten, wie die Pferde nur zu laufen vermochten. Schagdur erzählte, daß er an dem Punkte, wo er uns gewinkt hatte, ganz frische Spuren von fünf Pferden gesehen und ein paar Minuten später die Reiter erblickt habe.
So hatte denn endlich die Stunde unserer Befreiung geschlagen! Mit größter Spannung sahen wir diese willkommenen Boten über den Boden sprengen und beobachteten sie mit dem Fernglase. Bald erkannten wir Tschernoff und Tokta Ahun!
[S. 77]
Nie bin ich mit einem alten treuen Diener mit größerer Wärme und Freude wieder zusammengetroffen als in dieser Mittagsstunde! Tschernoff, mein vortrefflicher Kosak, war auch so froh, daß er zitterte, und seine Wangen glühten vor Eifer. Er brannte vor Begierde, mir alles erzählen zu dürfen; er wußte, daß ich durch ihn den abgeschnittenen Faden wiedererhalten und von neuem mit der Welt, von der ich über ein halbes Jahr abgeschlossen gewesen war, in Berührung treten würde.
Was jedoch im ersten Augenblick mein besonderes Interesse erregte, war, daß er nach meinem Lager hatte zurückkehren können. Im vorigen Sommer war uns mitgeteilt worden, daß alle semirjetschenskischen Kosaken auf ihren Posten sein müßten, weil die politische Lage in Asien für unruhig gelte. Doch der Kaiser hatte die unendliche Güte gehabt, mit meinen beiden Kosaken Sirkin und Tschernoff eine Ausnahme zu machen. Am letzten Juni 1900 hatten sie sich von mir getrennt und waren nach Kaschgar geritten, wo sie jedoch erst einige Monate geweilt hatten, als Generalkonsul Petrowskij aus Petersburg ein Telegramm mit dem Befehl im Namen des Kaisers erhielt, daß die beiden Kosaken Sirkin und Tschernoff sich augenblicklich nach meinem Lager zu begeben hätten, wo ich mich auch befinden möge. Als dieser Befehl an einem Sonnabend Nachmittag eingetroffen war, hatte der Konsul die Kosaken rufen lassen und ihnen befohlen, Pferde zu kaufen und am nächsten Morgen abzureisen. Sie hatten gefragt, ob sie nicht den Sonntag über noch dort bleiben dürften, aber ein kaiserlicher Befehl duldet keinen Aufschub.
So saßen sie denn am Sonntag Morgen im Sattel und nahmen meine ganze große Post, 27 Jamben Silbergeld, einige Instrumente und photographische Utensilien mit, und nun ging es über Aksu und Korla nach Tscharchlik, das sie nach 48tägigem Ritt Ende Dezember erreichten. Da sie mich dort nicht gefunden hatten, beschlossen sie meine Rückkehr zu erwarten und benutzten die Zeit gut. Sirkin übernahm die meteorologischen[S. 78] Ablesungen, Tschernoff begab sich nach dem Delta des unteren Tarim, über dessen neueste Veränderungen er eine Reihe wohlgelungener Kartenskizzen ausführte. Da er des Schreibens unkundig war, nahm er einen Mirsa (Schreiber) mit, der alles notierte. Die ganze Rekognoszierung brachte mir viel wichtige Aufklärung und wurde später in Tibet in freien Stunden gründlich durchgegangen.
Was Tokta Ahun anbetrifft, so hatte auch er seinen Auftrag wie ein ganzer Mann ausgeführt. Er war vom Anambaruin-gol nach Tscharchlik geritten, hatte nur eines der sechs schlechten Pferde unterwegs verloren, Islam meine Post übergeben, sich von ihm mit Proviant und ausgeruhten Pferden ausrüsten lassen und sich mit Tschernoff über Abdall nach Kum-tschappgan begeben und war dann nach Nordosten am Nordufer des Kara-koschun entlanggezogen. Nur in einem Punkte hatte er meinen Befehlen nicht gehorchen können. Er hatte sich nur zwei, statt drei Tagemärsche von Kum-tschappgan entfernt, aber er war völlig entschuldigt, denn der neugebildete See, der uns so viel Abbruch getan hatte, hatte auch ihm Halt geboten.
Tschernoff und Tokta Ahun hatten ganz in der Nähe des Punktes, wo wir im vorigen Jahre das Ufer erreicht hatten, ein Hauptlager aufgeschlagen, eine Hütte erbaut, Massen von Enten in Schlingen und Fische in ausgelegten Netzen gefangen und reichliche Vorräte an Schafen, Hühnern, Eiern, Mehl, Brot und Mais mitgebracht. Aus einem Fischerdorfe hatten sie zwei große und einen kleinen Kahn mitgenommen.
Ein ganzes Landgut war in der Einöde entstanden. Jeden Abend, sobald es dunkel war, hatten sie auf dem Hügel, von dem ich im Jahre 1900 die gesegneten Wasserflächen des Kara-koschun zuerst erblickt hatte, ein gewaltiges Feuer angezündet. Mehrere Fischer aus Kum-tschappgan waren mitgekommen und trugen das Brennholz auf den Hügel, so daß Tschernoff es abends nur anzuzünden brauchte. Wir hatten des Nebels wegen ihr Feuer nicht gesehen, und sie hatten unsere Feuer nicht erblickt. Und doch betrug die Entfernung zwischen ihrem Lager und dem Punkte, wo uns zuerst der kleine Wasserarm den Weg abgeschnitten hatte, nur 3 Kilometer!
Inzwischen hatten sie in Erwartung unserer Ankunft 12 Tage lang ein idyllisches Leben geführt, Fuß- und Rudertouren unternommen, gejagt und gefischt, bis eines schönen Tages der gute Chodai Kullu aus der Wüste aufgetaucht war und ihrem friedlichen Leben mit einem Male ein Ende gemacht hatte. Sie hatten noch in derselben Stunde eingepackt und sich mit Chodai Kullu als Führer eiligst aufgemacht, um uns zu suchen — und nun hatten sie uns endlich gefunden. Beim Aufbruch hatten sie sich auf[S. 79] eine lange Reise vorbereitet, denn Chodai Kullu hatte richtig gemeldet, daß ich mich schon mit dem Gedanken trüge, den See längs des Südufers zu umgehen.
Nachdem wir eine Weile geplaudert hatten und beiderseitig von allem Geschehenen unterrichtet waren, brachen wir auf, um südwärts nach einem Tümpel zu ziehen, der von unserem Lager am 20. März nicht weit entfernt lag. Unterwegs fischten wir auch Chodai Kullu auf, der auf einem Grasbüschel saß und bitterlich weinte, als er mich erblickte, — so überwältigte ihn jetzt die Erinnerung an die Schicksale, die er während seines fünftägigen Suchens nach der Hilfsexpedition durchgemacht hatte. Er war immerfort gegangen und schließlich voll Verzweiflung über mehrere Seen geschwommen. Am dritten Tage saß er müde und niedergeschlagen am Ufer eines derselben, als eine Schar Enten über ihm hinwegsauste. Wie durch ein Wunder fiel eine von ihnen mit gebrochenem oder gelähmtem Flügel gerade vor ihm nieder. Wie ein Raubtier stürzte er sich auf sie und aß sie, roh wie sie war, ganz und gar auf. Durch dieses Mahl gestärkt, hatte er noch zwei Tage gehen können und schließlich diejenigen gefunden, die er suchte.
An mehreren Stellen hatte er Spuren von Faisullahs Karawane gesehen und daraus geschlossen, daß alle am Leben waren, auch die drei Pferde und die drei Hunde, nach denen ich mich ganz besonders sehnte. Dann aber hatte die Spur das Ufer verlassen und war wieder in die Wüste hineingegangen, als ob der alte Führer Faisullah gar nicht mehr gewußt, wohin er sollte.
Sobald Tokta Ahun dies erfahren hatte, bot er Leute in zwei Partien, eine aus Kum-tschappgan und eine aus Abdall, auf und schickte sie nordwärts in die Wüste hinein, um die Verirrten zu suchen. Von Faisullah wußten wir nichts und schwebten seinetwegen in größter Unruhe. Seine Karawane hatte alles, was wir während der Reise erworben hatten, außer den Karten bei sich: alle Sammlungen, photographischen Platten, Schnitzereien und einen Teil der Manuskripte. Sollte dies alles verloren sein? Tokta Ahun beruhigte mich jedoch und sagte, daß die Entsatzexpeditionen Faisullah, der überdies ein kluger, vorsichtiger Mensch sei, schon finden würden.
Chodai Kullu erhielt für seinen bewiesenen Mut und seine Entschlossenheit eine Extrabelohnung in Silbergeld. Er versicherte ruhig, daß er die ganze Zeit über fest entschlossen gewesen sei, nicht umzukehren, sondern zu versuchen, seinen Auftrag auszuführen, wenn es auch das Leben kosten sollte. Schon seit er das wilde Kamel getötet hatte, war sein Ansehen gestiegen; jetzt aber wurde er nie anders als Batir, der Held, genannt.[S. 80] Solche Leute muß man haben; unter den Muselmännern sind sie jedenfalls selten.
Unsere lange Wanderung nahte sich ihrem Ende. Ihr letzter Abschnitt war ein Durcheinander von verwickelten Verhältnissen gewesen. Doch was tat das, da sich schließlich alles auf glückliche, wunderbare Weise löste! Mein guter Stern hatte mich nicht verlassen, und all meine Unruhe um die zersplitterten Teile der Karawane war unnötig gewesen.
Wie süß und notwendig war die Ruhe an diesem tiefen, klaren Süßwasserarme, wo stellenweise üppiges Schilf wucherte. Wir waren hier zwei Tage in der Wildnis zu Gaste. Wir lebten flott, denn die drei Proviantpferde der Entsatzexpedition hatten reichliche Vorräte an Fleisch, Fischen, Reis, Brot, Mehl und Eiern, ja sogar Tee und Tabak mitgebracht. Die Post von zu Hause war jedoch das Allerbeste; sie fesselte mich an meine Jurte, und es bedurfte einer gewissen Energie, um das Lesen zu unterbrechen und eine Breitenbestimmung auszuführen. Alles war mir neu; merkwürdig aber war es, daß ich von dem Boxeraufstande in China durch einen Brief aus — Stockholm erfahren sollte. Se. Exzellenz der Minister des Auswärtigen warnte mich davor, und vielleicht war es ein Glück für uns, daß wir uns nicht nach Sa-tscheo begeben hatten, obwohl wir ganz in der Nähe dieser Stadt gewesen waren.
Am 25. März begaben sich Chodai Kullu und Tokta Ahun vorweg nach dem Standlager zurück. Merkwürdigerweise waren wir nur 3 Kilometer voneinander entfernt gewesen, und doch hatte mein Kundschafter fünf Tage gebraucht, um dorthin zu gelangen. Der Grund war der, daß neugebildete, mächtige Wasserarme, die der Kara-koschun nach Norden aussendet, unsere Lager trennten. Um nach ihrem Standlager zu gelangen, mußte man entweder diese Seen umgehen oder die Flußarme überschreiten. Jenes hatte die Hilfsexpedition getan, dieses wollten Tokta Ahun und Chodai Kullu versuchen. Sie nahmen keinen Proviant mit, gingen zu Fuß und schwammen schließlich, die Kleider in einem Bündel auf dem Kopfe, über die breiten Ströme. Der Grund, warum sie nicht mit uns zu Lande dorthin gingen, war, daß sie rechtzeitig wieder im Standlager sein mußten, um die Fischer aus Kum-tschappgan dort zurückzuhalten.
Am nächsten Tage hatte unsere süße Rast ein Ende. Dieser Lagerplatz, Nr. 170 auf meiner Karte, war einer der besten auf der Reise, einer von denjenigen, die ich nie vergesse. —
Am 26. März führte uns der ganze Tagemarsch nach Norden, und wir folgten meistens den Spuren der rettenden Reiter, die jedoch hier und da schon unter Wasser standen, so hastig drängt der neue See nach Norden.

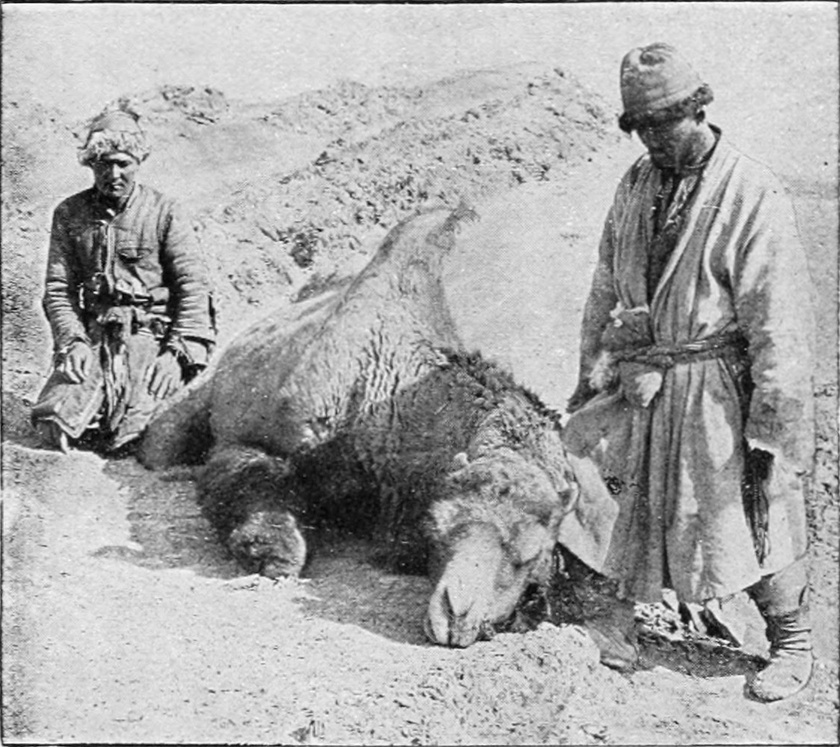
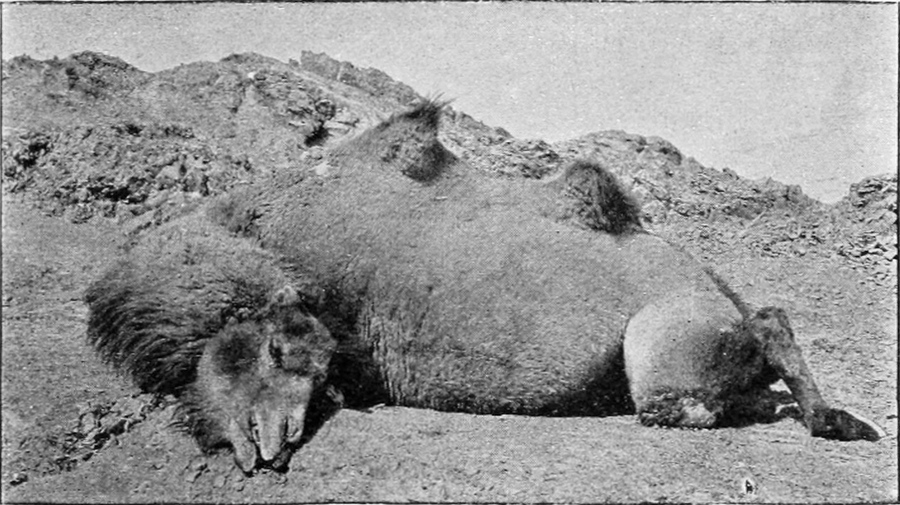
[S. 81]
Dieser eigentümliche nördliche Auswuchs des Kara-koschun kann zum Teil auch auf den hydrographischen Verhältnissen im ganzen Tarimbecken beruhen. Alle Flüsse Ostturkestans waren während des vorhergehenden Sommers und Herbstes außergewöhnlich wasserreich, welcher Umstand wahrscheinlich von dem größeren Schneeniederschlag in den Randgebirgen herrührt. Dieser wieder würde sich nur aus größeren Gesichtspunkten, wie der Verteilung des Luftdruckes, dem Vordringen der Winde und besonders der Monsune, erklären lassen. Wenn der Zufluß reichlicher ist, müssen auch die äußersten Seen des Tarimsystems zu größeren Dimensionen als gewöhnlich anschwellen.
Einige vereinzelte Tamarisken und ein paar dürre Pappeln mahnten uns, an einem Punkte zu lagern, wo die Spuren von Faisullahs Karawane sehr deutlich waren. Faisullah hatte sich, wie wir, in diese scheußliche Mausefalle hineinlocken lassen und war umgekehrt, um den wandernden See im Nordosten zu umgehen.
Das Terrain war schwierig und wurde am folgenden Marschtage nicht besser. Die Lehmrücken und die zwischen ihnen liegenden Rinnen sind konsequent nach Nordosten gerichtet, und wir mußten sie in der Quere überschreiten. Die Ausläufer des neuen Sees zeigen wie Finger nach derselben Richtung. Wir gehen nach allen Himmelsrichtungen, um ihnen auszuweichen, und erst, nachdem wir die äußersten hinter uns zurückgelassen haben, können wir nach Westen und Südwesten ziehen. Da aber hatten wir beinahe schon den halben Weg nach Lôu-lan zurücklegen müssen. Hätte ich von der diesjährigen Wasserverteilung eine Ahnung gehabt, so hätte das Nivellement auf die halbe Entfernung beschränkt werden können.
Ich wunderte mich, an einigen Stellen dieser Gegend alten Kamelmist, der manchmal in ziemlich großer Menge vorkam, zu finden. Daß es sich dabei nur um wilde Herden handeln konnte, ist sonnenklar. Sie kreuzen also die Wüste und kennen die Existenz der im Süden liegenden Seen. Und sie können ruhig hierherkommen, denn jetzt begeben sich Menschen nur äußerst selten hierher. Die Entfernung ist für diese schnellfüßigen Tiere nur eine Kleinigkeit.
Die Reise nach Südwesten ging leichter, denn jetzt konnten wir uns in den Windfurchen halten und ganze Strecken weit Faisullahs Spuren folgen. Wenn wir bezweifelt hätten, daß es wirklich seine Karawane gewesen, so hätte uns ein „lebender“ Beweis bald Gewißheit gegeben. Dort lag ein totes Pferd, der Braune, den Schagdur geritten hatte. Die Eingeweide waren weggeworfen und die weicheren und besseren Fleischteile mitgenommen worden. Gewiß hatten sie keinen Proviant mehr gehabt.
Wir machten an dem unfruchtbaren Ufer eines Seearmes Halt. Recht[S. 82] eigentümlich war es, zu sehen, wie das Wasser nach Nordosten strömte, d. h. wie der Ausläufer sich immer mehr nach dieser Richtung hin vergrößerte und immer neuen Zufluß von Südwesten erhielt. Hier befanden wir uns sicherlich gerade vor der nördlichen Depression der nivellierten Linie, und die schwache Erhebung zwischen dem nördlichen und südlichen Becken der Wüste, die wir nivelliert hatten, fehlt hier oder hat hier eine Lücke.
Am 28. fuhren wir fort, den launenhaft gewundenen Ufern getreulich zu folgen. Auch jetzt wurde eine interessante Beobachtung an einem Tümpel gemacht, der sich gebildet hatte, seitdem Tschernoff vor sieben Tagen eine Kartenskizze über die Gegend aufgenommen hatte (Abb. 218). Er ist abgeschnürt und wird durch aus dem Boden hervorquellendes Wasser gespeist. Seine Fläche (zirka 50000 Quadratmeter) gleicht der Oberfläche eines kochenden Kessels, das Wasser sprudelt und wallt mit einem singenden Tone. Das aufsteigende Quellwasser bringt Luftblasen mit, die um jeden Herd Schaumblasen bilden. Manchmal wölbt sich das Wasser dezimeterhoch, an einen Miniaturgeiser erinnernd, und es plätschert im Tümpel, als ob große Fische mit dem Schwanze auf die Wasserfläche schlügen.
Das spezifische Gewicht war 1,0036, und das Wasser erschien uns, die wir an größeren Salzgehalt gewöhnt waren, beinahe süß; ein paar Kannen davon wurden zum Abend mitgenommen. Um es so frisch wie möglich zu halten, sollte Kutschuk aus der Mitte des Tümpels schöpfen, aber im selben Augenblick war er verschwunden. Er war auf eine tückisch versteckte Jarkante gelangt und plötzlich von ihr in tiefes Wasser geraten. Da er nun einmal naß war, mußte er über den Tümpel schwimmen und mit einer Zeltstange loten. Die größte Tiefe betrug 2,22 Meter — und dieser kleine See hatte sich in einer Woche gebildet!
Während der kurzen Zeit unseres Aufenthalts am Ufer konnten wir sehen, wie das Wasser sich nach den Seiten hin ausbreitete; neue kleine Arme drangen in die Rinnen ein, neue Bodensenkungen füllten sich allmählich. Wie weit würden diese wandernden Seen in diesem Jahre gelangen? Würden sie bis an das alte Becken des Lop-nor vordringen? Nur neue Besuche in der Gegend konnten diese Fragen beantworten.
Nun ging es weiter nach Westen, Südosten und Osten um die Seen herum, wo der arme Chodai Kullu ohne Nahrung gewandert war. Wir fanden auch den Punkt, wo Faisullah das Ufer verlassen und sich in die Sandwüste hineinbegeben hatte.
Dieses Unternehmen sah so bedenklich aus, daß ich Schagdur der Spur folgen ließ, um zu sehen, wo sie blieb. Nach dem Kompaß nahm er sie eine Strecke von 10 Kilometer weit auf und konnte mich damit beruhigen, daß die Karawane nur einen Umweg gemacht und dann wieder nach Südwesten[S. 83] gegangen war. Hätte sie das Ufer nicht verlassen, so würde sie nach einer weiteren Tagereise das Standlager der Hilfskarawane erreicht haben.
Ein paar leere Konservenbüchsen verrieten den Punkt, an dem wir im vorigen Jahr bei dem ersten Salztümpel das Lager aufschlugen, der, wie wir damals meinten, vom Schirge-tschappgan herrührte. Der schmale Arm, den wir damals mit Leichtigkeit durchwateten, war jetzt so angeschwollen, daß man sowohl sich selbst wie die Kamele bequem darin ertränken konnte.
Unser letzter Tagemarsch um den zeitraubenden See führte uns südwärts nach Tokta Ahuns Standlager, wo wir ihn und Chodai Kullu in schönster Ruhe in der Hütte fanden.
So hatten wir denn endlich nach dem anstrengenden, drückenden Wüstenzuge diese heiß ersehnte Freistatt erreicht. Doch sie empfing uns wenig gastfreundlich. Alle Leute aus Kum-tschappgan waren in dem Glauben, daß wir südlich um den Kara-koschun herum kämen, nach Hause gezogen. Indessen hatten sie zum Glück zwei Kähne hinterlassen, und Proviant war reichlich vorhanden. Doch Tokta Ahun mußte sofort zu Pferd nach Kum-tschappgan eilen, um frische Fische zu besorgen.
Am 30. machte Sturm alle Arbeiten im Freien unmöglich. Ich unterhielt mich daher mit den Kosaken und lag die übrige Zeit lesend auf meinem Bette.
Der Tag darauf war günstiger; es wehte wohl, aber jetzt konnten wir die Wassermenge messen, die nordwärts nach dem alten Bette des Lop-nor drängte. Die Wellenbewegung war für einen Kahn zu stark; wir banden daher beide zusammen; Tschernoff und Chodai Kullu waren meine Ruderer. Der Kosak wußte in diesen labyrinthähnlichen Schilfdickichten, die er während der langen Wartezeit nach allen Richtungen hin durchkreuzt hatte, außerordentlich gut Bescheid.
Es wurde jedoch eine ziemlich schwierige Arbeit. Chodai Kullu und Tokta Ahun waren vor sechs Tagen auf ihrem Wege nach der Hütte über acht bedeutende Strömungen geschwommen, mir gelang es aber nur, sechs zu messen, die vollkommen deutlich und abgegrenzt waren und zusammen 32 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führten. Dieser Wert ist jedoch sicherlich zu niedrig, denn viel fließendes Wasser ist in dem dichten Schilfe verborgen. Jedenfalls fanden wir, daß jetzt kolossale Mengen auf dem Wege nach Norden waren. Drei Millionen Kubikmeter Wasser im Laufe eines Tages sind in Anbetracht der ungeheuren Flachheit des Landes imstande, einen recht ansehnlichen See zu bilden. In dem lebhaftesten Arme strömte es mit einer Geschwindigkeit von 0,55 Meter in der Sekunde.
Es mag merkwürdig erscheinen, daß das Wasser noch nicht weiter als ein paar Tagereisen nach Nordosten vorgedrungen war; aber wir müssen[S. 84] bedenken, daß der strohtrockene Boden ungeheure Mengen aufsaugt; er muß erst durchfeuchtet werden, ehe das unruhige Element seinen Weg auf sicherer Unterlage fortsetzen kann.
Schön und frisch war es, in der sich jetzt klärenden Luft und dem kühlenden Winde, der durch gelbe, dürre Schilfbestände sauste, wieder einen ganzen Tag auf dem Wasser zuzubringen. Aber ich fühlte doch, daß ich jetzt von diesen Sümpfen für einige Zeit genug hatte und das Leben im Gebirge Abwechslungen ganz anderer Art und Erfahrungen von wechselnderer, mannigfaltigerer Natur bietet.
Ich konnte das Land der wandernden Seen auch mit großer Befriedigung und Dankbarkeit verlassen, denn ich nahm reiches Material von dort mit. Ich hatte Manuskripte und Ruinen von Dörfern am Ufer eines Sees gefunden; ich hatte naturgeschichtliche Beweise für das frühere Vorhandensein des Sees gefunden; die Nivellierung hatte ferner bewiesen, daß eine Depression im nördlichen Teile der Wüste existierte, und schließlich, als unbestreitbares Siegel der Richtigkeit des Ganzen, war ich mit eigenen Augen Zeuge gewesen, wie sich der See nach seinem alten Bette hinbewegte, und zwar so schnell, daß wir genau überlegen mußten, wie weit vom Ufer wir unser Nachtlager aufschlagen konnten.
Während der letzten Jahrzehnte oder seit Prschewalskijs Zeit hat der Kara-koschun sichtliche Neigung zum Austrocknen gezeigt. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir nach Jahren den See wieder an der Stelle finden werden, wo er nach chinesischen Angaben einst seinen Platz gehabt haben soll und wo er, wie Richthofen in scharfsinniger Weise theoretisch bewiesen hat, auch wirklich gelegen haben muß.
Daß in der Wüste, die nach meinem Nivellement so gut wie ganz horizontal ist, derartige Verhältnisse herrschen, ist durchaus kein Wunder. Der See Kara-koschun, der jetzt lange genug in ihrem südlichen Teile gelegen hat, verflacht durch Schlamm, Flugsand und verfaulende Pflanzenstoffe, während die nördliche, vertrocknete Fläche der Wüste von den Winden erodiert und angefressen und dadurch immer tiefer ausgemeißelt wird. Für diese Niveauveränderungen, die von rein mechanischen, lokal atmosphärischen Kraftgesetzen diktiert werden, muß der See, der das Endreservoir des Tarimsystems bildet, außerordentlich empfindlich sein. Aus physischen Notwendigkeitsgründen muß es schließlich dazu kommen, daß das Wasser sozusagen überfließt und relativ niedrigere Depressionen aufsucht. Die Vegetation und das Tierleben, sowie die Fischerbevölkerung und ihre luftigen Hütten ziehen mit an die neuen Ufer, und der alte See trocknet aus. In der Zukunft wiederholt sich dasselbe Phänomen in umgekehrter Ordnung, aber von denselben Gesetzen vorgeschrieben. Erst dann wird man, mit reichhaltigerem[S. 85] Materiale, die Länge der Periode bestimmen können. Was wir jetzt schon mit voller Sicherheit wissen, ist, daß im Jahre 265 n. Chr., im letzten Regierungsjahre des Kaisers Yüan Ti, der Lop-nor im nördlichen Teile der Wüste lag.
Die Strecke, die wir am 1. April zurücklegten, kannte ich vom vorigen Jahre, und es ist stets unangenehm, denselben Weg zweimal zu machen. Etwas Abwechslung hatte ich jedoch dadurch, daß ich die neue Karte mit der vorjährigen vergleichen und die großen Veränderungen, die eingetreten waren, studieren mußte.
Jetzt nahte sich die Jahreszeit, in welcher die Abendkühle ein willkommener Freund ist, unter dessen Schutz man sich von den Mühen des Tages erholt. Bis jetzt hatten wir freilich noch nicht über Hitze zu klagen brauchen, aber unser acht Monate währender Winter hatte uns gegen Wärme empfindlich gemacht. An diesem Abend schwebten weiße Wölkchen über der Erde; die Luft war rein, und der Mond verbreitete sein klares Licht über dem Lande des wandernden Sees. Dann und wann durchschneiden sausende Flügelschläge die Luft, man hört Enten schnattern und Wildgänse schreien und gelegentlich auch das in dieser Jahreszeit schwere, ungeschickte Flügelklappen der Schwäne.
Am 2. April ging es nach Südwesten weiter. Nias Baki Bek, Numet Bek und unser alter Mollah kamen uns entgegen und meldeten, daß Faisullah mit der ganzen ihm anvertrauten Karawane wohlbehalten in Abdall eingetroffen sei. Am Ufer des Ak-köll machten wir Halt und warteten beim Sonnenuntergang und frühzeitigen Mückentanz auf Boote.
Nachdem wir uns des herrlichen, kühlen Abends ein paar Stunden erfreut und im Freien zu Abend gegessen hatten, hörten wir endlich das Geplauder der Seeleute und Rudergeplätscher, und dann glitt ein Geschwader von fünf Kähnen an unser stilles Ufer heran.
Sie führten uns und das Gepäck über den Ak-köll und ein Gewirr von anderen Seen und zuletzt auf den Fluß hinaus, Kona Abdall, dem alten Wohnorte Kuntschekkan Beks, wo ich 1896 gewohnt hatte, gerade gegenüber. Starke Arme ruderten uns gegen die Strömung, den Tarim aufwärts. Dank dem herrlichen Mondscheine konnte ich auch jetzt die Route aufnehmen. Es war eine jener reizenden, unvergeßlichen Mondscheinfahrten auf blankem Wasser, wie ich sie schon ein paarmal auf diesen friedlichen Wasserwegen gemacht hatte.
In später Nacht erreichte mein schnelles Fahrzeug unser früheres astronomisches Lager, wo unsere Hunde uns mit heftigem Gebell empfingen, das sich aber im nächsten Augenblick, als sie uns wiedererkannten, in Freudengeheul verwandelte.
[S. 86]
Am folgenden Morgen maß ich die Wassermenge des Flusses, die jetzt 156,2 Kubikmeter in der Sekunde betrug und die größte war, die ich je im Tarimbecken gefunden habe, aber zum Teil dem kalten, schneereichen Winter und dem ungewöhnlich dicken, spät aufgetauten Eise zuzuschreiben war.
Faisullah mußte ausführlich über seine Schicksale und Erfahrungen seit unserer Trennung bei den Ruinen von Lôu-lan berichten. Er war 17 Tage unterwegs gewesen und hatte mehrere unerwartete hydrographische Entdeckungen gemacht.
Um 10 Uhr abends kam wie ein Donnerschlag der „schwarze Sturm“ und fegte alles, was nicht sicher befestigt war, nach Westsüdwest. Die ganze Gegend war in diesen dunkeln, pfeifenden Sturm gehüllt, und der Mond, der eben noch so kalt und hell gestrahlt hatte, wurde bleich und matt. Das Licht in meiner Jurte brannte erst dann, als neue Filzdecken über ihre Wölbung gezogen und alle Löcher und Ritzen verstopft worden waren. Die Kosaken, die mit einer Messung bei Kum-tschappgan beauftragt gewesen, kehrten erst um Mitternacht zurück und waren von den spritzenden Wellen ganz durchnäßt.
Der nächste Tag ging verloren. Es war keine Möglichkeit, sich in diesem undurchdringlichen Sturme auf den Weg zu machen. Ich hatte alle meine Pläne im Tarim- und Lop-nor-Gebiete ausgeführt und von dem Leben in den Kähnen Abschied genommen und sehnte mich nun nach Tibet. Aber ich sollte Abdalls gastfreie Hütten nicht verlassen, ohne noch einen Sturm erster Klasse als Abschiedsgruß zu bekommen. Und dieser war eigensinnig; er dauerte 41 Stunden, und als er endlich aufhörte, war die Luft mit feinem, dichtem Staube erfüllt. Das einzige Nützliche, was wir tun konnten, war, drei vortreffliche Kamele zu kaufen; wir hatten jetzt im ganzen 17 Stück.
Drei langweilige Tagereisen, wieder bei Sturm, trennten uns von unserem Hauptquartier in Tscharchlik, wo wir am Abend des 8. April von einer ganzen Kavalkade von Reitern empfangen wurden, die uns zwischen den einzeln liegenden Gärten durch nach unserem Serai geleiteten.
[S. 87]
Jetzt folgte eine ebenso herrliche wie notwendige Ruhezeit in der kleinen Stadt am Rande der Wüste. Eigentlich aber kann ich es kaum Ruhezeit nennen, denn ich arbeitete auch jetzt vom Morgen bis zum Abend. Wir hatten unzählige Angelegenheiten zu ordnen und vorzubereiten, denn jetzt stand die schwerste Aufgabe des ganzen Reiseprogramms bevor: der letzte große Aufbruch nach Tibet.
Wir bewohnten ein außerordentlich nettes Serai in der Nähe des chinesischen Yamen. Von einer zwischen grauen Lehmmauern eingehegten Straße trat der Besucher in einen Hof mit Stallungen für unsere Pferde und Maulesel. Auf der entgegengesetzten Seite des Stallhofes führte eine Pforte in das große Gemach, in dem die Muselmänner wohnten; von hier ging ein Korridor nach der Wohnung der Kosaken. Eine kleine, neben letzterer liegende Kammer hatte Sirkin bereits als photographische Dunkelkammer eingerichtet.
Hinter diesem Hause erstreckte sich ein ziemlich großer, ummauerter Garten mit Maulbeerbäumen, Weiden und Pappeln, und hier wurde auf einem schattigen Platze die große mongolische Jurte für mich aufgeschlagen. An den Toren des Serai stellten wir nachts stets Wachen auf, und im Garten ebenfalls. Als Gesellschaft in meiner friedlichen Wohnung, in die keine neugierigen Blicke drangen, hatte ich Jolldasch und den großen schwarzen, bösen Jollbars (Tiger), der einst in Jangi-köll von einem wütenden wilden Eber so arg zugerichtet worden war. Er konnte keine Fremden leiden, nur gegen mich war er fromm wie ein Lamm.
Ein Hirsch, ein schönes, prächtiges Tier aus den Wäldern des Tschertschen-darja, den mir Dschan Daloi, der Gouverneur des Ortes, geschenkt hatte, war an einen Baum festgebunden; er war zahm wie ein Hund und wurde von mir mit Brot gefüttert (Abb. 219). Ich konnte ihm stundenlang Gesellschaft leisten, und wir wurden bald die besten Freunde. Er war jung eingefangen worden, und seine großen, braunen Augen suchten nicht mehr[S. 88] mit wehmütigen Blicken eine Gelegenheit, nach den friedlichen Verstecken der Wälder zurückzufliehen.
Nur die allerersten Tage ruhte ich wirklich in dem Lehnstuhle, den mir Islam in den Grotten von Temirlik gezimmert hatte. Ich widmete diese Zeit der gewaltigen Post, die mir der Dschigit Jakub kurz vorher aus Kaschgar überbracht hatte; erst kamen natürlich die Briefe aus meinem geliebten Elternhause, dann ganze Ballen von schwedischen Zeitungen und zuletzt einige neue Bücher von meinen Lieblingsschriftstellern, Selma Lagerlöf, Kipling und anderen.
Die Abende wurden zum Entwickeln benutzt; alle Platten, die in den letzten vier Monaten aufgenommen worden waren, wurden fertiggemacht und gaben gute Bilder. Sirkin war mir hierbei eine unschätzbare Hilfe. Er brachte die Dunkelkammer vor und nach ihrer Benutzung in Ordnung, wußte genau mit den verschiedenen Chemikalien Bescheid, überwachte das Trocknen und kopierte die Platten con amore. Außerdem besorgte er das meteorologische Observatorium, das seinen Platz auf dem Dache hatte, wo es vor der Sonne gut geschützt war. Was seine Kameraden betrifft, so hatte Tschernoff die Oberaufsicht über alles, was mit der Karawane, unserer täglichen Kost und meiner Küche zu tun hatte; er war mein Koch, während Tscherdon mein Kammerdiener war.
Doch schon am 12. April erhielten die beiden burjatischen Kosaken einen besonderen Auftrag auszuführen. Ein Punkt des Programms meiner letzten großen Reise war der Versuch, wenn irgend möglich, als Mongole verkleidet, nach Lhasa zu gelangen. Daher mußte eine vollständige Ausrüstung an mongolischen Kleidern, Utensilien, Kisten, Geschirr usw. angeschafft werden; mit einem Worte alles, was man bei den Mongolen, die die Wallfahrt nach der heiligen Stadt machen, zu finden pflegt. Alles dieses sollte Schagdur, der von allen Karawanenleuten allein in meine Pläne eingeweiht war, bei einem Besuche in Kara-schahr einkaufen. Damit er sich auf dieser langen Reise, zu der ihm ein Monat zur Verfügung stand, nicht gar zu einsam zu fühlen brauchte, gab ich ihm Tscherdon als Begleiter mit. Sie bekamen ausgeruhte Pferde, kannten beide den Weg, waren schon in Korla und Kara-schahr gewesen und waren alle beide so klug und zuverlässig, daß ich mich ihretwegen keinen Augenblick zu beunruhigen brauchte.


Die Tage verrannen gar zu schnell, aber jeder Tag hatte seine Arbeit. Ich tröstete mich damit, daß es für das Gebirge noch zu früh sei; sogar hier unten fing das Grün jetzt erst an auszuschlagen, im Hochgebirge würde es bis zum Aufsprießen des Grases wenigstens noch sechs Wochen dauern. Unterdessen mußten unsere Tiere ruhen, fressen und zu den ihnen[S. 89] bevorstehenden schweren Strapazen Kräfte sammeln. Sie erhielten Kamisch und Mais in Menge und wurden von ihren Knechten mustergültig gepflegt. Turdu Bai war der Herr der Kamele und stand für ihr Wohlergehen ein. Die Kerntruppe der Karawane wurde mit zwanzig neuen Kamelen, die Islam Bai in Tscharchlik kaufte, verstärkt. Als wir schließlich aufbrachen, hatten wir nicht weniger als 39 Kamele, unter denen jedoch drei Junge waren. Das letzte von diesen wurde am 6. Mai geboren und beinahe unmittelbar darauf von uns in Augenschein genommen. Das arme Kleine konnte kaum auf seinen langen, zitternden Beinen stehen und betrachtete mit neugierigen, aufmerksamen Blicken die unruhige Welt, die es umgab. Binnen weniger Tage sprang es jedoch ganz lustig und heimisch auf dem Stallhofe umher und wurde bald der Liebling aller. Es wurde mit besonderer Sorgfalt gepflegt und begleitete uns auf dem größten Teile der Reise durch Tibet, und als es starb, hatte es seine beiden Kameraden längst verloren (Abb. 220).
Die Kamele wurden tagsüber auf die Weide, bei Sonnenuntergang aber nach einem offenen Platze vor unserem Hofe geführt. Dort erhielten sie als Abendfutter Mais, der ihnen sackweise auf Matten geschüttet wurde.
Die Pferde und Maulesel fraßen im Stallhofe aus ihren Krippen. An heißen Tagen nahmen sie ein Bad in einem großen Teiche, der inmitten dichtbelaubter Weiden vor der Eingangspforte des Serai lag, und hier versammelten sich stets Scharen von Reisenden und Neugierigen (Abb. 221).
Der Unterhalt der immer größer werdenden Karawane wurde ziemlich teuer. Alle die neuen Diener, die nach und nach in meine Karawanenliste eingeschrieben wurden, sollten beköstigt werden und Lohnvorschuß erhalten. Täglich wurde mindestens ein Schaf geschlachtet, und Massen von Reis, Brot und Eiern wurden aufgegessen. Andererseits aber war es ein großer Vorteil, daß alle, Menschen und Tiere, die jetzt ins Feuer sollten, Kräfte für die schweren Tage sammelten.
Schon bei unserer Rückkehr nach Tscharchlik hatte Islam Bai den Proviant der ganzen Karawane für eine etwa zehnmonatige Reise angeschafft. Er bestand aus Reis, Mehl und Talkan (geröstetes Mehl, das, mit Wasser angerührt, als Suppe gegessen wird). Später sollte eine ganze Schafherde gekauft werden; im übrigen würde der Ertrag der Jagd so reich werden, daß es uns, auch abgesehen von den Schafen, nicht an frischem Fleische zu fehlen brauchte.
Für mich selbst hatte ich ein paar hundert Konservenbüchsen, die mir Oberst Saizeff in Osch besorgt hatte; sie wurden mir jedoch bald so zuwider, daß die Kosaken den größeren Teil davon nehmen mußten. Eingemachte Früchte, Gemüse und Suppen blieben jedoch die ganze Zeit genießbar.
[S. 90]
Für die Kamele und die Pferde wurde ein großer Vorrat Mais in Säcken mitgenommen. Es handelte sich nur darum, wie diese schwere Last transportiert werden sollte. Ich dachte daran, zu diesem Zwecke Esel zu kaufen; ein Esel kostet in Tscharchlik nur 10 Sär (30 Mark). Aber eine hinreichend große Eselkarawane erforderte mindestens ein halbes Dutzend Treiber, und wenn dann die armen Tiere zusammengebrochen waren, würden wir alle diese Männer nutzlos, aber zu großem Schaden für unseren Proviant, auf dem Halse haben. Statt dessen beschloß ich, 70 Esel auf zwei Monate zu mieten. Sie kosteten freilich je 5 Sär den Monat, also ebensoviel, wie wenn wir sie gekauft hätten, aber wir hatten den Vorteil, daß wir nun von allen Sorgen um den Transport befreit waren und es Sache der Eseltreiber war, wie sie wieder nach Tscharchlik zurückkamen. Das Geschäft wurde mit dem alten Dowlet Karawan-baschi aus Buchara abgeschlossen, der sich vorzüglich bewährte, aber selbst wenig Gewinn davon hatte, da beinahe alle seine Esel dabei draufgingen.
Am 28. April traf mein alter Diener Mollah Schah aus Tschertschen ein. Er sollte durchaus mit auf diese Reise, denn er hatte an Littledales Zug nach dem Tengri-nor und Ladak teilgenommen und kannte daher die Hilfsquellen des Landes genauer als alle anderen.
Ich mußte unaufhörlich Besuche von Dienstsuchenden und anderen in meinem Garten empfangen. Bald kam dieser, bald jener mit der Bitte, mich begleiten zu dürfen. Aber mein Stab war schon ausgewählt, und wir wollten nicht zuviele Leute haben. Wir waren sogar der Meinung, daß einige der angestellten Männer vom Arka-tag, sobald alles in Ordnung war und die Tiere sich an ihre Lasten und an die Marschordnung gewöhnt hatten, zurückgeschickt werden könnten. Der Vater des toten Aldat suchte mich auch auf und erhielt ein Geldgeschenk. Dschan Daloi, der Amban von Tscharchlik, befand sich auf seiner Dienstreise nach Kara-schahr; aber sein kleiner sechsjähriger Sohn besuchte mich oft in meiner Jurte. Er zeigte stets in seiner Rede und seinem Benehmen den feinen, eleganten Umgangston, der gebildete Chinesen kennzeichnet. Ich schenkte dem Knaben Süßigkeiten, illustrierte Zeitungen und allerlei Kleinigkeiten, die sein großes Entzücken erregten, und er versäumte nie, mir zum Dank Obst mitzubringen oder meinen Pferden einige Bündel frischen Klee zu senden. Anfang Mai starb er an den Blattern; der arme Vater kam einen Tag zu spät heim, um in der Todesstunde bei ihm sein zu können.
Das Wetter war herrlich. Es stürmte beinahe unaufhörlich; dadurch blieb die Luft frisch und kühl. Die Atmosphäre war voller Staub, der die Sonne verhüllte. Abends war es manchmal so kalt, daß ich[S. 91] das Innere der Jurte mit einem Kohlenbecken erwärmen mußte. Am Tage aber war es mir ein Genuß, dem Heulen des Windes in den Maulbeer- und Pflaumenbäumen zuzuhören; ich weiß nicht, wie es kam, aber es war mir stets besonders behaglich zumute, wenn es recht toll stürmte.
Anfang Mai wurde es jedoch fühlbar heiß. Am 1. Mai hatten wir +32,7 Grad im Schatten; die Luft war klar und ruhig, und im Süden glänzten die Firnfelder auf den höchsten Gipfeln des Astin-tag. Heimtückisch lockten jene schönen Berge, die dem größeren Teile meiner Karawane das Leben kosten sollten.
Doch die Zeit verging, und der Tag des Aufbruchs nahte heran. Das ganze Gepäck wurde in Säcken und Kisten untergebracht. Am 22. April standen fünfzehn Kamellasten verschnürt und festgebunden auf ihren Saumleitern und brauchten nur noch auf ihre Träger hinaufgehoben zu werden. Einige Tage später war die ganze Last auf dem Seraihofe bereit (Abb. 222). Da lagen sie in langen Reihen, diese schweren Ballen, die quer durch Tibet getragen werden sollten. Bei ihrem Anblick war ich starr, aber Turdu Bai versicherte, daß die Lasten durchaus nicht zu schwer seien und überdies auch mit jedem Tage an Gewicht verlieren würden. Dort sah man die fest auf ihre Leitern gebundenen Reissäcke, in einer anderen Reihe stand der Mais, in einer dritten das gebrannte Mehl und mehrere Lasten mit eigens für uns gebackenem Brote. Große Ballen enthielten Pelze für die Leute und weißen Filz zu Mänteln für die Kamele. Lange Reihen von Kisten bargen meine persönliche Habe, Reserveinstrumente, Kleidungsstücke, Bücher, Konserven usw.
Um jedoch die Last nicht schwerer zu machen, als sie notwendigerweise sein mußte, hatte ich gleich nach meiner Ankunft im Hauptquartier alles ausgesondert, was sich entbehren ließ, darunter auch die Sammlungen an Gesteinproben, Skelette, Pflanzen und die archäologischen Funde aus Lôu-lan. Von allem diesen, das acht tüchtige Kamellasten ausmachte, wollten wir uns befreien. Es sollte nach Kaschgar geschickt werden und bei Generalkonsul Petrowskij in Verwahrung bleiben.
Doch wem sollte ich diese wichtige Sendung anvertrauen? Sollte ich es von den Chinesen besorgen lassen? Nein, dies wagte ich nicht. Ich wollte schon an Chalmet, den Aksakal von Korla, schreiben, als das Rätsel eine sehr einfache, aber höchst unerwartete Lösung erhielt. Islam Bai suchte mich eines Abends, als ich allein in meinem Zelte war, auf und bat, die Sammlungen nach Kaschgar bringen zu dürfen. Ich sprach meine Verwunderung aus, daß er mich gerade jetzt, da die größten Schwierigkeiten und Gefahren begannen, verlassen wollte, doch er antwortete ohne[S. 92] Bedenken „ja“. Er gab als Grund an, daß er sich alt und müde fühle und fürchte, mir nicht von so großem Nutzen, wie ich gedacht, sein zu können. Es tat mir freilich weh, mich von ihm zu trennen, aber ich hatte gemerkt, daß er die Kosaken nicht ausstehen konnte und die Muselmänner, unter denen er übrigens stets exemplarische Disziplin gehalten hatte, sehr hart behandelte. Ich verdankte ihm viel und wollte ihm auch jetzt einen Beweis meines Vertrauens geben. Daher stellte ich für ihn folgendes Programm auf. Er sollte die Sammlungen in zwei Monaten über Korla, Kutschar und Aksu nach Kaschgar führen, bis Korla auf Kamelen, dann auf Arben, und für alle diese Städte gab ich ihm Empfehlungsbriefe mit. Seinen rückständigen Lohn, 300 Rubel, erhielt er in Gold, außerdem sollten ihm die Reisekosten für ihn selbst und der Transport vergütet werden.
Von Kaschgar sollte er nach Osch heimreisen und dort fünf Monate bleiben, dann aber wieder nach Kaschgar zurückkehren und einen Auftrag ausführen, über den ihm Herr Petrowskij genauere Auskunft erteilen würde. Es handelte sich nämlich darum, mir eine größere Geldsumme und meine dann ganz gewiß sehr große Post nach Ladak zu bringen. Dieses Vertrauen schmeichelte ihm und versöhnte uns beide mit der Bitterkeit der Trennung.
Der alte Faisullah sollte ihn nach Kaschgar begleiten. Er war müde und fürchtete die Gebirgsluft. Er hatte mir zwei Jahre treu und mustergültig gedient und erhielt eine große Extrabelohnung in Silber nebst einem Reitpferd. Die anderen versuchten vergeblich, ihn zu überreden, uns zu begleiten, denn alle hielten viel von ihm, während dagegen Islams Ausscheiden aus der Karawane nur Befriedigung erregte.
Am 5. Mai zogen sie mit ihren acht Kamelen, drei Pferden und drei bis Korla gemieteten Leuten ab. Es stürmte an jenem Tage außerordentlich heftig, und schon da, wo das Gäßchen auf einen offenen Platz mündete, verschwand die Karawane in dichten Staubwolken. Ich hatte während des letzten Jahres nicht viel von Islam Bai gesehen, denn er war stets, während ich mich auf Reisen befunden hatte, als mein Karawan-baschi im Hauptquartier geblieben. Niemand hatte sich bei mir über ihn beklagt, aber nun, da er fort war, merkte man bald den Unterschied. Die Stimmung wurde heiter und gemütlich, alle waren vergnügt und zufrieden, und jeder ging mit Freude an seine Arbeit.
Islam Bai nahm eine gewaltige Post von mir mit. Ich hatte einen 216 Seiten langen Brief — ein ganzes Buch — an meine Eltern und außerdem noch ausführliche Briefe an König Oskar und den Kaiser von[S. 93] Rußland geschrieben. Ich hatte auch an viele meiner Freunde in der Heimat geschrieben, namentlich an Adolf Nordenskiöld. Er empfing meinen Brief einige Tage vor seinem Tode. Er war einer von denjenigen Freunden, die man nur durch den Tod verliert.
Ein wichtiges Schreiben, das Mr. Macartney in Kaschgar befördern sollte, war an Lord Curzon, den Vizekönig von Indien, adressiert. Ich teilte ihm darin mit, daß ich zu Ende des Jahres wahrscheinlich in Leh in Ladak einträfe, und bat ihn, in dieser Stadt eine Summe von 3000 Rupien aufnehmen zu dürfen. Ich erwähnte auch die Möglichkeit eines kurzen Besuches in Indien und bat, in diesem Falle einen der Kosaken mitbringen zu dürfen.
Der Weg, den ich wählte, um auf das tibetische Hochland hinaufzugelangen, führt durch das enge Tal des Tscharchlik-su und ist vor mir noch nie von einem Europäer versucht worden. Dieser Weg ist aber für Kamele absolut unmöglich und selbst für Packpferde sehr schwer. Wir mußten daher die Sache auf andere Weise einrichten. Die große, schwerbeladene Karawane sollte von Tschernoff, Tscherdon und Turdu Bai über Tattlik-bulak und Bag-tokai nach dem Westufer des unteren Kum-köll geführt werden, wohin ich mich, nur von wenigen Dienern begleitet, auf dem näheren, aber schwierigeren Wege durch das Tal begeben wollte.
Am 8. Mai waren wir reisefertig (Abb. 224). Alle Lasten, einige achtzig, standen in der Gasse vor dem großen Tore aufgereiht und wurden nun schnell auf die Rücken der wartenden Tiere gelegt. Es war eine gewaltige Karawane, die größte, die ich je zuvor unbekannten Geschicken entgegengeführt hatte, die größte, die je unter Führung eines Europäers in das Innere von Tibet eingedrungen ist. Sie wurde in verschiedenen Abteilungen abgeführt und nahm den ganzen Weg nach dem Yamen ein. Zuerst schwankten meine Kisten im Sonnenbrande fort, dann die Sachen der Leute, die Zelte und das Boot, und darauf die verschiedenen Proviantkarawanen, jede Abteilung mit ihren besonderen Führern.
Wieviel leichter ist es doch für einen Seefahrer oder eine Expedition, die nicht weit bis zur Küste hat, mit großen Sammlungen heimzukehren! Man braucht sie nur einzuschiffen. Im inneren Asien dagegen muß jeder Gegenstand, den man zu Anfang der Fahrt erwirbt, Tausende von Kilometern unter außerordentlich ungünstigen Verhältnissen auf Pferden oder Kamelen mitgeschleppt werden. Die Lasten müssen jahrelang jeden Morgen auf- und jeden Abend abgeladen werden. Ich verdanke es nur dem Entgegenkommen des Dalai-Lama, daß die während dieser letzten Reise in Tibet gemachten Sammlungen überhaupt aus dem Lande gebracht werden konnten.
[S. 94]
Bisher hatte ich in der großen, geräumigen Mongolenjurte gewohnt, die jetzt aber von der Karawane mitgenommen wurde, während ich in die kleine, nur aus einem Holzringe, etwa zwanzig Stangen und einigen weißen Filzdecken bestehende Jurte übersiedelte. Sie war bis Ladak meine Wohnung. Als der Umzug vor sich ging, fanden wir einen großen, abscheulichen, strohgelbgrauen Skorpion unter einer der Kisten; er hatte mir gewiß die ganze Zeit über in der Jurte Gesellschaft geleistet, mir aber merkwürdigerweise nichts zuleide getan. Einer der Leute dagegen wurde, als er den Pferden Stroh gab, von einem Skorpion gestochen. Er mußte ein paar Tage liegen, ehe der Schmerz aufhörte. —
So setzte sich denn die Karawane in Gang. Zwei von den jungen Kamelen liefen ungebunden mit ihren Müttern, die ihre Kinder ängstlich im Auge behielten. Das jüngste Füllen dagegen, das erst ein paar Tage alt war, wurde sorgfältig in Filzdecken gepackt und zwischen zwei Kisten auf mein altes Reitkamel gelegt. Die Mutter ging unmittelbar hinter ihm; sie brüllte unruhig und suchte ihr Junges, bis sie es in seinem Versteck ausfindig gemacht hatte. Die Pferde waren von Fett und Wohlergehen halb wild geworden; sie machten draußen auf der Straße einen entsetzlichen Spektakel, schüttelten die Lasten ab und liefen wild durcheinander. Doch sie trugen nur Proviantsäcke, und diese konnten eine solche Behandlungsweise vertragen.
Es war ein großartiger Anblick, als dieser gewaltige Zug unter Glockenklang, Geschrei, Rufen, Brüllen und Wiehern von unserem ruhigen Serai und aus dem Schatten der Weiden fortzog. Nur wenige Tiere sollten grüne Gärten wiedersehen und wieder im Stalle in ihren Ständen Mais fressen. Wie fühlte ich mich jetzt reich als Besitzer all dieser Herrlichkeit; wie mächtig erschien mir dieses Werkzeug, mit welchem ich, wenn ich es richtig anwandte, große Teile von Tibet der Wissenschaft würde erschließen können! Und doch überkam mich Wehmut, als ich den bunten, gewaltigen, lebensfrohen Zug betrachtete. Nie haben die Glocken der Kamele in so hohem Grade wie jetzt zum Begräbnis, nein, zu einer ganzen Reihe von Begräbnissen geläutet! Ich ahnte, daß dieser Weg für die meisten ein Todesweg werden würde, ein Weg, der Tränen kostete, und daß die Route auf der Karte nicht zufällig mit Rot eingetragen werden würde, — sie kostete Blut!
Wie elend und armselig sollte diese prächtige Karawane am Ende des Jahres aussehen, wie verringert an Zahl und geschwächt an Kräften! Nur ein Fünftel bestand die Probe. Sogar ein paar der Männer starben, und alle anderen, ich nicht zum wenigsten, waren kraftlos und erschöpft, als wir Tibet durchzogen hatten. Es wurde die anstrengendste, schwerste[S. 95] Reise, die ich je gemacht habe. Bei mehr als einer Gelegenheit war ich dem Tode näher als damals, als ich 1895 in der Wüste Takla-makan vor Durst verschmachtete; damals aber, in der Wüste, dauerte das Leiden nur ein paar Wochen; hier in Tibet aber gehörten Leiden zur Tagesordnung, nachdem die wirklichen Schwierigkeiten einmal angefangen hatten. Ich mache lieber noch zehn Reisen durch die Wüste Takla-makan als noch einen solchen Zug durch Tibet!
Tschernoff führte den Oberbefehl über die Pferde und hatte bestimmte Befehle, wie er marschieren sollte. Turdu Bai war Chef der Kamelkarawane. Sie sollten sich erst nach Abdall begeben und dann auf dem bekannten Wege ins Gebirge hinaufziehen. In Abdall sollten sie 50 Schafe kaufen und auf Tscherdon warten, der von Kara-schahr dorthin unterwegs war. Sie nahmen den Hirsch mit; er folgte den Kamelen treu wie ein Hund und wurde mit größter Fürsorge behandelt. Sieben Hunde, unter ihnen Malenki und Maltschik, die eben mit in der Wüste Gobi gewesen waren, gehörten mit zum Zuge. Alles ging gut, und der Leser wird sie alle nach etwa einem Monat am Ufer des Kum-köll wiedertreffen.
Jetzt lag unser Serai öde und still da; die Höfe standen leer, und wir fühlten uns einsam und verlassen. Sirkin war jetzt mein Kammerdiener und Li Loje mein Koch. Mollah Schah besorgte unsere Pferde. Nur diese drei Leute hatte ich bei mir, nebst Jolldasch, der nie von meiner Jurte wich.
Jetzt mußte nur noch die Eselkarawane auf den Marsch gebracht werden, die über Owras-sai und Kara-tschokka gehen und bei Bag-tokai mit der großen Karawane zusammentreffen sollte. Am Morgen des 13. war der alte Dowlet Karawan-baschi fertig und hatte seine 70 Esel mit Mais beladen und seine zehn Untergebenen mit Proviant und Pelzen ausgerüstet. So zog nun auch diese Abteilung der Karawane, der eigentliche „Train“, ins Gebirge hinauf.
Jetzt waren unsere Truppen geteilter als je zuvor. Ich selbst lag in Tscharchlik, die Karawane war auf dem Wege nach Abdall, die Esel zogen nach dem Aftin-tag, Schagdur war noch nicht aus Kara-schahr zurückgekehrt, und Islam Bai würde mitten in der ärgsten Sommerhitze mit meinen Sammlungen in Kaschgar eintreffen. Ich kam mir vor wie ein Feldherr, der alle Fäden in seiner Hand halten muß. Es galt jetzt, so mit den Truppen zu manövrieren, daß alles klappte und die Berechnungen stimmten, wenn die rechte Zeit da war.
Am 14. Mai traf um die Mittagzeit ein Mann aus dem Dorfe Lop ein und brachte gute Nachrichten von Schagdur, der mir jedoch schrieb,[S. 96] daß seine Pferde sehr abgehetzt seien, weshalb Sirkin sich rüstete, um seinem Kameraden mit drei frischen Pferden entgegenzuziehen. Als er gerade fortreiten wollte, ritt die kleine Karawane schon in den Hof ein. Nun waren alle unsere Besorgnisse wegen der Burjaten mit einem Schlage beendet. Tscherdon hatte meinen Befehl in Tscheggelik-ui erhalten und sich schleunigst im Kahne nach Abdall begeben.
Schagdur hatte seinen Auftrag natürlich in vortrefflicher Weise ausgeführt. Er brachte die ganze mongolische Ausrüstung mit, deren wir für unsere Pilgerfahrt bedurften, und obendrein noch einen wirklichen, echten Lama, Schereb Lama, der 27 Jahre alt und aus Urga gebürtig war, aber einem Tempel vor den Toren von Kara-schahr angehörte (Abb. 223). Der Lama trug sein rotes Priestergewand, das eigentlich wie ein langer, durch einen Gürtel zusammengehaltener Schlafrock aussah, und auf dem Kopfe ein chinesisches rundes Käppchen. Ich kam ihm sehr freundlich entgegen, damit er sich vom ersten Augenblick an bei uns heimisch fühlen sollte, und begann sofort, meine eingerosteten Kenntnisse der mongolischen Sprache wieder aufzufrischen. Es dauerte auch nicht viele Wochen, bis ich mit dem Lama, wie wir ihn einfach nannten, ziemlich fließend sprechen konnte. Er war die interessanteste Persönlichkeit unserer reisenden Gesellschaft; der Leser wird bald seine Bekanntschaft machen. Mit mir stand er schon nach wenigen Tagen auf sehr vertrautem Fuße und kam stets zu mir, sobald er etwas auf dem Herzen hatte. Er war bereit, sein Leben für mich zu lassen, und es ist wirklich ein Wunder, daß er es um meinetwillen nicht verloren hat.
Schagdur hatte noch zwei Reisegefährten, alte Bekannte von uns, mitgebracht. Der eine war Ördek, der den Tempel in Lôu-lan entdeckt hatte, der andere Chalmet Aksakal von Korla. Es war ein recht eigentümliches, interessantes Quartett, das jetzt die Bevölkerung unseres leeren Serai vergrößerte, und die Stimmung wurde wieder heiter. Jeder von den vier Gästen mußte vorbringen, was er auf dem Herzen hatte. Zuerst berichtete Schagdur über seine Mission, zeigte seine Abrechnung und lieferte den Rest der erhaltenen Summe wieder ab. Er brachte ungefähr die Hälfte wieder, — ein anderer Asiat hätte dieses Geld natürlich in seine eigene Tasche gesteckt, aber Schagdur war ein ehrlicher, redlich denkender Mensch. Schon der Gedanke zu stehlen wäre ihm ganz absurd vorgekommen.

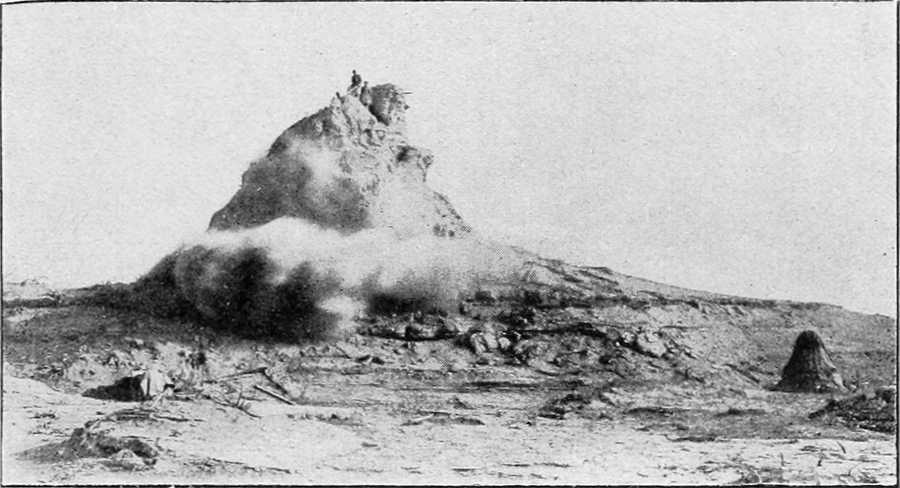
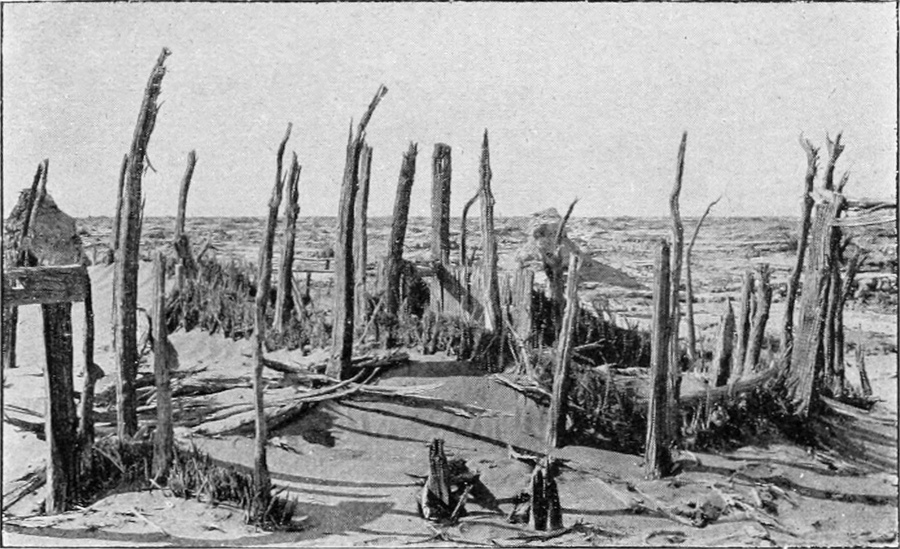

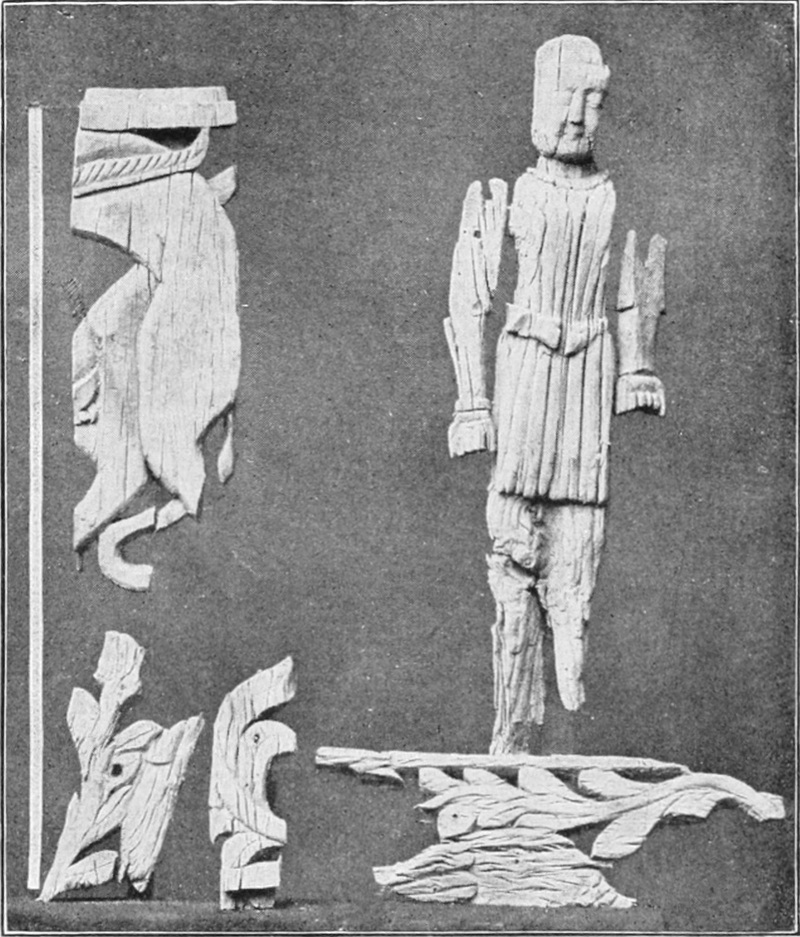
Ördek war gesund und munter und bat aufs flehentlichste, mitkommen zu dürfen, gleichviel wohin und unter welchen Bedingungen. Als er im vorigen Jahre um seine Entlassung bat, hatte er als Grund eine bösartige Krankheit angegeben. Jetzt versicherte er, dies sei gelogen[S. 97] und der wahre Grund der gewesen, daß Islam ihn mit dem Tode bedroht habe, wenn er es wagen würde, sich in Temirlik sehen zu lassen.
Jetzt, da Islam uns verlassen hatte, zog sich ein Unwetter über ihm zusammen. Ördek aber wurde unter denselben Bedingungen wie früher fest angestellt, mußte sich alles Nötige besorgen und erhielt den Befehl, den Eseln nachzueilen und mit ihnen nach dem Kum-köll zu ziehen.
Der Lama war im vorigen Winter von einer Pilgerfahrt nach Lhasa zurückgekehrt, wo er eine Zeitlang in einigen Tempeln die heiligen Bücher studiert hatte. Auf der Rückreise hatte er einen anderen Lama aus Kara-schahr als Genossen gehabt und dabei in Zaidam Kosloffs Expedition gesehen. Dies war das einzige Mal auf der ganzen Reise, daß ich etwas von meinem russischen Freunde hörte.
Schereb Lama war sofort außerordentlich geneigt gewesen, die burjatischen Kosaken nach Lhasa zu begleiten, und hatte ihnen so viel von den Herrlichkeiten dieser Stadt erzählt, daß Schagdur vor Sehnsucht brannte, dorthin zu kommen. Der Lama war aber mißtrauisch gewesen und hatte gefragt, ob auch ein „Russe“ mitwolle, denn dann könne er sich mit der Sache nicht befassen, — das würde ihm das Leben kosten. Schagdur hatte beteuert, daß kein Russe mitgenommen würde. Der Lama erklärte mir nun, daß er mich gern überallhin begleiten wolle, — nur nicht nach Lhasa, und daß er mit einem Lohne von zwei Jamben für die ganze Zeit zufrieden sei. Er erzählte dann allerlei von der heiligen Stadt und der Wallfahrt und sagte, daß Lhasa schon in einer Entfernung von zehn Tagereisen von Reitern und Grenzaufsehern umgeben sei, die jede ankommende Karawane, ja jeden einzelnen Reiter gründlich untersuchten. Alle würden auf diese Weise angehalten, und erst nachdem ihre Pässe in Lhasa geprüft und von dort Bescheid gekommen sei, dürften sie frei passieren. Die große Mongolenkarawane, die voriges Jahr an unserem Lager in Temirlik vorbeigezogen war, sei zehn Tage aufgehalten worden, weil man in Erfahrung gebracht, daß unsere Karawane an der Grenze des Landes der Zaidammongolen lagere, und man wahrscheinlich befürchtet habe, daß sich irgendein Unbefugter mit ihr einschleichen wolle.
Darauf kam die Reihe an Chalmet Aksakal. Zuerst fragte ich ihn, ob er mir einen großen Dienst erweisen wolle, was er selbstverständlich bejahte. Er solle mir zehn Jamben Silber leihen, nach damaligem Silberwert etwa 2000 Mark. Bald darauf reihte er die Silberbarren in meinem Zelte auf. Ohne diese Verstärkung meiner Kasse würde ich in Südtibet in eine äußerst unangenehme Lage geraten sein. Nach meinem[S. 98] Diktat schrieb er einen Brief in türkischer Sprache an Herrn Petrowskij, welches Schreiben von mir unterzeichnet wurde und als Wechsel für besagte Summe galt, der auch rechtzeitig eingelöst wurde.
Nun war also endlich alles klipp und klar, und wir konnten am nächsten Morgen, 15. Mai, aufbrechen. Daraus sollte jedoch nichts werden. Um 5 Uhr fing es in außergewöhnlicher Weise an zu gießen, und der Donner rollte dumpf in den Bergen — ein passender Hintergrund zu der traurigen Überraschung, die mir an diesem Abend bevorstand. Neue Wolken ballten sich über dem armen Islam Bai zusammen!
Chalmet Aksakal beklagte sich darüber, daß Islam in Korla 27 Sär von ihm entliehen und ihn, als er das Geld zurückgefordert, beschimpft und verhöhnt habe. Jetzt behauptete er auch, wohlbegründete Veranlassung zu der Vermutung zu haben, daß auch ich bestohlen worden sei. Ich begriff gar nicht, was er meinte. Islam Bai? Nein, das war nicht möglich! Er, der fünf Jahre lang mein Geschick geteilt hatte, mit mir in der Wüste beinahe umgekommen war und so viele Beweise meines Vertrauens und meiner Zuneigung erhalten hatte, er, der so viele Geschenke bekommen hatte und höheren Lohn erhielt als alle anderen und der die goldene Medaille für Treue und Redlichkeit trug!
Doch schon bei der ersten vorsichtigen Untersuchung in Tscharchlik kam allerlei an den Tag. Schagdur hatte Islam Bai in Temirlik für 165 Sär Gold von Goldgräbern aus Bokalik kaufen sehen, sich aber keine Einmischung erlaubt, weil er überzeugt war, daß es auf meinen Befehl geschehen sei. Sirkin und Ördek hatte Islam um 16 und 10 Sär betrogen, sie hatten mir aber nicht durch Klagen lästig fallen wollen. Man könnte sagen, daß die Wahrheit durch reinen Zufall ans Licht gekommen sei, wenn man nicht darin vielmehr die Strafe der himmlischen Gerechtigkeit sehen müßte. Chalmet Aksakal war brieflich beauftragt worden, Zucker u. dgl. zu kaufen und uns zu schicken. Als ich in das Hauptquartier zurückkam und die Rechnung sah, fand ich sie sehr hoch. Islam verstand es damals, mir zu beweisen, daß sie um 23 Sär zu hoch war. Ich hatte mir darauf Chalmet Aksakals Bruder, einen Tscharchliker Kaufmann namens Osman Bai, kommen lassen, hielt ihm eine niederschmetternde Rede und sagte, daß sein Bruder sich als unredlicher Mensch bewiesen habe. Osman verteidigte ihn und bat mich himmelhoch, doch nicht der Verleumdung Glauben zu schenken. Da ich mich nicht überzeugen ließ, hatte Osman einen Eilboten nach Korla geschickt und seinem Bruder geraten, unverzüglich zu kommen, da hier Böses gegen ihn im Werke sei. Er kam nun auch mit Schagdur. Als sie Islam bei Tikkenlik begegneten, war er sichtlich unangenehm berührt gewesen und[S. 99] hatte gesagt, er sei beauftragt, den Kosaken mitzuteilen, daß ich meinen Plan geändert hätte und sie über Abdall und Tschimen reiten müßten, wenn sie mich finden wollten. Hätten sie ihm geglaubt, so würde ich sie erst Anfang Juni am Kum-köll getroffen haben. Doch Islams Plan, der darauf angelegt war, ihm bis Kaschgar Vorsprung zu verschaffen, scheiterte an der Pflichttreue der Burjaten. Sie wußten, daß sie sich ausschließlich nach meinen eigenen schriftlichen oder mündlichen Befehlen zu richten hatten, und da ich glücklicherweise ein paar Tage vorher mit der chinesischen Post einen Brief an Schagdur geschickt hatte, kehrte sich dieser nicht an Islams intrigante Reden und begab sich direkt nach Tscharchlik.
Infolge der vorläufigen Untersuchung, die jetzt angestellt wurde, verzögerte sich unsere Abreise um ein paar Tage. Als wir endlich aufbrechen konnten, begleitete uns der Aksakal noch auf der ersten Tagereise. Als er nach Korla zurückkehrte, nahm er ein Schreiben an den Generalkonsul mit, der Islam Bai, welcher russischer Untertan war, auf mein Ersuchen gleich bei seiner Ankunft in Kaschgar verhaften und alle seine Effekten untersuchen lassen sollte. Alles darunter befindliche chinesische Silbergeld und das rohe Gold sollten mit Beschlag belegt werden.
Doch ehe ich erzähle, wie es Islam in Kaschgar ging, will ich zeigen, daß er das Schicksal, das ihn traf, in jeder Hinsicht verdient hatte. Als wir in Kum-köll mit der Karawane zusammentrafen, wurden alle meine Diener einzeln verhört. Jeden hatte er um größere oder kleinere Summen betrogen; nur Tschernoff hatte sich nicht überlisten lassen. Im ganzen ließen sich etwa 12 Jamben nachweisen, die er den Eingeborenen nach und nach in größeren oder kleineren Beträgen abgenommen hatte, und mir hatte er durch gewisse Geschäftspraktiken 9 Jamben veruntreut, einen großen Teil davon bei den letzten Kamelankäufen.
Schon in Jangi-köll hatte ich einen großen Vorrat von Tschapanen, Pelzen und Stiefeln kaufen müssen, die unseren Dienern geschenkt werden sollten. Die Sachen waren allerdings unter sie verteilt worden, aber Islam hatte sich dafür bezahlen lassen und den Gewinn in seine Tasche gesteckt.
Es ist seltsam, daß ich nie gemerkt hatte, wie ich täglich so gemein bestohlen wurde; aber es war doch auch wieder erklärlich. Erstens wurden alle Auszahlungen aus meinen Geldkisten ordnungsmäßig gebucht, und direkter Kassendiebstahl war nie vorgekommen; dazu war Islam viel zu klug. Da aber alle größeren Beträge für den Ankauf von Proviant, Kamelen und Pferden und die Löhne der Leute durch Islams Hände[S. 100] gingen, hatte er Gelegenheit, den Lieferanten weniger zu geben, als sie zu fordern berechtigt waren. Die guten Eingeborenen waren in weit höherem Grade als ich die Geschädigten gewesen, daher fehlte auch nie etwas in meiner Reisekasse; ich wußte stets, wieviel ausgegeben wurde und wieviel noch da war.
Dann findet man es wohl unbegreiflich, daß sich keiner der Betrogenen bei mir beklagt hat, und auch ich wundere mich noch heute darüber, daß dies nicht geschehen ist. Aber Islam war ein großer starker Kerl, der es verstanden hatte, sich bei den Muselmännern in großen Respekt zu setzen. Sie fürchteten ihn wie einen asiatischen Despoten, wagten nicht zu murren, schwiegen und nahmen, was er ihnen gab, um so mehr, als er, wie ich am Kum-köll erfuhr, drohte, dem, der bei mir zu klagen wagte, den Schädel einzuschlagen. Deshalb nahmen sie sich hübsch davor in acht und fanden sich still und ergeben in ihre ungerechtfertigten Verluste. Er hielt sie durch seine bloße Gegenwart in hypnotischer Angst, und erst jetzt, da er fort war, kam die Wahrheit zum Vorschein. Ja, jetzt kam alles an den Tag! „O Gott, wie viele haben seinetwegen weinen müssen“, hieß es.
Auf der Fähre und in der Tschertschenwüste, den einzigen Reisen, auf denen ich ihn unter meiner eigenen Kontrolle hatte, war er derselbe wie früher, derselbe ruhige, besonnene, treue Diener wie auf der Reise durch Asien in den Jahren 1893–97. Nachher nahm ich ihn nicht mit auf große Exkursionen, weil ich glaubte, beruhigt sein zu können, wenn er die Aufsicht über das Hauptquartier führte. Und wenn ich von den verschiedenen Touren dorthin zurückkehrte, beklagte sich keiner; die beste Ordnung herrschte überall. Gerade dieser Umstand, daß wir meistens an verschiedenen Orten waren, macht es zum großen Teile erklärlich, daß ich von den Unredlichkeiten nichts merken konnte, und es würde mir überdies auch nie eingefallen sein, Islam Bai in Verdacht zu haben. Dazu hegte ich viel zu großes Vertrauen zu ihm; von diesem Gesichtspunkt aus war ich in nicht geringem Maße an seinem Unglück schuld.
Psychologisch war mir die Ursache seines Falles bald verständlich. Während der Reise nach Peking war er in meiner Karawane drei Jahre lang stets der Erste gewesen. Vom einfachen Arbeiter bei den Pferdekarawanen zwischen Osch und Kaschgar hatte ich ihn zum Führer und Karawan-baschi erhoben, und er hatte sich aus reiner Anhänglichkeit aufs glänzendste bewährt. Auch jetzt hatte er mir anfänglich am nächsten gestanden. Doch mit der Ankunft der Kosaken trat eine andere Ordnung ein. Ich schätzte sie mehr, und ihre Gesellschaft war mir lieber als die[S. 101] Islams. Alle Beschäftigungen in meiner unmittelbaren Nähe wurden den Kosaken übertragen, während Islam nur mit den Muselmännern und den gröberen Karawanenarbeiten zu tun hatte. Es verdroß ihn, sich von den Ungläubigen verdrängt zu sehen, und in seinem Herzen stieg der Gedanke auf: „Soll ich ihnen weichen, so will ich wenigstens Ersatz dafür haben“, und nun begannen die Diebstähle in Jangi-köll und wurden die ganze Zeit bis zu seiner Abreise von Tscharchlik fortgesetzt.
Der Arme tat mir leid, und ich nahm mir vor zu versuchen, seine Strafe nach Möglichkeit zu mildern, um so mehr, als die Muselmänner ihre Beschuldigungen gewöhnlich sehr übertreiben. Doch wenn auch nur die Hälfte davon wahr war, waren die Diebstähle schon groß genug, um ihn nach Sibirien zu bringen. Aber in der Wüste Takla-makan hatte er mir 23 Jamben gerettet und mir bei unzähligen Gelegenheiten unschätzbare Dienste geleistet.
Es tauchten aber noch allerlei andere häßliche Geschichten auf, die mich gegen sein Schicksal total gleichgültig machten. In Jangi-köll hatte er sich drei, sage drei, junge „Frauen“ genommen, von denen ihn eine 100 Sär gekostet hatte, und damals waren ihm erst 30 Sär von seinem Lohne ausbezahlt worden. Während der zwölf Tage, die er in Tschertschen zubrachte, hatte er sich ebenfalls „verheiratet“, und in Tscharchlik hatte er sich zum Schlusse auch noch eine „Gattin“ zugelegt. Je nachdem das Hauptquartier verlegt wurde, wurden die Damen der Reihe nach abgedankt, und als er endgültig nach Kaschgar reiste, ließ er sie alle miteinander sitzen. Bei all diesen leichtsinnigen Streichen hatte er obendrein in Osch seine rechtmäßige Frau mit fünf Kindern!
Auf die Länge wird es kostspielig, sich fünf Frauen zu halten. Erst muß die Auserwählte gekauft und bar bezahlt werden, dann wird sie eingekleidet und dabei sind ihre Neigungen für chinesische Stoffe u. dgl. zu befriedigen, und schließlich ist sie, vielleicht auch noch ihr Papa und ihre Mama, zu beköstigen. Letzteres ließ sich ja aus unseren eigenen Vorräten leicht bewerkstelligen, und ich werde es also wohl gewesen sein, auf dessen Kosten geschmaust worden ist.
Der letzte Abschnitt der Geschichte Islams nahm folgenden Verlauf. Bei der Ankunft in Kaschgar ließ der Konsul seine Sachen durchsuchen. Bares Geld wurde nicht mehr viel gefunden, aber das gefundene, soweit es reichte, den Benachteiligten zugestellt. Seine Freiheit durfte er behalten, doch nur bis zu einer gewissen Grenze, denn es wurde ihm verboten, Kaschgar zu verlassen. Als ich Anfang Mai 1902 wieder dorthin kam, hatte er infolgedessen noch keine Beschäftigung gefunden. Er suchte mich im Dorfe Japptschan auf, und er tat mir sehr leid, als[S. 102] er sich laut weinend mir zu Füßen warf. Ich ermahnte ihn aufs eindringlichste, sich bei dem Verhör in Kaschgar streng an die Wahrheit zu halten. Ich versicherte ihm, daß ich ihn, wenn er löge, ohne Erbarmen der Gerechtigkeit des russischen Gesetzes überlassen, wenn er aber die Wahrheit spräche, dafür sorgen würde, daß er straflos ausginge. Er versprach, meinem Rate zu folgen. Er war kalt, finster, bleich und abgezehrt und sah ein, daß er sein Leben ruiniert hatte. Hätte er sich so gut geführt wie das vorige Mal, so wäre er in seinem Heimatorte ein angesehener Mann geworden. Sein Name war schon jetzt in ganz Innerasien bekannt, aber welche traurige Berühmtheit sollte er künftig erlangen!
Als aber das Verhör vor sich ging, alle Anklageakten vorgelegt und alle Zeugen zur Stelle waren, leugnete er hartnäckig bei jedem einzelnen Punkt. Man konnte ihn nicht dazu bringen, die Richtigkeit auch nur der greifbarsten Beschuldigungen anzuerkennen; er erklärte alles für boshafte Verleumdung. Ich erinnerte ihn wieder daran, daß es in seinem eigenen Interesse liege, zu gestehen, aber nichts half. Keine Stimme erhob sich zu seiner Verteidigung. Er erhielt jetzt vom Konsul Befehl, sich bei dem Distriktschef, Oberst Saizeff, in Osch einzustellen, in welcher Stadt nach russischem Gesetz das Urteil über ihn gefällt werden mußte und wo er bald nach mir eintraf. Auch hier leugnete er alles. Da er sich durch die Veruntreuungen gegen das russische Gesetz und durch seinen Lebenswandel gegen das Scheriet (religiöse Gesetz) der Muhammedaner vergangen hatte, wurde er für Sibirien reif erklärt, die Strafe aber auf drei Monate Gefängnis ermäßigt; auf meine besondere Bitte wurde die Strafe nachher auf vierzehn Tage ermäßigt, aber ganz straflos durfte er schon seiner Landsleute wegen nicht ausgehen.
Ich sah ihn in Osch nicht wieder und wollte ihn auch nicht mehr sehen. Er, der in meiner Karawane eine so hervorragende, ehrenvolle Rolle gespielt hatte, war von nun an für mich tot. Durch seine grenzenlose Dummheit und Gedankenlosigkeit und durch eine Art Größenwahn hatte er sich in das schimpflichste Elend gestürzt, er, der in seiner Heimat einen Ehrenposten hätte erhalten können und dem die russischen Behörden als Anerkennung der von ihm geleisteten Dienste einen goldgestickten Samtchalat versprochen hatten. Damit war seine Geschichte zu Ende. Nach den Verhören am Kum-köll wurde sein Name in der Karawane nicht mehr genannt.
Die Moral der Geschichte ist: „Traue nie einem Muselmann!“ Man sollte glauben, daß, wenn man einen Diener so viele Jahre gehabt und mit Güte überhäuft und er selbst nur Vorteil von seinem guten[S. 103] Betragen hat, man sich schließlich auf ihn wie auf sich selbst müßte verlassen können. So aber sind die Muhammedaner nicht. Sie vergessen nie, daß sie bei einem Ungläubigen in Diensten stehen. In moralischer Hinsicht ist diese Rasse schlecht, aber man muß sie nicht zu streng verurteilen, denn sie lebt wirklich in harten Verhältnissen. Die Mongolen sind unvergleichlich viel besser, und ist man wie ich so glücklich, eine Eskorte von Kosaken zu besitzen, so dürfen die Muhammedaner nur zu den gröberen Arbeiten benutzt werden. Mehrere von meinen muhammedanischen Dienern, Turdu Bai, Kutschuk, Chodai Kullu und Ördek, waren allerdings außergewöhnlich prächtige Menschen, aber sie hatten auch nie Gelegenheit, in allzu große Versuchung zu geraten.
[S. 104]
Als ich am 17. Mai endlich in den Sattel steigen konnte, geschah es, um noch einem Jahre voller Irrfahrten in Asiens großem, ödem Inneren entgegenzugehen. Mit großer Spannung und frischem Mut wurde diese letzte denkwürdige Reise angetreten, die mich mit den am schwersten zugänglichen Teilen des Kontinents bekannt machen sollte. Gelang sie, so würden, im großen gesehen, nicht viele Teile Asiens übrig sein, die ich noch nicht besucht hatte. Ich hoffte gar viel von dieser letzten Reise, wußte aber auch, daß ich jetzt das Schwerste vor mir hatte. Doch die Schwierigkeiten reizen am meisten, und inmitten der ernsten, eifrigen Arbeit, die täglich vorwärtsschritt, freute ich mich in Gedanken auf all die wilden Abenteuer, die meiner „jenseits der hohen Berge“ warteten.
Eine unangenehme Überraschung stand uns jedoch noch bevor, ehe wir die kleine, gastfreie Stadt am Rande der Wüste verließen. Am Abend des 16. Mai traf eine Karawane von zehn mongolischen Pilgern aus Tarbagatai mit elf Pferden und zwölf Kamelen ein. Sie ließen sich in einem Haine unweit des Basars nieder. Schagdur und der Lama hatten sie in Kara-schahr getroffen und wußten, daß sie auf dem Wege nach Lhasa war. Natürlich wußten die Mongolen, von denen einige türkisch sprachen, daß sich eine große Karawane in der Gegend aufhielt. Wir konnten nicht aufbrechen, ohne daß sie uns sahen. Als Sirkin mit den Packpferden an ihrem Lager vorbeiritt, hatten sie auch gefragt, wohin es gehe, und er hatte geantwortet, daß er nach Ladak und Kaschgar wolle. Schagdur und der Lama ritten frühmorgens aus der Stadt und machten einen großen Bogen nach Westen, um nicht gesehen zu werden. Ich ritt den mittleren Weg im Flußbett mit Chalmet Aksakal und dem alten Togdasin Bek aus Tscharchlik, der uns damals durch das Bett des Ettek-tarim begleitet hatte. Erst als die Gärten der Oase unter dem Horizont verschwunden waren, vereinigten wir uns wieder zu einer Gesellschaft; mich wenigstens hatten die Mongolen nicht gesehen; sie würden mich nicht identifizieren[S. 105] können, wenn wir uns später unter kritischen Verhältnissen treffen sollten.
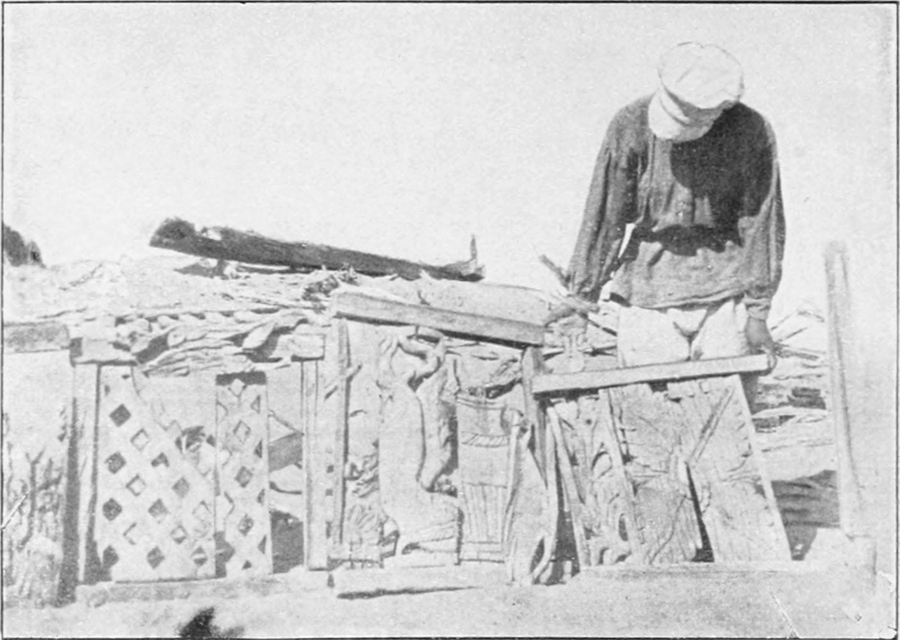


Doch warum all diese Vorsichtsmaßregeln gegen eine Gesellschaft friedlicher Mongolen, die keiner Katze etwas zuleide tun? Darum, weil sie vor uns nach Lhasa kommen und ohne Zweifel von unserem Herannahen erzählen würden. Dann aber würde das Land im Norden des „heiligen Gebietes“ streng bewacht und wir nimmermehr durchgelassen werden. Die Kamele der Mongolen waren freilich in schlechtem Zustand, und sie würden lange Zeit brauchen, um Zaidam zu erreichen, wo sie wie gewöhnlich jene gegen Pferde vertauschen wollten. Aber dennoch würden sie uns bald einen Vorsprung abgewinnen und schneller und leichter vordringen als wir, die wir die schlimmsten Teile von Tibet aufsuchten. Meine Befürchtungen trafen später in der Tat zu, obwohl gewiß auch andere Umstände in noch höherem Grade bei der Durchkreuzung unserer Pläne mitwirkten.
Die Karawane, mit der ich jetzt die nördlichsten Bergketten des Kwen-lun-Systems überschritt, war folgendermaßen zusammengesetzt: Schagdur, Sirkin, Mollah Schah und Li Loje, der Lama und ein Führer, 12 Pferde und Jolldasch. Das Hochgebirge erhob sich in überwältigender Majestät vor uns. Im Südosten erschien die Talmündung, welcher der Tscharchlik-su entströmt, und im Süden lagen der Kurruk-sai und Korumluk-sai, nach denen unser Weg führte. Das Tal, in welchem der Fluß die nördlichste Kette des Astin-tag durchbricht, ist zu wild und tief, um passiert werden zu können. Die Sonne brannte heiß, und die Mücken waren hungrig, verschwanden aber gleich, sobald wir in öde, unfruchtbare, langsam ansteigende Gegenden gelangten. Zur Linken erschienen einige einsame Reiter; es waren Mongolen, die uns von weitem beobachteten.
Jiggdelik-tokai, der erste Lagerplatz, liegt am linken Ufer des Tscharchlikflusses (Abb. 225). Das Wasser rauschte in einem 40 Meter tief eingeschnittenen Bette zwischen senkrechten Geröllwänden (Abb. 226). Ein halsbrecherischer Pfad führte nach dem Ufer hinunter, wo einige wenige Büsche unseren Pferden kärgliche Weide boten. Der Aksakal und Togdasin Bek, die uns den ganzen Weg begleitet hatten, kehrten jetzt um, trotz des heftigen Sturmes, der sich am Nachmittag erhob und der die Temperatur sehr bedeutend heruntergehen ließ.
Der Morgen war frisch und kühl und machte wärmere Kleidung notwendig. Bald reiten wir in die mächtigen, widerhallenden Säle des „Steinigen Tales“ ein, wo die Wände von rotgeflammtem oder schwarzgestreiftem Granit und dunkeln, harten Schiefern aufgemauert sind. Die nackten, zackigen, kahlen Felsen versperren meistens die Aussicht, manchmal aber öffnet sich in einem Seitentale eine großartige Fernsicht in eine Welt[S. 106] von immer höher und gewaltiger werdenden Bergen, ein Chaos von Ketten und Gipfeln, die hier und da mit malerischen Schneeflecken gekrönt sind. Der Talgrund ist voller Geröllblöcke und Granitstücke von verschiedener Größe, zwischen denen es sich ziemlich mühsam reitet. Tamarisken und wilde Rosen sind häufig. Wir freuen uns nach dem langen Winter in einförmigen Wüsten wieder in die ständig wechselnde Welt der Felsen einzutreten, unsere Stimmen von den Felswänden widerhallen zu hören und zu fühlen, wie unsere Lungen sich mit frischer, reiner, sand- und staubfreier Luft füllen.
Manchmal ist das Tal so eng, daß wir auf Seitenvorsprünge und Pässe hinaufgehen müssen. Es zieht sich jetzt nach Osten, und nach einer letzten Schwelle entrollt sich vor uns das Haupttal des Tscharchlik-su, nach welchem wir wieder zurückkehren. Der Fluß ist nach dem letzten Regen gewaltig angeschwollen. In der Talweitung, wo wir uns bei einer Pappel einen Lagerplatz wählten, macht er eine scharfe Biegung.
Ich hatte zehn Esel gemietet, die uns mit Mais für die Pferde nach dem Kum-köll begleiten sollten. Ihr Ausbleiben zwang uns, einen Tag am Flusse zu warten, aber keiner hatte etwas dagegen, in dieser schönen Gegend zu rasten. Überdies hatten wir keine Eile, denn, wie langsam wir auch zogen, wir würden doch vor den schwerfälligen Kamelen am Kum-köll anlangen. Im Laufe des Tages trafen die Esel wohlbehalten ein, und nun konnten wir uns wieder in Bewegung setzen.
Eine schwere Tagereise stand uns bevor. Der Weg führt aufwärts durch das tief in grauen Granit eingesägte Tal des Flusses, wo die von den brausenden Wassermassen unterminierten Felsen manchmal gewölbeartig überhängen. Wir wußten, daß wir den Tscharchlik-su sechzehnmal zu überschreiten hatten und daß es galt, sich gut vorzusehen. Ein Hirt, dem wir begegneten, konnte uns keine ermutigenden Mitteilungen machen. Sein Pferd war mitten im Flusse gestürzt, und die ganze, aus Brot, Mais und Kleidungsstücken bestehende Last war verlorengegangen. Der Fluß, dessen Wassermenge jetzt etwa 9 Kubikmeter in der Sekunde betrug, bildete Stromschnellen und rauschte donnernd zwischen rundgeschliffenen Blöcken hin.
Anstrengend und spannend ist diese kurze Tagereise, und man wird erst ruhig, wenn man nach der letzten Furt die Instrumentkisten wohlbehalten auf dem Trockenen sieht. Die Muselmänner untersuchten, halb entkleidet, jede Furt, und die Pferde, welche die wertvollsten Lasten trugen, wurden langsam einzeln hinübergeführt. Wir hatten auch ein paar Maulesel; einer von diesen hatte es sich bei einer Furt in den Kopf gesetzt, nicht denselben Übergang zu benutzen wie die anderen Tiere. Er versuchte[S. 107] es mehr nach der Seite hin, wo die Hauptmasse des Wassers in einer tiefen Rinne strömte, glitt hier aber aus, wurde von der Strömung fortgerissen und eine weite Strecke unterhalb der Schwelle auf eine Kiesbank geschleudert. Die Kosaken stürzten sich angekleidet in den Fluß und richteten das Tier wieder auf, aber die ganze Last, die glücklicherweise nur aus Mehl und Brot bestand, war verlorengegangen.
Leider war die Gegend in dichten Nebel gehüllt, und die Kämme des Gebirges verschwanden wie ein Tempelgewölbe in Abenddämmerung und Weihrauchwolken. Der Lagerplatz trug den Namen Mestschit-sai (Moscheetal).
Die vierte Tagereise führte uns ein Seitental hinauf. Dieses neue Tal ist schmäler und wilder als die vorhergehenden und steigt schließlich so steil an, daß man vorzieht zu Fuß zu gehen, ja bisweilen sogar klettern und sich mit den Händen festhalten muß. Es ist ziemlich schwierig, beladene Pferde solch abschüssige Wege hinaufzuführen; die Lasten rutschen nach der Schwanzwurzel oder schlagen über und müssen beständig zurechtgerückt werden. Auf diesem schuttbedeckten Felsboden ist selten ein Pferd sichtbar, und solche sollen hier auch nicht oft benutzt werden.
Jaman-dawan (der schlechte Paß) ist ein passender Name für die ungeheuer scharfe, schwer passierbare Schwelle, die wir endlich erreichten. Nur ein Pferd hat dort oben Platz. Auf beiden Seiten dieses Sattels erheben sich gewaltige, wilde Felsen, die zu dem Kamme gehören, in welchem der Jaman-dawan eine recht tiefe Einsenkung ist. Östlich vom Passe ist das Gefälle viel weniger steil und der Boden mit Erde bedeckt und mit Gras bewachsen. Die Luft war jetzt wieder klar, und die Aussicht großartig. Über Hitze konnten wir uns nicht beklagen, denn auf dem Passe hatten wir nur +2,6 Grad.
Von dem Lagerplatze, der keinen Namen hatte, zogen wir nach Osten, indem wir jetzt ein neues Tal hinaufstiegen. Anfangs war es ziemlich eng und schwer passierbar, ja an einem Punkte, wo der Hohlweg ganz mit herabgestürzten Granitblöcken angefüllt war, mußten die Tiere abgeladen und mit vereinten Kräften eine 4 Meter hohe Stufe hinaufgewunden werden. Oberhalb dieser Stelle erweitert sich das Terrain und wird bequemer. Nur hin und wieder sieht man Rebhühner und kleine, niedliche Bergschwalben, sonst kein Wild. Einige unserer Pferde und ein Maulesel sind von dem vielen Schutt steifbeinig geworden und hinken; sie werden daher nach Möglichkeit geschont. In der Nacht ging die Temperatur auf −6 Grad herunter; mitten im Sommer ritten wir wieder dem Winter entgegen. Dieses Jahr war mein Sommer wirklich nicht viel länger als sechs Wochen gewesen!
[S. 108]
Eine lange, ermüdende Tagereise führte uns am 23. Mai auf offeneres, plateauartiges Terrain, eine Hochlandsteppe, die stellenweise von dem stehengebliebenen Grase des vorigen Jahres gelb schimmerte. Hier sahen wir die ersten Kulane. Jetzt befanden wir uns auf alle Fälle auf dem tibetischen Hochplateau und hatten das bizarre Randgebirge überschritten. Schwere, dunkle Wolken begrüßten uns bei unserer Ankunft und schütteten von Zeit zu Zeit ihren Inhalt in Form von Regen und Schnee über uns aus. Während wir ein etwas ausgeprägteres Tal hinunterritten, sahen wir abends bei Hascheklik unseren alten Tscharchlik-su wieder; er war hier weniger wasserreich, und das Wasser hatte eine eigentümliche, beinahe milchweiße Farbe, die gewiß von einer verwitternden weißen Gesteinart herrührte.
Schereb Lama in seinem roten Gewande mit dem gelben Gürtel und der blauen Mütze, die nur bei Regenwetter von einem mongolischen Baschlik geschützt wurde, war das malerischste Mitglied unserer kleinen Karawane. Mit mir und Schagdur stand er schon auf dem vertrautesten Fuße, aber die anderen kannte er wenig, denn er konnte nur ein paar Worte Türkisch, doch war er sehr gelehrig und bereicherte allmählich seine Kenntnisse. Was er während der langen Marschtage dachte, weiß ich nicht, aber daß er viel grübelte, konnte ich sehen; er mochte sich wohl den Kopf darüber zerbrechen, was das Schicksal mit seiner priesterlichen Würde vorhatte. Er fand die Gesellschaft, in die er geraten war, gewiß sehr merkwürdig, und es machte mir unglaubliche Mühe, ihm den Nutzen der astronomischen Beobachtungen und des Kartenzeichnens klar zu machen. Ich war in seinen Augen ein recht sonderbarer Mensch, aber mit rührender Anhänglichkeit und unerschütterlichem Vertrauen schloß er sich an uns an und begriff sehr wohl, daß wir Fremdlinge es wirklich gut mit ihm meinten.
Jeden Abend gab er mir Unterricht im Mongolischen. Ich schrieb alle neuen Worte und Ausdrücke auf und mußte sie bis zum nächsten Abend gelernt haben. Selten habe ich einen so angenehmen Lehrer gehabt. Er wollte, daß ich seine Sprache bald so weit beherrschen sollte, daß er sich mit mir über Dinge, die ihn selbst interessierten, unterhalten konnte.
Schnee und Hagel und naßkaltes Winterwetter herrschten an dem Tage, den wir unseren Pferden zur Rast auf den Wiesen von Hascheklik schenkten. Im Freien zu arbeiten war unmöglich, und ich beschloß daher, mit dem Lama zu sprechen. Wie unsere Pläne künftig auch ausschlagen mochten, ich wollte nicht, daß der Lama je glauben oder auch nur denken sollte, ich hätte ihn hinterlistigerweise in wahnsinnige Abenteuer verstrickt.[S. 109] Ich wollte ihm die Möglichkeit offen lassen, beizeiten mit geretteter Ehre in sein Land zurückzukehren. Deshalb erfuhr er schon jetzt, daß ich die Absicht hatte, als Mongole verkleidet ihn und Schagdur nach Lhasa zu begleiten.
Er war sehr verdutzt und suchte mich zu überzeugen, daß dies unmöglich sei. Mich und Schagdur würde niemand anzurühren wagen, ihm aber in seiner Eigenschaft als Lama würde es den Kopf kosten. Er hegte keine Furcht vor dem Dalai-Lama, den mongolischen Pilgern und den Chinesen in der Stadt, sondern nur vor den Tibetern, die die dorthin führenden Wege bewachen. „Töten sie mich nicht,“ sagte er, „so machen sie mich doch als Lama für immer unmöglich; ich werde als Abtrünniger, als Verräter, der einen Europäer nach Lhasa geführt hat, angesehen!“ Doch schon jetzt war er in seiner Entschlossenheit wankend geworden, denn er schlug vor, die ganze Karawane sollte geraden Weges nach der heiligen Stadt ziehen, — das Schlimmste, was uns dann passieren könne, sei, daß wir höflich, aber bestimmt zurückgewiesen würden. Er selbst könne sich dann als Türke verkleiden, und keiner seiner Freunde in Lhasa würde eine Ahnung davon haben, daß er bei der Sache beteiligt sei. Als ich jedoch an meinem Plane festhielt, schlug er vor, ich sollte mich lieber für einen „Urancha“ ausgeben; es ist dies ein Stamm aus dem Altai, der dem Lamaismus anhängt, aber einen türkischen Dialekt spricht, der dem Dschaggataitürkischen, das mir recht geläufig war, sehr ähnelt.
So sprachen wir den ganzen Tag miteinander, und schließlich war der Lama wirklich erregt. Nach dem Kum-köll mußte er uns jedenfalls begleiten, und ich versprach ihm, daß er von dort, falls er es wünschte, heimkehren dürfte. An diesem See wollten wir ein paar überflüssige Eseltreiber verabschieden, und mit ihnen konnte er sich nach Tscharchlik begeben. Er fürchtete sich jedoch vor dem Sommer dort und wollte lieber nach Tschimen reiten; ich ahnte sofort, daß er mit der Mongolenkarawane nach Lhasa zu ziehen plante, und sagte mir, daß er ihnen dann, in einem unbewachten Augenblick, meine Absichten anvertrauen könnte. Eine solche Möglichkeit mußte um jeden Preis verhindert werden.
Das Wichtigste, mochte nun aus der Reise nach Lhasa etwas werden oder nicht, war, daß wir unter allen Umständen in Tibet eines Dolmetschers bedurften; dies war so wichtig, daß diese ganze lange Reise durch Tibet bedeutend an Wert verlieren mußte, wenn wir uns mit den Einwohnern nicht verständigen konnten. Ich erklärte dies dem Lama, und er sah ein, daß ich vollständig recht hatte. Ich machte ihm sogar den Vorschlag, daß er bei der Karawane im Hauptquartier bleiben könne, während ich und die Burjaten nach Lhasa gingen. Dieser Ausweg hatte jedoch für seinen Ehrgeiz[S. 110] nichts Verlockendes; er war kein Feigling und gab später bei vielen Gelegenheiten Beweise von wirklichem Mut.
Stumm und niedergeschlagen saß er die folgenden Tage im Sattel und fand sicherlich, daß die Gesellschaft, in die er geraten, noch viel sonderbarer sei, als er anfänglich gedacht. Mit Schagdur verkehrte er nie wieder freundschaftlich; er fand mit Recht, daß dieser ihn schon in Kara-schahr in den ganzen Plan hätte einweihen müssen. Ich erklärte ihm, daß Schagdur auf meinen bestimmten Befehl so gehandelt habe und daß, wenn er davon gesprochen hätte, daß ein Europäer verkleidet mit nach Lhasa wolle, kein einziger Lama in der ganzen Mongolei sich, um welchen Preis es auch sei, bei uns hätte anwerben lassen. Kein Tagemarsch ging von nun an durch die Täler, kein Abend dämmerte, ohne daß wir Rat hielten und über unsere Lhasapläne sprachen. Schereb Lama machte hierbei wirkliche Seelenkämpfe durch. Ich war aber froh über seine Gesellschaft; er war einer der besten Menschen, mit denen ich zu tun gehabt hatte. In der Folge wird der Leser mit seinen weiteren Schicksalen Bekanntschaft machen. Jetzt wurde also für den Anfang vereinbart, daß er uns bis an den Kum-köll begleitete; dort sollte er seine endgültige Entscheidung treffen, dort sollte er wie Herkules am Scheidewege stehen und zwischen seiner sicheren Zelle im Kloster zu Kara-schahr auf der einen und ungewissen Schicksalen und unter allen Umständen merkwürdigen Abenteuern auf der anderen Seite wählen.
Während der folgenden Tage kreuzten wir mehrere Nebenflüsse, die nach Nordwesten strömen und dem Tscharchlik-su ihren Tribut bringen. In dem großen, offenen Kesseltale Unkurluk (Tal der Erdhütten), das wir in dichtem Schneegestöber erreichten, sahen wir an mehreren Stellen Schafherden, aber keine Menschen. Die Kosaken suchten die Gegend ab, ohne daß es ihnen gelang, jemand zu treffen. Ein wenig höher oben blieben wir in der Mündung eines kleinen Seitentales, wo es gute Weide, aber kein Wasser gab (Abb. 227).
Als die Luft sich ein wenig geklärt hatte, sahen wir zwei Zelte und etwa zehn Leute. Die Kosaken ritten dorthin, um mit den Bergbewohnern zu unterhandeln und Brennmaterial, Milch und ein Dutzend Schafe, die wir mitzunehmen beabsichtigten, zu kaufen.
Die 18 Hirten, die sich in Unkurluk aufhalten, wohnen hier beständig und hüten Schafe und Pferde aus Tschertschen. Den Winter verbringen sie in erbärmlichen kleinen Erdhütten. Die Gegend ist reich an Wild; Archari (wilde Schafe), Steinböcke, Yake, Bären und Wölfe kommen vor. Seit dem Herbst hatten sich jedoch keine Yake gezeigt; sie begeben sich im Sommer in höhere Regionen hinauf. Rebhühner hörte man hier[S. 111] und da in den Bergen rufen. Der Schnee fiel abends außerordentlich dicht, und wir waren wieder von vollständigem Winter umgeben.
Als wir am 27. bei kaltem, windigem Wetter das „Tal der Erdhütten“ verließen, nahmen wir zwölf ziemlich magere Schafe ohne Fettschwanz und drei Hirten mit statt unserer Tscharchliker Führer und der fünf Esel, deren Maislast bereits verzehrt war (Abb. 229).
Jetzt befanden wir uns richtig im Gebirge und auf bedeutender Höhe (3797 Meter). Das merkte man beim Atmen; man kletterte nun nicht mehr unnötig steile Abhänge hinauf. Von Bergkrankheit zeigte sich jedoch noch keine Spur, im Gegenteil, es ging uns allen vortrefflich.
Der folgende Tagemarsch führte uns über vier leichte Pässe zweiter Ordnung und über schneebedecktes, wellenförmiges Terrain nach dem Tale Kar-jaggdi, wo es etwas Weide gab. Im Süden und Südosten erheben sich mächtige, schneebedeckte Berge. Der Weg war leicht und angenehm, als wir dieses Tal hinaufzogen, in dessen Mitte sich ein mehrarmiger Bach schlängelte, der von dem frischgefallenen, schmelzenden Schnee gespeist wurde und dessen Wasser von verwitterndem Sandstein, der in der Gegend vorherrschte, rot gefärbt war. Auch jetzt galt es, einen Paß zu überschreiten, der zwar leicht und bequem ist, aber große geographische Bedeutung besitzt, denn er bildet die Wasserscheide zwischen Ostturkestan und dem Tschimentale. Die Höhe beträgt 4079 Meter, und der Schnee lag hier ziemlich hoch.
Wir folgten dem nächsten abwärtsgehenden Tale nach Südosten, wo die beschneite Kette des Piaslik ein herrliches Panorama bildete, und gelangten so in das breite Tschimental hinunter, das wir von so vielen früheren Exkursionen her kannten. Jetzt sah es noch winterlicher und kälter aus als im Oktober vorigen Jahres; alle Berge waren mit Schnee bedeckt, von dem aber nur die allerhöchsten Partien den Sommer über liegenbleiben. Wir lagerten am Ufer eines Flusses, der sich weiter abwärts mit dem Togri-sai vereinigt.
In diesem Lager erkrankte Schagdur ziemlich heftig; sein Puls stieg auf 134 und seine Temperatur auf 38,6 Grad (meine Körpertemperatur stieg in 4000 Meter Höhe und darüber selten über 36 Grad). Wir mußten einen Tag liegenbleiben und ihn pflegen, so gut wir konnten. Sirkin ging auf die Jagd und kam mit zwei Orongoantilopen (Pantholops hodgsonii) wieder; wir konnten daher ein paar Tage unsere Schafe sparen. Die Antilopen sind in dieser Jahreszeit ziemlich mager, da sie auf das neue Gras warten. Im Herbst sind sie fetter und besser.
Am 30. war Schagdur besser und bestand fest darauf, daß wir weiterzögen. Unser Weg führte jetzt nach Südosten über den ziemlich großen[S. 112] Togri-sai-Fluß und dann aufwärts in dem Quertal, das östlich vom Durchbruchstal Togri-sai die Piaslikkette durchschneidet.
Als wir schon eine ziemliche Strecke im Tale zurückgelegt hatten, stellte sich heraus, daß der Patient und der Lama nicht mitgekommen waren. Ich kommandierte daher an einem Rinnsale, wo Jappkakpflanzen uns notdürftig mit Feuerung versahen, Halt und schickte Li Loje zurück, um zu erfahren, welchen Grund das Ausbleiben der beiden hatte. Nach einer Weile kamen sie alle drei; Schagdur war matt, schwindlig und beinahe außerstande, sich im Sattel zu halten. Er bekam einen tüchtigen Spiritusgrog, wurde in Filzdecken gewickelt und kam ins Schwitzen. Gegen Abend ging es ihm entschieden besser; er hatte 37,2 Grad Temperatur und 112 Pulsschläge. Der Spiritus wurde aus einer der Flaschen für die zoologischen Sammlungen genommen. Sonst gab es keine Spirituosen in der Karawane, und zur Ehre der Kosaken muß ich sagen, daß keiner von ihnen, und von den anderen ebenfalls keiner, sie entbehrten. Alkoholische Getränke sind ein böses Ding in einer Karawane; sie machen Kräfte und Disziplin schlaff.
Auch hier blieben wir einen Tag liegen, damit sich der Kranke ordentlich ausruhte. Nach einer ruhigen Nacht legte er am 1. Juni die Tagereise wirklich gut zurück. Freilich war er noch ein wenig matt und mußte auf dem langen Wege ein paarmal rasten, aber er war doch ziemlich munter, als er am Ufer des Kum-köll ankam, wo er sich mehrere Tage der Ruhe und Pflege erfreuen sollte.
Am 1. Juni erreichten wir das Ufer dieses großen Salzsees. Wir ritten auf vorzüglichem Boden nach Südosten. In der Ferne dehnt sich die ungeheure, schön marineblaue Fläche des Sees aus. Nach Osten hin erstreckt sich die Kalta-alagan-Kette, die wir in Verkürzung in endloser, aber zusammengedrängter Perspektive sehen; ihr Kamm glänzt matt-weiß. Kulane und Orongoantilopen kamen in Menge vor. Am Ufer suchten wir lange vergeblich nach Wasser, bis endlich einer der Hirten uns eine Stelle zeigte, wo sich seiner Meinung nach ein Süßwasserbrunnen würde graben lassen, und richtig, seine feine Spürnase hatte ihn nicht betrogen. Brennstoff war vorhanden; die Weide war jämmerlich, aber in dieser Jahreszeit konnten wir nichts Besseres erwarten. Die Zelte und die Lasten wurden dicht am Strande so praktisch wie möglich aufgereiht (Abb. 228), und wir hatten jetzt weiter nichts zu tun, als die Ankunft der Karawane zu erwarten.
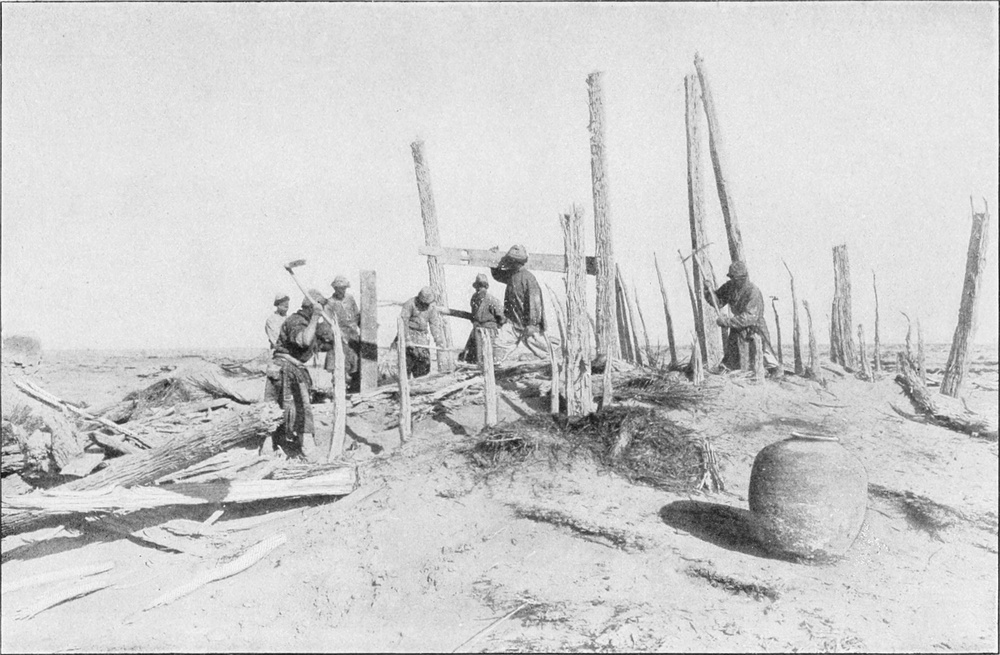

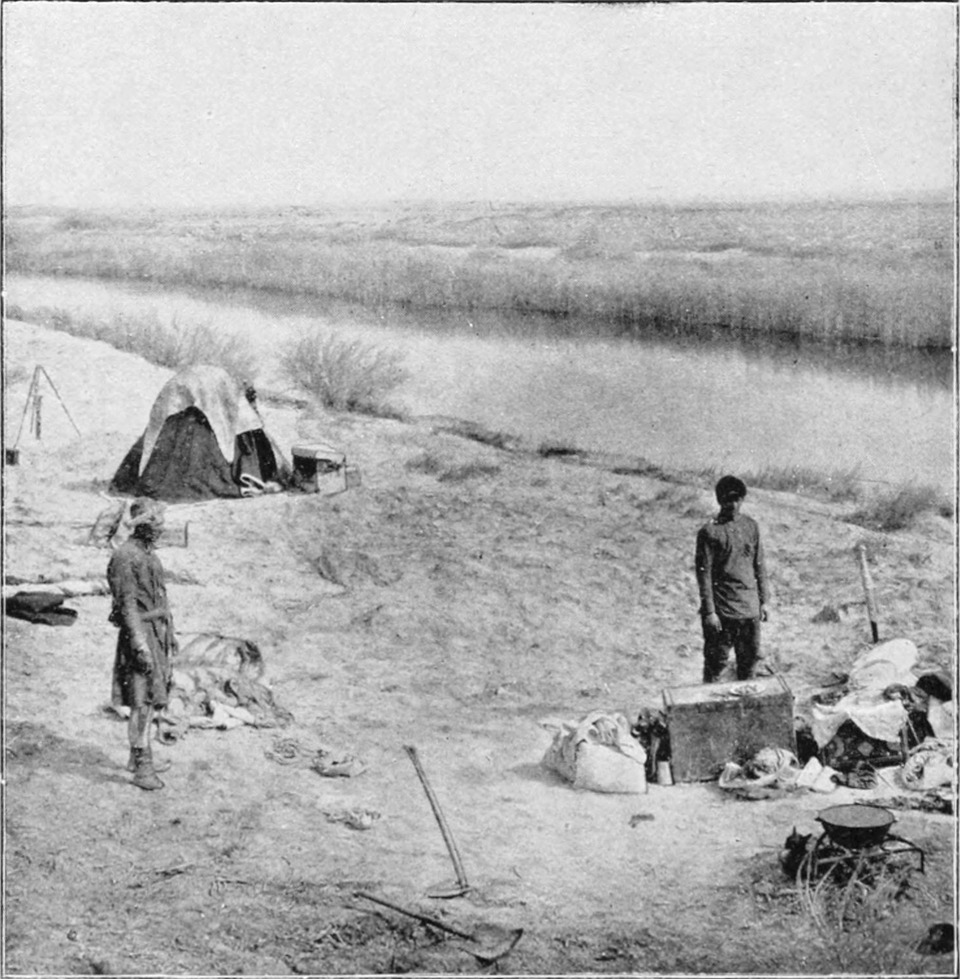
Wir warteten am 2. Juni, wir warteten am 3., aber keine Karawane kam. Scharfer, östlicher Wind peitschte die Wellen des Kum-köll zu bedeutender Höhe auf, und ihr eintöniges Rauschen gegen das Ufer war[S. 113] das einzige, was das Schweigen der Wildnis unterbrach. Bisweilen herrschte Nebel; doch auch wenn die Luft klar war, sah man auf der Ostseite des Sees kein Land, und der Wind erfrischte wie eine Meerbrise; ja, manchmal, wenn er Schauer von Hagel oder Schnee brachte, kühlte er nur zu fühlbar ab. Die Hirten, die ihren Auftrag ausgeführt hatten, brannten vor Ungeduld, wieder nach ihren Hütten zurückkehren zu können; die noch vorhandenen drei Esellasten Mais wurden im Zelte der Kosaken verwahrt, dann entließen wir die ganze Gesellschaft. Erst aber mußten sie uns noch von den nächsten Schneewehen einige Säcke Schnee zu süßem Wasser holen. Ich kann mir nichts Langweiligeres denken, als jahraus, jahrein in diesem Gebirge zu hausen und anderer Leute Schafe zu hüten! Und doch machten die Hirten einen heiteren, zufriedenen Eindruck, und es war ein billiges Geschäft, sie überglücklich zu machen. Für mich war es eine richtige Geduldprobe, hier stillzuliegen und mir den Kopf darüber zu zerbrechen, weshalb die Karawane noch nicht kam und ob ihr unterwegs etwas zugestoßen sein könnte. Doch der Gedanke, sie in Tschernoffs, Tscherdons und Turdu Bais zuverlässigen Händen zu wissen, beruhigte mich.
Vergebens suchten unsere Blicke im Norden längs des Fußes des Gebirges die lange, schwarze Linie, die das Herannahen der Unseren verkünden würde. Manchmal konnten wir des Nebels wegen gar nichts unterscheiden; wenn aber die Luft klar war, hielten die Kosaken mit dem Fernglase eifrig Ausschau. Unterdessen ging es uns hier ganz gut. Proviant, besonders Schafe, hatten wir noch hinreichend, und es konnte nicht schaden, daß wir uns langsam und allmählich an die Luftverdünnung gewöhnten. Schagdur wurde mit Massage und kalten Umschlägen behandelt und erholte sich allmählich. Sirkin wurde beauftragt, nach unserem vorjährigen Lagerplatz am Nordwestufer zu reiten und unterwegs eine Marschroute aufzunehmen, die, wie sich bei der Kontrolle ergab, recht gut ausfiel. Für den Fall, daß sich die Karawane dort niederlassen sollte, machte er einen Wegweiser aus einem kleinen Brett mit einer darauf gezeichneten Hand, die westwärts, nach unserem jetzigen Lager zeigte.
Der 4. Juni war ein schöner, herrlicher Tag. Die ganz klare Luft erlaubte dem Blicke, dem Kalta-alagan-Gebirge bis in endlose Fernen zu folgen, wo sein Kamm undeutlich wurde und wie in einer nadelscharfen Spitze verschwand. Der See zeigte sich in einem neuen Farbenspiel: hellgrün mit weißen Wellenschaumstreifen. Die Pferde weideten weit vom Lager, die meisten Leute schliefen, nur der Lama spähte fleißig nach Norden; das scharfe Zeißsche Fernglas war ihm sehr interessant, und er benutzte es oft. Ich arbeitete in meiner Jurte, als er mir meldete, daß er die Karawane zu sehen glaube. Ich nahm das Fernglas, und richtig, längs des[S. 114] Fußes des Gebirges wurde der gewaltige Zug sichtbar, der in sechs Abteilungen marschierte, voran eine lange, schwarze Linie und dann mehrere kleinere Gruppen; nur mit Hilfe des Fernglases konnte ich diese schwarzen Linien und Punkte unterscheiden.
An diesem Tag wurde nichts mehr getan. Mit gespanntem Interesse beobachteten wir den Gang des Zuges. Jetzt würden wir uns wieder vereinigen und den Marsch nach Süden im Ernst antreten. Die Entfernung war indessen noch zu groß, als daß die Karawane unsere Zelte hätte sehen können. Sie ging noch immer nach Osten, statt gerade auf unser Lager loszusteuern.
Nun sahen wir zu unserem Erstaunen, daß Halt gemacht, die Lasten abgeladen und die Kamele auf die Weide geschickt wurden. Ich sandte daher Mollah Schah dorthin. Je weiter er sich auf dem weitgedehnten Terrain von uns entfernte, desto schwerer wurde es uns seinen Weg zu verfolgen. Schließlich kam ihm ein Reiter von der Karawane entgegen, und beide gingen in das andere Lager. Dort wurden die Kamele von allen Seiten wieder herbeigeholt, und der Zug setzte sich von neuem in Bewegung, indem er umschwenkte wie ein Eisenbahnzug in einer Kurve, den man schließlich in Verkürzung vor sich sieht. Darauf tauchte bei dem östlich von uns liegenden, isolierten kleinen Berge ein einzelner Reiter auf, der sich uns in starkem Trabe näherte.
Es war Kutschuk. Er war vor ein paar Tagen von dem Karawanenführer Tschernoff vorausgeschickt worden, um uns rechtzeitig Nachricht zu bringen. Auf dem alten Lagerplatze am Nordufer hatte er Sirkins Wegweiser gefunden und die Bedeutung der nach Westen zeigenden Hand sofort verstanden. Er ritt mein altes Kaschgarpferd, das älteste in der Karawane, und brachte uns nur gute Nachrichten.
Mittlerweile näherte sich die Karawane in guter Ordnung; die beiden Kosaken ritten in gestrecktem Galopp zu mir und meldeten militärisch, daß alles gut stehe; Leute wie Tiere seien in vorzüglichem Zustand, nur ein Maulesel sei als untauglich in Bag-tokai zurückgelassen; einige von den heimkehrenden Dienern sollten ihn behalten, wenn sie ihn wieder ins Leben rufen könnten.
Jetzt kam die Eselkarawane mit Dowlet Karawan-baschi an der Spitze angezogen; hinter dieser bunten Gesellschaft erschien ein aufgescheuchter Kulan, der in einer Wolke von Staub gerade auf das Lager zurannte, bis er die Gefahr erkannte und sich nach Westen rettete.
Darauf erschien Turdu Bai an der Spitze seiner prächtigen, fetten Kamele (Abb. 230). Sie waren munter und sichtlich zufrieden, daß sie sich in der frischen, kühlen Bergluft befanden und die schwüle Hitze und die stechenden[S. 115] Insekten der Tiefebene hinter sich hatten. Während der Ruhetage, die sie unterwegs gehabt, hatten die Männer Tschapane für alle Kamele genäht, um sie gegen den heftigen Temperaturwechsel zu schützen. Die drei Jungen, die den älteren wie Hunde nachliefen, sahen in ihren weißen Mänteln gar zu komisch aus. Sogar das jüngste Kleine sprang umher, ohne eine Spur von Ermüdung zu zeigen. Es war erst wenige Tage alt, als es schon mit der dünnen Luft Bekanntschaft machte, und seine Lungen paßten sich ihr früh an. Ganz sicher trug dieser Umstand dazu bei, es widerstandsfähiger zu machen als seine beiden Kameraden, die es lange überlebte. Sogar dem Hirsche, der mit den Kamelen zu gehen pflegte, ging es gut; er hatte nur den großen Fehler, uns zuviel Mais wegzufressen, denn das gelbe Gebirgsgras verschmähte er verächtlich.
Die letzten im Zuge waren die Pferde mit ihren Lasten und Treibern. Jede Abteilung passierte das Hauptquartier, wo ich inmitten der Kosaken stand, und alle Leute grüßten der Reihe nach höflich. Es dauerte eine ziemliche Weile, bis die ganze Gesellschaft vorbeigezogen war, um unmittelbar südlich vom Hauptquartier die Zelte aufzuschlagen und das Gepäck aufzustapeln. Die Lasten wurden so gestellt, daß sie ein Gehege für die Schafe bildeten, von denen wir jetzt eine ganze Herde hatten, die Wanka, dem Leithammel aus Kutschar, auf den Märschen gehorsam folgten. Wanka begleitete die Karawane schon seit dem Herbst 1899 und war das einzige von allen zu Beginn der Reise mitgenommenen Karawanentieren, das wir im Jahre 1902 wieder mit nach Kaschgar brachten.
Für mich wurde eine ganz neue Jurte aufgeschlagen, welche die Kosaken in Tscharchlik angefertigt hatten. Als das ganze Lager fertig war, glich das Ufer des Salzsees einem lebhaft besuchten Korso mit Gruppen von Leuten, die um rauchende Feuer saßen und plauderten. Die Tiere zerstreuten sich auf der kargen Steppe, um sich ihre knappe Nahrung zu suchen. Unterdessen tobte die Brandung am Ufer, und ein Sturm wühlte den See auf. Dicht und kalt schlug der Regen uns entgegen und durchnäßte unsere Ansiedlung.
Zur Erledigung verschiedener Arbeiten war ein Ruhetag am Kum-köll erforderlich. Ich packte alle meine Kisten gründlich um, damit ich die Sachen und Instrumente, die täglich gebraucht wurden, in den beiden, stets in meiner Jurte stehenden Kisten immer gleich bei der Hand hatte. Das meteorologische Observatorium, das unter Sirkins Aufsicht stand, wurde bei ihm in einer besonderen Kiste verwahrt, und die Thermometer wurden auf jedem Lagerplatz in einem kleinen geschützten Schuppen aufgestellt. Diejenigen der Konserven, die in der nächsten Zeit gebraucht werden sollten, wurden ausgepackt. Eine Anzahl wenig tauglicher Esel mußte, da ihre Lasten verzehrt worden waren, mit einigen Eseltreibern wieder umkehren.
[S. 116]
Hier sollte sich auch der Lama endgültig entschließen, ob er mitkommen oder umkehren wollte. Er hatte sich die Sache entschieden überlegt und mit Li Loje eine kleine Intrige angezettelt. Letzterer, der jetzt fast ein Jahr lang tadellos seinen Dienst verrichtet hatte, bat um seine Entlassung und gab als Grund an, er habe erfahren, daß sein alter Vater in Kerija gestorben sei, und müsse deshalb unverzüglich dorthin, um seine Interessen wahrzunehmen. Dies wurde ihm natürlich nicht geglaubt, denn dieselbe Geschichte hatte er uns schon bei ein paar Gelegenheiten mitten in der Wüste einreden wollen. Das Schlimmste aber war, daß er seinen Lohn in Tscharchlik für ein halbes Jahr voraus bekommen hatte. Es war eigentlich recht eigentümlich, daß er nicht einfach durchbrannte, da er ja sein eigenes Pferd, eines der besten der ganzen Truppe, hatte. Von nun an ließ ich ihn eine Zeitlang bewachen, damit er nicht in einer Gegend, wo wir ihn nicht mehr einholen könnten, verduftete. Der Lama hatte beschlossen, Li Loje zu begleiten, um die Mongolenkarawane dann in Tschimen oder Zaidam aufzusuchen. Als er aber sah, daß der Mann doch bei uns bleiben mußte, wurde auch er anderen Sinnes, suchte mich in meiner Jurte auf und erklärte, daß er mir bis ans Ende der Welt folgen werde, was auch daraus entstehen möge. Das einzige, was er erbat, war, nicht verlassen zu werden, falls er erkranken sollte; er sah selbst bald ein, daß er in dieser Beziehung nichts zu fürchten hatte, da nicht einmal eines der Tiere ohne weiteres verlassen wurde. So ordnete sich diese Sache im Handumdrehen. Ohne den Lama hätten wir in den bewohnten Gegenden Tibets kaum fertig werden können, und Li Loje (alias Tokta Ahun) war, obwohl ein bißchen verrückt, bei allen beliebt. Er erzählte lustige und grauliche Geschichten und führte sich bis Ladak ausgezeichnet.
Schließlich wurden alle Muselmänner zusammengerufen und Turdu Bai feierlich zum Tugatschi-baschi (Kamelobersten) ernannt. Hamra Kul, ein großer, kräftiger Mann aus Tscharchlik, der seinen sechzehnjährigen Sohn Turdu Ahun bei sich hatte, wurde Att-baschi (Pferdeoberst); die anderen hatten diesen beiden in allem, was mit der Wartung der Tiere zusammenhing, unbedingt zu gehorchen. Mollah Schah erhielt keinen Befehlshaberposten, weil er, dessen Aufgabe es gewesen war, die Pferde am Kum-köll zu bewachen, gar nicht gemerkt hatte, daß ihm die ganze Herde fortgelaufen war. Er fing die meisten allerdings noch vor Abend wieder ein, aber fünf wurden erst am nächsten Morgen wiedergefunden. Natürlich hatten die Kosaken einen höheren Rang als die Muselmänner, und jeder von ihnen hatte seine bestimmte Beschäftigung und überwachte das Ganze.
[S. 117]
So brach denn der erste Tag auf dieser Reise im innersten Asien an, an welchem ich die ganze Karawane auf einer Stelle versammelt hatte und vom Rücken meines prächtigen, weißen Reitpferdes mein wanderndes Eigentum mustern konnte. Wir ließen jetzt keine Abteilung hinter uns zurück; das Hauptquartier selbst war auf dem Marsche, und wir brauchten uns nicht um Abwesende zu beunruhigen. Mit dem Abbrechen des Lagers und dem Beladen der Tiere ging es ziemlich schnell; denn jeder der Leute hatte seine bestimmte Arbeit. Während einige die Zelte abnahmen und die Kisten packten, hoben andere die Proviantlasten auf Kamele und Pferde, und sobald eine Abteilung fertig war, brach sie auf.
Voran marschierten die Kamele in fünf verschiedenen Gruppen, jede mit einem Führer; die erste führte Turdi Bai selbst. Wie unter den Männern, so waren auch unter den Tieren einige, die besondere Beachtung verdienten, z. B. die drei Kamelfüllen, die ihren Müttern treu folgten und sich bei diesen dann und wann einen Schluck Milch holten. Sogar das jetzt 33 Tage alte Junge legte seine 38 Kilometer mit Leichtigkeit zurück. Unter den älteren Kamelen zeichnete sich namentlich der große, schöne „Bughra“ (Hengst) aus, der mir 1896 durch die Kerijawüste und nach dem Lop-nor geholfen und den wir jetzt in Tscharchlik wiedergekauft hatten. Sein Gang war ruhig und majestätisch, und mit Resignation betrachtete er die öden Gebirge, die ihm bald sein Leben kosten sollten. Nahr, der Dromedarhengst, war noch immer gehalftert, um nicht um sich beißen zu können; er hatte uns durch die Gobi bis Lôu-lan begleitet. Die beiden „Artan“ (Wallachs), die alle drei Wüstenreisen mitgemacht hatten und von denen ich das eine geritten hatte, trugen jetzt, weil sie völlig leidenschaftslos und ruhig waren, meine Instrumentkisten. Mein altes Reitkamel war eines der neun, die schließlich Ladak erreichten.
Auch Pferde und Maulesel, 45 an der Zahl, wurden in getrennten Gruppen geführt, respektive getrieben und von Fußgängern begleitet, die aufpaßten, daß die Lasten auf beiden Seiten gleiches Gewicht hatten und[S. 118] nicht herunterglitten. Die Schafe folgten Wanka, und man brauchte sich nur von Zeit zu Zeit nach ihnen umzusehen. Unsere acht Hunde liefen in munterem Spiel nebenher und waren sichtlich von dem ganzen Unternehmen sehr erbaut. Der Hirsch wurde auf dieser Tagereise sehr krank oder erschöpft und ließ sich nicht länger zum Maisfressen bewegen. Er blieb unaufhörlich zurück, und da ich sah, daß er nicht die Kraft hatte, mit uns Schritt zu halten, ließ ich ihn blutenden Herzens schlachten. Das Knochengerüst wurde der Skelettsammlung beigefügt.
Zuletzt wurden die Esel fertig, und wir verloren sie bald aus den Augen. Sie gelangten abends nicht einmal bis an das Lager. Von ihnen werden bestenfalls nur einige wenige diese Reise überleben. Jetzt waren ihrer etwa 60.
Diese lange Karawane von Tieren, die mit Kisten, Zelten, Jurten, Ballen und Säcken beladen waren, gewährte in der öden Landschaft einen ebenso großartigen wie malerischen Anblick. Es war eine bunte Truppe, die langsam und schwer an dem blaugrünen See entlangzog. Die ungleichartigen Trachten und Typen trugen zur Abwechslung bei: die Kosaken, Russen und Burjaten, mit ihren abgetragenen Uniformen und den hinter dem Sattel mit Riemen festgeschnallten Pelzen, die Muhammedaner mit ihren Tschapanen und Fellmützen, Eseltreiber, die große Ähnlichkeit mit einer Rotte von Lumpen und Landstreichern haben; der Lama in seinem roten Gewande taucht wie das gutmütige Heinzelmännchen der Karawane bald hier, bald dort auf. Das Ganze erinnerte an ein Heer auf Kriegsfuß, das auszieht, um neue Länder zu erobern. Es war auch wirklich so; aber die Eroberung war friedlicher Art, da sie nur den Zweck hatte, dem menschlichen Wissen bisher unbekannte Länder zu unterwerfen. Noch sah die Karawane stark und lebenskräftig aus, aber man brauchte nur einen Blick um sich zu werfen, um zu ahnen, daß sie von dem Augenblicke an zum Untergange verurteilt war, als sie ihre Schiffe hinter sich verbrannt hatte und südwärts über die öden Hochebenen des nördlichen Tibet zog. Jetzt freilich befanden sich ihre Mitglieder in vorzüglicher Verfassung, aber wie lange würde es so bleiben? Dort dehnte sich wohl ein See aus, aber sein Wasser war salzig, und nicht einmal die Wildgänse rasteten an seinen Ufern; hier gab es wohl eine Steppe, aber ihr Graswuchs war verdorrt, erfroren und hart, und die Berge, nach denen wir unsere Schritte lenkten, zeigten ihre grauschillernden, verwitterten, felsigen Abhänge, auf denen nicht ein einziger grüner Fleck zum Grasen war. Daß es nur eine Frage der Zeit war, wie lange wir aushalten konnten, wußte ich aus Erfahrung; ohne Opfer würde die Fortsetzung der Reise nach Süden nie möglich sein. Die Karawane mußte von Tag zu Tag kleiner werden, und nur ein Fünftel davon sollte dieses unheimliche,[S. 119] mörderische Land verlassen! Dreißig Kamele sollten hier umkommen, und von den Pferden sollte nur ein einziges nach Ladak gelangen. Ich hatte 30 Leute; viele von ihnen sollten aber am Arka-tag wieder umkehren, namentlich alle die, welche mit dem Eseltransporte zu tun hatten. Von den übrigen, die für die ganze Reise gedungen waren, sollten auch nicht alle mit dem Leben davonkommen!
Ich selbst ritt bald an der Spitze, bald am Ende des Zuges, mit meinen gewöhnlichen Arbeiten beschäftigt, von denen die Aufnahme der Marschroute die meiste Zeit in Anspruch nahm.
Anfangs gehen wir längs des Ufers nach Süden, müssen es aber tückischer Moräste und Sümpfe wegen bald verlassen. Die Richtung ist dann südöstlich, und zu unserer Linken liegt eine große Lagune mit sehr salzigem Wasser. Die Hügel, die wir auf einem kleinen Passe überschreiten, bestehen aus weichem, lockerem Material, auf dem die ziemlich schwerbeladenen Kamele nur schwer und mühsam gehen können. Auf der anderen Seite ging es beinahe senkrecht nach einem Flusse hinunter, der ein wahres Höllenloch mit ziegelrotem Schlammboden durchströmte, in welchem man ertrinken konnte, wenn man nicht mitten im Flußbette blieb. Sogar dieses lebhaft fließende Wasser hatte einen bitteren Salzgeschmack. Die Kamele gleiten aus und sinken oft bis an die Knie ein. Im ersten besten Nebentale suchen wir Erlösung von diesem Elend, überschreiten noch einen Paß und noch ein Tal und gehen ein drittes, nach Süden führendes hinauf. Auch dieses lag zwischen jähen Wänden von lockerem, rotbraunem Material. Die phantastischsten Türme und Festungsmauern sind hier ausgemeißelt, und man glaubt, durch die Ruinen einer alten Stadt zu reiten.
Jetzt galt es nur, einen einigermaßen brauchbaren Lagerplatz zu finden; als aber unsere Bemühungen auch beim Einbruch der Dämmerung nicht mit Erfolg gekrönt waren, wurde das Lager Nr. 12 in der ödesten Gegend, die man sich denken kann, aufgeschlagen. Weide und Brennstoff zu finden hatten wir gar nicht erwartet, aber hier fehlte es sogar an Wasser. Glücklicherweise fing es um 9 Uhr ziemlich heftig zu schneien an; alle Gefäße wurden ins Freie gestellt, und wir bekamen so viel Schnee, daß das Wasser daraus zu einigen Schlucken Tee für jeden reichte. Den Tieren wurde so viel Mais gegeben, wie sie haben wollten; die Esel würden doch nicht mehr sehr lange mitkommen können, und dann war es besser, uns ihrer Lasten auf diese Weise zu entledigen, als sie im Stiche zu lassen.
Nachdem das Schneien aufgehört hatte und der gefallene Schnee verdunstet oder aufgetaut war, begannen wir spät abends einen Brunnen zu graben, der noch in 99 Zentimeter Tiefe kein Wasser gab und deshalb nicht weitergegraben wurde. Doch am nächsten Morgen hatte sich in ihm[S. 120] eine nicht unbedeutende Wassermenge angesammelt, die für alle Mann reichte; ja, selbst die Hunde bekamen etwas davon ab. Dowlet holte uns mit der halben Eselkarawane ein; damit sich auch die andere Hälfte mit uns vereinigte, wurde nur ein kurzer Tagemarsch gemacht.
Tschernoff hatte die Gegend rekognosziert und führte uns nach Südwesten über ebenes, hartes Erdreich, das dünn mit Jappkakpflanzen bestanden war und nach allen Richtungen hin von Kulanpfaden durchkreuzt wurde. Noch sah man im Norden die Kalta-alagan-Kette, aber der See, der diesseits derselben liegt, wurde von den Hügeln, die wir gestern überschritten hatten, verdeckt. An das charakteristische tibetische Wetter waren wir schon gewöhnt: heftige Hagelschauer, denen Sonnenschein auf dem Fuße folgt, oder auch klare Luft über unserer Gegend, aber schwarze, freigebige Wolken ringsumher.
Wie auf dem Marsche innerhalb der Karawane eine bestimmte Ordnung herrscht, so entsteht auch das Lagerdorf nicht aufs Geratewohl. Derselbe Plan wiederholt sich allabendlich, nur mit unbedeutenden, durch die Gestalt des Bodens bedingten Abänderungen. An dem einen Ende der Lastenstapelreihen hat Turdu Bai sein Zelt (Abb. 231), wo auch Hamra Kul, Mollah Schah und Rosi Mollah wohnen. Letzterer, der muhammedanische Priester der Karawane, ist ein vierzigjähriger, des Schreibens kundiger, sehr netter und zuverlässiger Mann. Er brachte wie Li Loje sein eigenes Pferd mit und erhielt gleich den meisten anderen Muselmännern monatlich 8 Sär.
Das zweite Zelt, von Turdu Bais Flügel gerechnet, beherbergt meine Küche und die der Kosaken; dort residiert Kutschuk allein. Er ist Tscherdons Gehilfe, welch letzterer für die nächste Zeit zu meinem Haushofmeister ernannt worden ist. Tschernoff ist der Koch der Kosaken. Unsere Küche ist also von derjenigen der Muselmänner getrennt, da diese nicht gern mit Ungläubigen speisen und religiöse Furcht vor Töpfen hegen, in die sich möglicherweise einmal ein Stück Schweinefleisch hatte hineinverirren können. Die Kosaken wollen ebensowenig ihre Töpfe mit Kulanfleisch beflecken, welches die Muselmänner wiederum sehr gern essen.
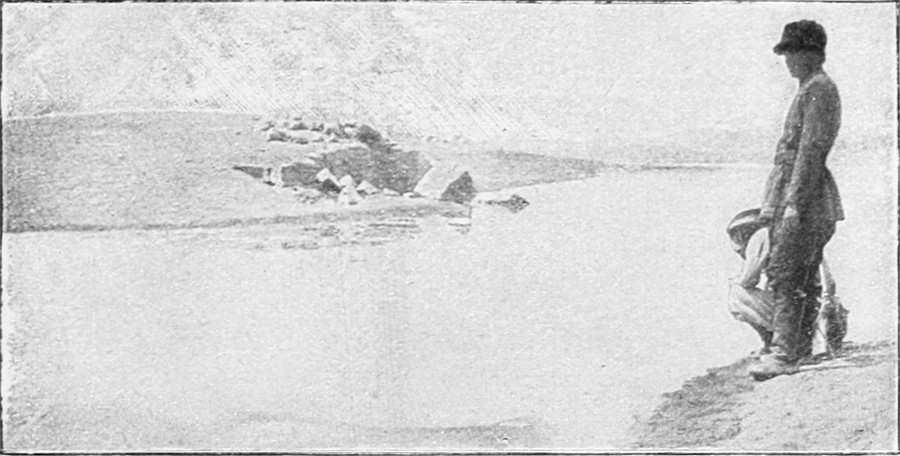

Die dritte in der Reihe ist die große, von Sirkin, Schagdur und dem Lama bewohnte Jurte. Jeder von ihnen hat sein Bett, das aus Filzdecken, Pelzen und einem Kopfkissen besteht, und eine Kiste für seine Sachen. Die Habseligkeiten der Eingeborenen nehmen dagegen wenig Raum ein und haben meistens in einer Kurtschin (lederne Doppeltasche) Platz. Schagdur ist jetzt nach seiner Krankheit jede Arbeit streng verboten. Es dauerte jedoch nicht lange, so hatte er seine frühere Kraft wiedererlangt und hob Kisten und Lasten mit demselben festen Griffe wie vor der Krankheit. Dem Lama hatte ich ein für allemal erklärt, daß er als „Doktor der Theologie“ nichts mit den gröberen Karawanenarbeiten zu tun habe, da diese von den Muselmännern[S. 121] besorgt würden. Ich sagte ihm, seine einzigen Pflichten seien, mir wie bisher Unterricht im Mongolischen zu geben und späterhin unser Dolmetscher für das Tibetische zu sein, unser „Tangut kälä“, wie es auf mongolisch heißt. Doch wie oft ich ihm dies auch wiederholte, er kehrte sich nicht daran. Es gab keine Arbeit, die dem Lama für seine an heilige Folianten gewöhnten weichen Hände zu grob erschien. Er hob schwere Kisten auf die Kamele und von den Kamelen herunter, und Turdu Bai sagte lachend, er habe an ihm einen ausgezeichneten Handlanger. Hierdurch gewann der Lama eine gewisse Popularität bei den Karawanenleuten und stachelte den Ehrgeiz der Muhammedaner an; ein Rechtgläubiger durfte ja nicht schlechter sein, als ein „Kaper“, ein Heide, der Schweinefleisch ißt. Der Lama besaß eine scharfe Beobachtungsgabe und große Menschenkenntnis. Es währte gar nicht lange, so hatte er die Muhammedaner sowohl nach ihrem Werte als Menschen wie nach ihrer Arbeitstüchtigkeit in eine Rangordnung gebracht.
Darauf folgt Tschernoffs und Tscherdons kleine Jurte. Tschernoff überwacht alle gröberen Arbeiten in der Karawane und ist dafür verantwortlich, daß jeder seine Pflicht tut, und Tscherdon ist, wie gesagt, mein „Leibdiener“ und Koch.
Zu äußerst auf dem entgegengesetzten Flügel steht meine Jurte, bewacht von Jolldasch und Jollbars, die manchmal gar zu eifrig auf eingebildete Feinde losfahren, nämlich auf unsere eigenen Pferde und Kamele, die friedlich in der Gegend umherstreifen oder, wenn sie vergebens nach Gras gesucht hatten, nach Turdu Bais Zelt zu gehen pflegen, um sich dort Mais zu holen.
Die übrigen Karawanenleute müssen sich mit etwas provisorischeren „Zelten“ begnügen. Sie breiten Filzteppiche über die Kamellasten und finden darunter eine Lagerstatt. Ihr Essen kochen sie an den verschiedenen Feuern, die mitten auf den Straßen und dem Markte der Lagerstadt brennen. Einige von ihnen müssen jedoch die ganze Nacht unsere Tiere hüten und dafür sorgen, daß diese sich nicht zu weit entfernen. In dieser schweren Arbeit lösen sie jedoch einander ab, und Tschernoff paßt auf, daß hierbei keine Ungerechtigkeit vorkommt. Manchmal reitet er mitten in der Nacht zu den Herden, um sich zu überzeugen, daß die Hirten nicht schlafen. Was die Schafe betrifft, so wird für sie stets von den Lasten eine Hürde zurechtgemacht, denn in dieser Gegend ist man vor Wölfen nicht sicher.
Sobald die Ansiedlung für eine Nacht fertig dasteht, herrscht zwischen ihren luftigen Hütten eine gute Weile Leben und Bewegung. Dann schwirren drei Sprachen durcheinander, Dschaggataitürkisch, Russisch und Mongolisch. Allmählich verstummt jedoch die Unterhaltung, Turdu Bai führt die Kamele auf die Weide, wenn es in der Gegend solche gibt, Hamra Kul macht es[S. 122] mit den Pferden ebenso, und beide erteilen ihre Befehle hinsichtlich der Behandlung und Bewachung der Tiere. Wenn an einem Packsattel ein Saum aufgegangen ist, wird er wieder zugenäht, und wenn ein Kamel oder Pferd hinkt oder kränklich ist, wird es im Lager zurückbehalten und mit besonderer Fürsorge gepflegt. Hier werden die Feuer angezündet, die wir jetzt beinahe ausschließlich mit trockenem Miste von Kulanen oder wilden Yaken unterhalten. Einen kostbaren Reservevorrat von Brennholz haben wir an den starken Leitern, an denen der Proviant festgebunden ist. In dem Maße, wie dieser zusammenschrumpft, werden die Leitern überflüssig; sie werden aber nur im äußersten Notfall als Feuerung verwendet, anfangs nur, um den oft noch feuchten Dung zum Glühen zu bringen. Sobald er in Glut ist, werden die Töpfe aufgesetzt und das Essenkochen beginnt. Um die Feuer herum sieht man Gruppen von Männern, die sich eifrig miteinander unterhalten und sich der Ruhe freuen. Wenn der gewöhnliche Weststurm mit tüchtigem Schneetreiben anhebt und, wie heute, die Gegend in wenigen Minuten kreideweiß und winterlich macht, decken sie sich einfach mit einer Filzmatte zu und fahren in größter Ruhe mit der Speisenbereitung fort. Meine Jurte ist in einer Viertelstunde fertig. Die Filzdecken und Pelze, aus denen mein Bett besteht, liegen wie die der anderen unmittelbar auf der Erde. Ich lasse mich auf dem Bette nieder und trage die Beobachtungen des Tages in die Tagebücher ein. Nach dem Abend- oder Mittagsessen, wie man diese Mahlzeit nennen will, wird das am Tage entworfene Kartenblatt ausgearbeitet, die Kompaßpeilungen und die Entfernungen ausgerechnet und der neue Lagerplatz auf einem Übersichtsblatte angegeben. Ich weiß also stets, wo wir uns befinden, kann mich davor hüten, mich den westlich von uns liegenden Routen Littledales und Dutreuil de Rhins und den östlich von uns befindlichen Wegen des Prinzen von Orléans und Bonvalots zu sehr zu nähern, und bin auch imstande, die Richtung nach Lhasa einzuhalten.
Das Lager der Eselkarawane befindet sich ganz in der Nähe des unsrigen. Einstweilen sind dort nur 30 Esel; die anderen sind noch nicht erschienen. Am folgenden Morgen, 8. Juni, mußte der alte Dowlet umkehren, um sie zu suchen.
Wir dagegen zogen südwärts durch ein ausgetrocknetes Tal. Kärgliche Weide gibt es hier überall, aber keine anderen Tiere als Hasen. Der Himmel bleibt immer noch bewölkt. Nach und nach wird das Terrain beschwerlich. Hunderte von kleinen, wasserlosen Bachrinnen ziehen sich nach einem nach Norden gerichteten Tale, das zu unserer Linken liegt. In dieses gehen wir hinunter und folgen ihm dann aufwärts. Es ist ziemlich tief in die Hügel eingeschnitten, und der Bach, der hier seinen Abfluß gehabt[S. 123] hat, hat den Talboden derartig aufgelockert und weichgemacht, daß die Kamele einsinken. Es klatscht nach jedem Schritte, den die schweren Kolosse in dem Moraste zurücklegen. Der lange, schwarze Zug folgt jedoch getreulich den Windungen des Korridors, aber der greuliche Hohlweg wird immer nasser und enger. Unaufhörlich erschallen eifrige Mahnrufe. Ein Kamel ist ausgeglitten und gefallen, ein Pferd hat sich seine Last abgeschüttelt, und ein Maulesel sitzt ganz im Schlamme fest.
Selbst die boshafteste Phantasie kann keinen scheußlicheren, die Geduld mehr auf die Probe stellenden Boden erdenken. Der Abstand zwischen den tief ausgemeißelten Erosionsfurchen beträgt oft nur einen Fuß; Millionen solcher kleiner Rinnen vereinigen sich zu größeren, diese wieder zu noch kräftigeren, die schließlich in das nach dem Kum-köll führende Haupttal münden. Die Abhänge fallen überall sehr steil nach diesen Rinnen ab, und auf dem Schlammboden des Haupttales geht es sich, als hätte man Bleisohlen an den Stiefeln oder schwere Gewichte an den Beinen. Alle gehen natürlich zu Fuß. In einer Lache blieb mein einer Stiefel stecken, und ich fuhr mit dem Strumpfe bis ans Knie in den Morast. Die Wege, die zu Dantes Hölle führen, können nicht scheußlicher sein, als diese siebenmal verwünschte Schlammstraße, die an den Kräften der Karawane unnötigerweise zehrte. Zwei Kamele wurden so matt und unbrauchbar, daß sie von ihren Lasten befreit werden mußten. Aus der Ferne hatten diese Höhen so sanft und niedrig ausgesehen, daß die Männer uns fast ebenes Terrain prophezeit hatten.
Schließlich wurde es gar zu toll, und wir konnten keinen Schritt mehr vorwärts; wir mußten aus diesem Loche heraus, gleichviel wohin, denn schlimmer konnte es nicht werden. Turdu Bai wollte mit der Karawane auf die zu unserer Linken liegenden Höhen hinaufflüchten und stellte ein Dutzend Leute an, die mit Spaten einen steilen Weg gruben. Unterdessen ritt Tschernoff weiter und kehrte bald mit der Nachricht zurück, daß in dieser Richtung nicht einmal ein Fußgänger weiter vordringen könne.
Nun befahl ich kehrtzumachen, und mit großer Schwierigkeit kehrte der lange, schwerbeladene Zug in seinen eigenen Spuren um. Es war so wenig Platz vorhanden, daß jedes Tier auf dem Flecke, wo es sich befand, wenden mußte. Das Zurückgehen war noch fürchterlicher, denn der Boden war jetzt noch mehr aufgeweicht. Nach unzähligen Mißgeschicken kamen wir aus der verwünschten Falle endlich wieder heraus.
Sirkin rekognoszierte jetzt ein anderes Tal, das von einem kleinen Passe im Westen kam. Dieses ritten wir hinauf. In der Mitte des Tales war ein jetzt ausgetrocknetes Flußbett mit senkrechten Uferwänden. Ein paarmal mußten wir es überschreiten, und wieder wurden alle Spaten in Tätigkeit gesetzt, um Wege in die wie Mehl stäubende rote Erde zu graben.
[S. 124]
Verzweifelt langsam bewegte sich die erschöpfte Karawane vorwärts. Ich saß auf dem kleinen Passe und ließ sie vorbeidefilieren. Endlich hatte ich sie alle nach der anderen Seite, wo das Terrain offener war, hinuntergehen sehen. Nur eines der beiden schwachen Kamele war mit Mühe hinüberzubringen. Fünf Mann mußten es buchstäblich hinaufschieben. Es wird gewiß das nächste Tier sein, welches daraufgeht.
Wir rasteten auf einer kleinen Wiese an einem Quellbache. Diesmal beschlossen wir aus vier verschiedenen Gründen liegenzubleiben. Erstens war die Weide hier außergewöhnlich gut, viel besser als am Kum-köll, zweitens waren die Tiere abgehetzt, drittens mußten wir auf die Esel warten, die wir ganz aus den Augen verloren hatten und die sich bisher als ganz marschunfähig erwiesen hatten, — während der beiden letzten Tagereisen waren viele von ihnen zusammengebrochen. Und schließlich war es notwendig, Kundschafter südwärts zu schicken, um einen gangbaren Weg zu suchen, denn es ist verkehrt, in unbekanntem Lande mit der ganzen Karawane einfach draufloszugehen. Die Rekognoszierung wurde Mollah Schah und Li Loje anvertraut, die nicht eher wiederkommen sollten, als bis sie einen gangbaren Weg gefunden hätten.
Um 3 Uhr herrschte ein Sturm aus Westen mit Schnee und um 9 Uhr ein Sturm aus Osten. Halb über ein Kohlenbecken gebeugt, sitze ich im Pelz bei meiner Arbeit, und dabei befinden wir uns im Hochsommer, 24 Breitengrade südlich von Stockholm! Dafür beträgt die absolute Höhe aber auch über 4000 Meter! Die Kamele sind zu bedauern, daß sie gerade, nachdem sie ihre Wolle verloren haben, ganz nackt in ein so kaltes Land haben hinaufziehen müssen; sie werden daher, so gut es geht, in die enganschließenden dicken Filzmäntel gehüllt.
Der Rasttag fing mit wirbelndem Schneesturme an. Um die Mittagszeit klärte es sich jedoch auf, so daß ich eine Breitenbestimmung ausführen konnte, und dann taute der Schnee wieder auf. Abends kehrten die Kundschafter zurück und erklärten den Weg nach Süden hin für gangbar; es wurde beschlossen, früh aufzubrechen, die Esel im nächsten Lager zu erwarten und für den nächsten Tagemarsch wieder Kundschafter auszuschicken. Es ist nicht so leicht, durch Tibet zu reisen, wie mancher vielleicht glaubt; es erfordert im Gegenteil außerordentlich große Umsicht. Die Nachtkälte sank auf −13 Grad, und bei Tag stieg das Quecksilber nicht viel über Null.
Den Fußspuren der Kundschafter folgend, zogen wir jetzt gen Süden. Das schwächste Kamel durfte unbeladen gehen, blieb aber nichtsdestoweniger schon zu Anfang des Marsches zurück und mußte mit einem Manne unterwegs liegengelassen werden. Ein anderes, das alles, was Paßübergang[S. 125] hieß, verabscheute, machte uns viele Beschwerde. Sobald es fand, daß es zu steil bergan ging, blieb es einfach stehen, und ein Pferd mußte seine Last übernehmen. Bergab ging es gut, doch unweit des Lagers weigerte es sich, wieder aufzustehen und wurde mit einem Wächter zurückgelassen.
Das Terrain war hier günstig; nur ein Tal zwang uns, eine lange Strecke ostwärts zu gehen. Über unzählige Bachbetten und die zwischen ihnen liegenden Erhöhungen hinweg schlagen wir dann wieder eine südliche Richtung ein und gelangen an das linke Ufer des größten Flusses, den wir seit langer Zeit gesehen haben. Er ist wasserreich, und große Eisschollen glänzen in seinem Bette. Auf einer Anhöhe, wo das erste junge Gras dieses Jahres sproßte, wurde Halt kommandiert. Ich ging bis an den Rand des Ufers und befand mich da über einem gähnenden Abgrund mit meist völlig senkrechten Geröllwänden von 23,1 Meter Höhe. Eine solche Stelle ist für die wenig überlegenden Kamele gefährlich. Das lose Erdreich am Rande kann unter ihrem Gewichte nachgeben, und die Tiere können dabei in die Tiefe stürzen. Sie wurden deshalb nach einem sichereren Tale zurückgeführt. Turdu Bai bugsierte das zuletzt zurückgelassene Kamel in das Lager. Am Abend stellte sich Dowlet mit 30 Eseln ein.
Auf diesem in jeder Beziehung für uns geeigneten Lagerplatze brachten wir drei Tage zu. Sie waren sehr notwendig, um Ordnung in die Karawane zu bringen. Noch sechs Esel gesellten sich mit ihren Lasten zu den bereits eingetroffenen. Da die übrigen gar nichts von sich hören ließen, sandte ich Tscherdon mit einigen Mauleseln und Pferden zurück, um sich nach ihnen umzusehen und ihnen zu helfen; er kam erst am dritten Tage mit dem Gepäck wieder. Von den Eseln waren an dem einen Tage neun, am anderen dreizehn zusammengebrochen; nur ein paar waren noch am Leben, aber auch nicht mehr brauchbar.
Die Kosaken beschäftigten sich mit Jagd, denn auch in dieser Beziehung war die Gegend besonders günstig. Sie erlegten mehrere Orongoantilopen und Gänse, welch letztere sich auf ihrer Rückreise nach Norden hier ausruhten.
Sirkin und Mollah Schah sollten jetzt für die Führung einstehen und nahmen für den Fall, daß sie auf dem nächsten Lagerplatze noch nicht wieder zu uns stoßen würden, Pelze und Proviant mit. An diesem Tage, 14. Juni, war jedoch das Terrain gut; wir ritten das große, offene Tal, das nur geringe Steigung hatte, hinauf. Nur ab und zu, im eigentlichen Talgrunde, war der Boden gefährlich, und man mußte erst untersuchen, ob er trug. Tschernoff war einmal drauf und dran zu versinken und konnte sein Pferd nur mit Mühe retten. Wildgänse sind überall zu sehen. Die Leute glaubten bestimmt zu wissen, daß es die Art war, die nicht weiter als bis an den oberen Kum-köll geht.
[S. 126]
Einer der Kosaken schoß ein paar von ihnen. Wir befanden uns da noch oben auf der Terrasse, und die verwundeten Gänse flatterten unten auf dem Boden des Tales. Ördek stürzte sich mit bewunderungswürdiger Gewandtheit den Abhang hinunter und bemächtigte sich ihrer. Er hatte sich dabei jedoch zuviel zugemutet und wurde hinterdrein vor Atemnot und Herzklopfen beinahe ohnmächtig. Nachdem er die Gänse getötet hatte, blieb er eine Zeitlang auf dem Rücken liegen; ich schickte einige Leute zu ihm hinunter. Nach einer Stunde war er jedoch wieder ebenso munter wie vorher. Schagdur schoß drei Rebhühner, und eine Strecke weiter wurde eine Orongoantilope entdeckt, die Sirkin im Vorbeireiten erlegt hatte (Abb. 232.) Auf diese Weise vergrößerte sich der Proviantvorrat. Kulane waren besonders zahlreich vertreten und zeigten sich in Herden von etwa 20 Tieren. Von wilden Yaken sahen wir nur Fährten und Dung, aber auch letzterer war wertvoll, und auf jedem Marsche wurden ein paar große Säcke damit gefüllt, um unseren Brennstoffvorrat zu vermehren.
Beim dumpfen Geläute der großen Glocken schreitet die Karawane in der gewöhnlichen Zugordnung langsam vorwärts. Vor uns erhebt sich eine mächtige Bergkette; wir schlagen den Weg nach einer ihrer Talmündungen ein. Hier wuchs niedriges, dichtes Gras, und eine große, dicke Eistafel füllte das Bergtor aus. Der Platz eignete sich viel zu gut für das Lager, als daß wir daran hätten vorbeigehen können (Abb. 234).
Die Zelte waren kaum aufgeschlagen, als sich eine unerwartete Episode zutrug. Wir hatten die große Eismasse dicht neben uns; jenseits derselben sah man einen schwarzen Gegenstand, den die Männer für einen Stein hielten. Als er aber anfing sich zu bewegen, meinten sie, es sei ein im Stiche gelassener Yak. Ich hörte, daß in der Jurte der Kosaken eifrig leise gesprochen wurde, und dann kam Tschernoff mit dem Fernglas zu mir geschlichen und flüsterte, vor Aufregung und Jagdeifer glühend: „Ein Bär geht gerade auf das Lager los!“ Und richtig, ohne von den Zelten und den dicht dabei weidenden Kamelen die geringste Notiz zu nehmen, spazierte der Petz weiter, als gehöre er zur Gesellschaft. Schnell wurden alle Hunde gekoppelt und hinter einen Hügel gebracht, damit sie die Jagd nicht störten. Die Kosaken wollten sogleich zu Pferd steigen und den ungebetenen Gast empfangen, denn sie glaubten, daß er uns bald wittern und dann die Flucht ergreifen würde, aber ich riet ihnen nur ruhig zu warten; es machte mir zuviel Spaß, die Bewegungen des Tiers durch das Fernglas zu beobachten.
Der zottige Einsiedler muß blind und taub gewesen sein, denn er trottete ruhig weiter. Jetzt war er an der Eistafel, kaum 200 Schritt von uns; er betrat sie und überschritt sie diagonal, immer gerade auf unser Lager zu. Sein Gang war außerordentlich langsam, er war entschieden[S. 127] müde. Manchmal blieb er stehen, um das Eis zu beschnüffeln, und den Kopf hielt er die ganze Zeit gesenkt. Dann verschwand er in einer Vertiefung des Eises, wo er sich eine Weile aufhielt, um zu saufen. Jetzt riet ich den Schützen, sich nach dem Eisrande zu schleichen und ihn dort mit gespanntem Hahne zu erwarten.
Darauf ging er seinen ruhigen Gang weiter, gerade in den Rachen des Todes hinein. Die drei Schüsse krachten so gleichzeitig, daß sie wie ein einziger klangen. Der Petz drehte sich nicht um, sondern eilte im Galopp am Lager vorbei und den nächsten Abhang hinauf. Pferde standen schon bereit, im Nu waren die Schützen im Sattel und hinter drein, eine neue Salve ertönte, und wie ein Ball rollte die Bestie den Abhang herunter.
Ich begab mich mit dem großen photographischen Apparate dorthin und machte ein paar Aufnahmen von dem Eremiten der öden Gebirge, dem tibetischen Bären (Abb. 233). Dann wurde er abgehäutet, das Fell und das Knochengerüst sollten aufgehoben werden. Sein Inneres war von den Kugeln ganz zerrissen. Es war ein uraltes Männchen; in den Zähnen, die es noch besaß, gähnten große Löcher; der arme Petz muß entsetzlich an Zahnweh gelitten haben, bis er auf diese radikale Weise kuriert wurde. Der Magen enthielt ein kürzlich verzehrtes Murmeltier und einige Kräuter. Ersteres hatte der Bär mit Haut und Haar verzehrt, die Knochen hatte er aber mit seinen schlechten Zähnen nicht durchzubeißen vermocht. Er hatte es jedoch recht pfiffig angefangen, um das Gericht so schmackhaft wie nur möglich zu machen. Er hatte nämlich das Murmeltier erst bis auf die Zehenspitzen abgezogen, dann das Fell mit den Haaren nach innen in einen Ball zusammengerollt und darauf diese Kugel ganz hinuntergeschluckt. Der Arme! Seine einsame Wanderung nahm ein Ende mit Schrecken. Aber warum mußte er sich auch gerade nach dem einzigen Fleckchen innerhalb eines Umkreises von Hunderten von Meilen begeben, wo Menschen mit ihren Flinten auf ihn lauerten?
Am nächsten Tage kamen Sirkin und Mollah Schah wieder und sagten für zwei weitere Tagemärsche gut. Am 16. Juni wären wir aufgebrochen, wenn ich nicht mit der Nachricht geweckt worden wäre, daß ein sehr heftiger Schneesturm herrsche; es hatte die ganze Nacht geschneit, und der Schnee lag 10 Zentimeter hoch. Wir warteten daher besseres Wetter ab, und da das Schneetreiben den ganzen Tag anhielt, blieben wir noch eine Nacht hier. Förmliche Schneewehen häuften sich um die Zelte an, und von den Filzdecken tropfte es in meine Jurte, denn die Temperatur blieb ein wenig über Null, und die Jurte wurde durch das Kohlenbecken nur schwach erwärmt.
[S. 128]
Der 17. Juni brachte uns um so schöneres Wetter; der Himmel war rein, und die Sonne bereitete der Schneedecke bald ein Ende. Es ging durch ein ziemlich breites, wasserloses Tal immer höher nach dem Arka-tag hinauf. Sirkin diente jetzt als Wegweiser. Als wir endlich an eine kleine Quelle gelangten, mußten wir rasten, um Wasser zum Abend zu haben. Der Graswuchs hatte aufgehört, nur hier und da wucherte saftiges, grünes Moos. Abends erhob sich ein heftiges Schneegestöber mit Nordnordwestwind; alle Jurten bedeckten sich mit weißen Kuppeln, die dazu beitrugen, das Innere nachts warm zu halten, und der Schnee knirschte unter den Fußschwielen der Kamele.
Noch waren wir nicht bis zu dem Punkte gelangt, bis zu welchem Sirkin rekognosziert hatte, und wir konnten also am nächsten Morgen weiterziehen, ohne unpassierbares Terrain befürchten zu müssen. Nach einer guten Weile erreichten wir endlich auf einem bequemen, flachen Passe den Kamm der Kette, die uns in den letzten Tagen die freie Aussicht nach Süden versperrt hatte. Von hier aus zeigte sich auf einmal die Möglichkeit für eine gute Tagereise nach Süden. Im Südwesten aber erhob sich eine vom Scheitel bis zur Sohle in Schnee gehüllte Bergkette, die nur unser alter Feind, der Arka-tag, sein konnte. Zwischen den beiden Bergketten, aber der, auf welcher wir uns befanden, näher liegend, dehnte sich ein abflußloses Becken aus, dessen Mitte ein kleiner, vollständig zugefrorener Süßwassersee bildete. Die Weide an seinen Ufern lud um so mehr zum Rasten ein, als wir jetzt wieder Kundschafter ausschicken mußten. Am nächsten Morgen in aller Frühe sollten drei Mann sich aufmachen. Entdeckten sie nach einem Ritte von 10 Kilometer Gras, so sollten sie alle zurückkehren, fanden sie aber keines, so sollte einer von ihnen uns Bescheid bringen und die anderen weiterreiten. Einer der Kundschafter kam mittags wieder, aber auf die beiden anderen mußten wir zwei volle Tage warten, worauf sie endlich mit der Nachricht heimkehrten, daß sie einen Paß entdeckt hätten, der allerdings nicht allzu bequem sei.
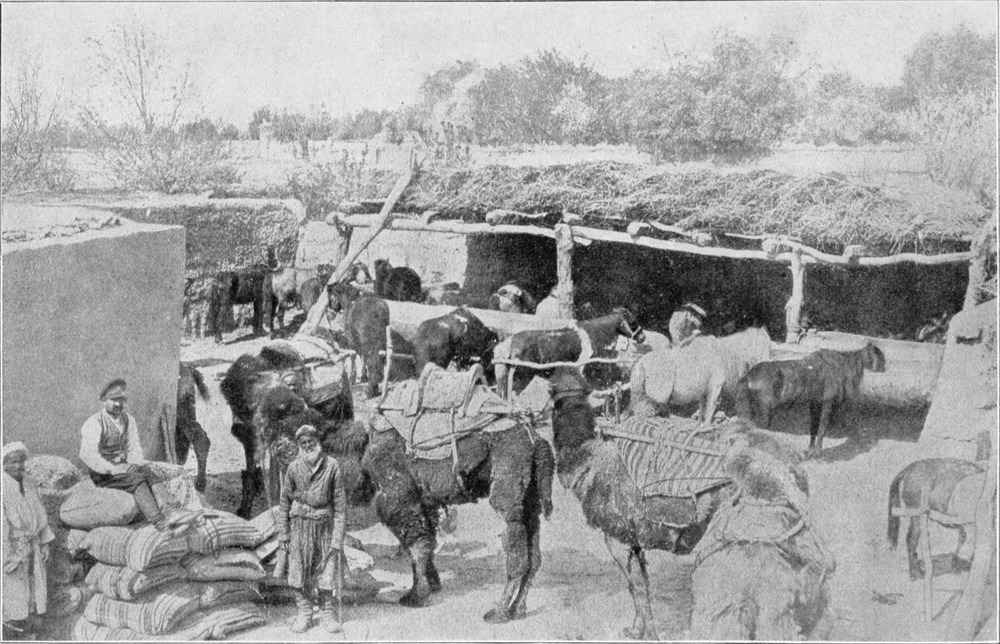
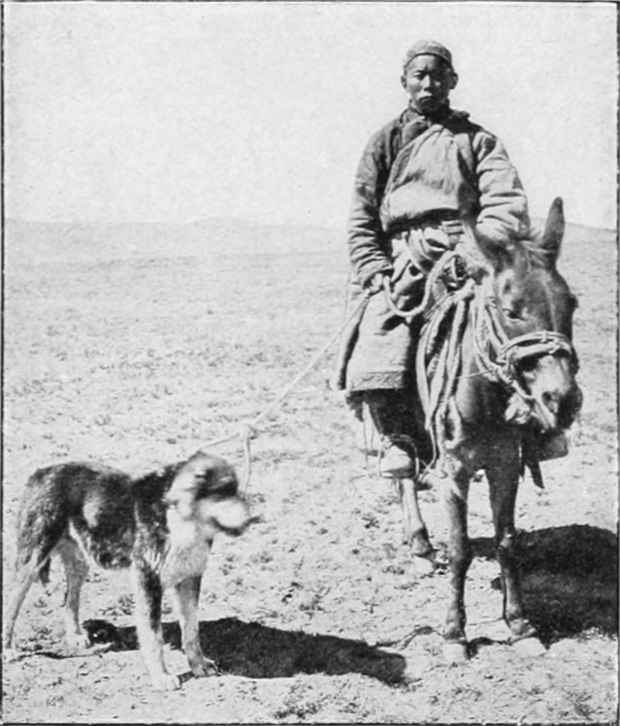

In diesem Lager, Nr. 18 (4733 Meter), wurde ein bedeutendes Kontingent unserer Gesellschaft entlassen. Die noch lebenden Esel waren in so jämmerlicher Verfassung, daß es barbarisch gewesen wäre, sie mit über den Arka-tag zu nehmen. Dowlet Karawan-baschi erhielt daher die Erlaubnis, zu retten, was sich noch retten ließe, und mit seinen fünf Eseltreibern wieder nach Norden zu ziehen. Im besten Falle wird eine geringe Zahl der Esel die Heimreise überlebt haben, aber der Alte hatte auch einige Pferde, die noch in gutem Zustande waren. Die Skelette und die Felle des Hirsches und des Bären wurden eingepackt, und Dowlet erhielt den Auftrag, sie mitzunehmen und nach Kaschgar zu schicken, wo ich sie ein Jahr[S. 129] später unversehrt vorfand. Ein gutes Geschäft machte er bei seinem Eseltransporte nicht, aber die Miete für die einzelnen Esel war so reichlich bemessen, daß er wenigstens den Wert der Tiere wiederbekam. Desgleichen wurden drei von unseren in Tscharchlik angestellten Dienern, Nias, Kader und Kurban, verabschiedet. Umkehren wollte keiner, aber da wir drei Männer gut entbehren konnten, wurden diejenigen ausgesucht, die sich bisher als die am wenigsten tüchtigen erwiesen hatten.
So dezimiert, setzten wir am 21. Juni die Reise nach Südsüdwesten fort, immer höher werdenden Regionen entgegen, auf vortrefflichem, langsam aufsteigendem Terrain von ungefähr der richtigen Härte und mit spärlichem Graswuchs. Wenn ich von Gras rede, darf sich der Leser keinen übertriebenen Hoffnungen für die Tiere hingeben. Die Gegend ist für gewöhnlich absolut steril, und wenn man gelegentlich kleine Flecke mit strohgelben, harten, scharfen, wenige Zentimeter hohen Halmen findet, nennt man dies Gras. Man tut gut, sich nicht allzuleicht bekleidet auf einem Hügel, wo solches „Gras“ wächst, auszuruhen, denn es ist hart wie Knochen und sticht wie scharfe Nadeln sogar durch ziemlich dicke Stoffe. So ist es mit der einzigen Nahrung bestellt, die sich unseren Tieren in diesem unwirtlichen Lande darbietet!
Der Zug schreitet ein ziemlich großes, breites Flußtal hinauf, das von den Schneebergen des Arka-tag, die sich uns als hindernde Mauer in den Weg stellen, herabführt. Wieder galt es, diese mörderischen Verschanzungen zu erstürmen; der Sturm gelingt, aber nicht ohne Verluste.
Zwei Antilopen fielen unter Schagdurs und Sirkins Kugeln. Als letzterer in vollem Galopp zu seiner Beute ritt, stürzte sein Pferd und überschlug sich; der Reiter wurde über den Kopf weggeschleudert und rollte auf dem Boden, das Pferd aber blieb tot liegen, sei es, daß es das Genick gebrochen hatte oder daß es vom Schlage gerührt worden war. Sirkin kam zu Fuß nach und besorgte sich bald ein neues, obwohl schlechteres Pferd; das tote, ein sehr schönes, kräftiges Tier, war sein besonderer Liebling gewesen.
Das Kamel, das die Paßerkletterungen verabscheute, kam auch heute nicht mit. Turdu Bai blieb bei ihm, traf aber abends allein im Lager ein. Am Morgen gingen ein paar Männer zu dem Kamele zurück, mit dem Auftrag, es totzustechen, wenn es ihnen nicht folgen wolle. Erst jenseits des Arka-tag erfuhr ich, daß sie es nicht hatten übers Herz bringen können, das Tier zu töten; es sei ganz gesund gewesen und werde sich sicher in der Spur der Karawane in seine Heimat zurückzufinden wissen. Nur zum Hinaufziehen nach noch viel höher gelegenen Gegenden habe es sich durchaus nicht bewegen lassen wollen!
[S. 130]
Mein altes Reitkamel, Tschong Artan, wurde im Lager Nr. 19 von einem sonderbaren Übel ergriffen. Seine Hinterbeine waren wie gelähmt, und es konnte nur gehen, wenn ihm zwei Männer je eines der Beine aufhoben. Es tat mir stets weh, die Veteranen, die mich von Anfang an begleitet hatten, verlieren zu müssen, und sie wurden daher ganz besonders sorgfältig gepflegt. Schon jetzt hatten wir neun Kamele, die deutliche Anzeichen von Erschöpfung zeigten. Jedes von ihnen erhielt allabendlich ein großes rundes Weizenbrot. Mit diesem wichtigen Proviantartikel gingen wir eine Zeitlang sehr wenig haushälterisch um, und der auf neun Monate berechnete Vorrat reichte kaum für sechs aus. Aber die Last war für die jetzt schon zusammengeschrumpfte Karawane viel zu schwer und mußte um jeden Preis erleichtert werden. Lieber fütterten wir die Kamele tüchtig, als daß wir etwas unterwegs im Stiche gelassen hätten.
Der neue Patient wurde massiert und auf dem Marsche über den Arka-tag von seiner Last befreit. Das Tier erholte sich erstaunlich gut und war, wie ich schon erwähnt habe, eines der neun überlebenden Kamele, die Ladak erreichten. Es ging stets an der Spitze der Karawane und trug eine große Glocke.
Auf dem Tagemarsche nach dem neunzehnten Lagerplatze — von Tscharchlik gerechnet — hatten wir 32,3 Kilometer zurückgelegt. Es sollte lange dauern, ehe wir wieder imstande waren, einen so langen Weg ohne Unterbrechung zu machen.
[S. 131]
Am 22. Juni wurde ich in aller Frühe geweckt. Obwohl der Morgen kalt und unfreundlich und die Jurte nur schwach erwärmt war, ging es mit dem Ankleiden gut, und es dauerte nicht länger als gewöhnlich, bis die Karawane marschfertig war. Heute, da das Erstürmen der Höhen des Arka-tag versucht werden mußte, sollte die ganze Karawane beisammenbleiben. Der Himmel sah nicht sehr verheißungsvoll aus, als der lange Zug sich langsam nach dem Passe hinauf zu bewegen begann.
Kaum einen Steinwurf vom Lager entfernt, legte sich eines der schwachen Kamele nieder. Die Last wurde ihm abgenommen, es stand auf und ging noch eine Strecke weit, sank dann aber kraftlos an einem Abhange nieder und war offenbar verloren. Mit einem Schnitte öffnete das Messer den Abfluß für einen schwarzen dicken Blutstrahl, der allmählich ein höchst eigentümliches Aussehen annahm. Stoßweise kam aus der Wunde weißer, Schlagsahne gleichender Schaum, unter diesem aber bildete das Blut ein Bächlein. Das Kamel lag ganz still und schien sich über die Erlösung zu freuen. —
Weiter ging es, das ziemlich wasserreiche Tal hinauf. Jetzt brach eines der fürchterlichsten Unwetter los, das ich je in Tibet erlebt habe. Es kam mit nordwestlichem Winde heran und schüttete Massen von Schnee und Hagel über uns aus. Der Schnee taute auf den Kleidern auf, und man wurde durch und durch naß; man wurde steif vor Kälte und suchte sich vergebens gegen den schneidenden Wind zu schützen. Die Steigung war unbedeutend, aber auf dieser Höhe und bei diesem Wetter dennoch vernichtend. Ein Kamel nach dem anderen blieb erschöpft stehen und wollte keinen Schritt weiter; sie wurden abgekoppelt und mit einem Wächter zurückgelassen. Zwei ließen wir mit ihren Lasten liegen, um sie später zu holen, den anderen mußten die Pferde tragen helfen.
Bei dem undurchdringlichen Schneegestöber sieht man von der Gegend keine Spur. Als die Sonne auf ihrer Mittagshöhe stand, herrschte Halbdunkel,[S. 132] und es schneite ununterbrochen. Der Schnee deckt alles zu, nur der Fluß bildet ein dunkles, gewundenes Band, und sein Rauschen klingt metallisch in der verdünnten Luft. Ich beuge mich vornüber im Sattel, um mein Kartenblatt, das schon durchnäßt ist, zu retten. Wohin es geht und wie es geht, weiß ich nicht; ich folge nur der nächsten Karawanenglocke. Langsam wie Schnecken kriechen wir nach diesem unheimlichen Passe hinauf, während der Weg allmählich immer steiler wird. Von Zeit zu Zeit durchschneidet ein Brüllen die Luft, und es erschallt der Ruf: „Tuga kalldi“ (ein Kamel ist stehengeblieben). Ein Mann erbarmt sich des müden Tiers und führt es langsam den anderen nach; bald ist er uns aus den Augen entschwunden.
Die Schneedecke wurde immer höher. Ich ritt mit dem Lama voran, um zu sehen, ob der Paß überhaupt den Übergang gestattete. An und für sich war er nicht schwer zu überschreiten; aber die große absolute Höhe und der Schnee! In unsere Mäntel gehüllt, saßen wir, auf die anderen wartend, auf dem Passe und suchten den Schutz, den uns die Pferde gewähren konnten. Der Sturm schlägt uns mit seinen feinen, scharfen Schneenadeln ins Gesicht; man zittert vor Kälte und ringt nach Luft auf dieser Höhe von 5189 Meter! Wir hörten das schwermütige Läuten der Glocken und das Rufen der Leute durch das hier oben mit verdoppelter Kraft rasende Unwetter, aber es dauerte lange, bis die ersten Ankommenden, Gespenstern gleich, zwischen wahren Wolkensäulen von wirbelndem Schnee erschienen.
Gott sei Dank, dachte ich, als ich wenigstens 30 von den 34 Kamelen, die es nach meiner Rechnung sein mußten, gezählt hatte. Zwei waren nicht mehr bis an den letzten Paßabhang gekommen, zwei waren dicht vor dem Passe zusammengebrochen. Unter den fehlenden waren auch das älteste Junge und seine Mutter; immerhin war es noch ein Glück, daß sie miteinander in den Tod gingen. Die Pferde bestanden die Probe ohne Schwierigkeit, und den Mauleseln machte es gar nichts aus. Sogar die Schafe fanden sich gut damit ab.
Die Südseite des Arka-tag dachte sich sehr allmählich ab, und wir durchschritten hier einen großen, offenen Kessel, der auf allen Seiten von verhältnismäßig niedrigen Bergen umgeben war. Das Erdreich aber war abscheulich. Der frischgefallene Schnee hatte sich in Schneeschlamm verwandelt, der bei jedem Schritt klatschte und den Fuß förmlich festsog. Große Umwege wurden gemacht, um die tückischsten Stellen zu umgehen. Es ist gar nicht daran zu denken, in solch einer Suppe zu lagern; Kamele und Kisten würden einsinken und so fest im Schlamme stecken, daß man sie überhaupt nicht wieder herausbekäme.
Noch als die Dämmerung schon einbrach, waren diese unheimlichen[S. 133] weißgekleideten Bergrücken Zeugen unseres mühevollen Zuges. Wir suchten jetzt nur nach einem trockenen Flecke, auf dem unser Lager Platz finden konnte; an Weide und Brennholz dachte keiner, das wäre zuviel verlangt gewesen. Endlich erreichten wir einen Kiesabhang, der die Nässe einsickern ließ; hier wurde gelagert.
Turdu Bai und mehrere der Leute fehlten noch und kamen erst gegen 10 Uhr an, nachdem sie die vier Kamele im Stiche gelassen hatten. Doch am 23. Juni kehrten sie bei Tagesanbruch mit einigen Pferden wieder zu ihnen zurück, um zu versuchen, ob sie sich nicht retten ließen, oder um wenigstens ihre Lasten und das Stroh der Packsättel zu bergen. Leider war es mit dieser Hoffnung nichts; die Tiere waren nicht mehr zu retten und mußten getötet werden. Wir verlassen sie nie, bevor es ganz feststeht, daß es mit ihnen zu Ende geht, und dann befreit sie das Messer von ihren Leiden. Ein warmer Blutstrahl schmilzt den Schnee zwischen den Steinen, auf denen ihr Gebein bleichen wird. Eines der Kamele war schon verendet und lag kalt und steif im Tale.
An diesem einen Tage hatten wir also fünf Kamele verloren, der größte Verlust an Tieren, den ich je erlitten habe, nicht einmal die Wüste Takla-makan ausgenommen! Die Kerntruppe der Karawane hatte sich um ein Siebentel verkleinert, und die Lasten werden jetzt den überlebenden Tieren zu schwer werden. Ich ließ diese Mehl und Mais fressen, soviel sie nur konnten, und auch die Pferde durften nach Herzenslust fressen. Wir legten nur noch 11 Kilometer zurück. Die Hauptsache war jetzt, einen leidlichen Lagerplatz zu finden, wo wir die Tiere nach ihren Strapazen aufatmen lassen konnten. Als wir daher über eine kleine Wasserscheide mit zwei zugefrorenen kleinen Seen gegangen waren und südlich davon am Ufer eines Baches einige kümmerliche Grasbüschel fanden, machten wir Halt. Einer von den übrigen Todeskandidaten unter unseren Kamelen kam nur noch mit Mühe bis an diesen Platz. Eins der Pferde, das fett und gesund aussah, starb ganz plötzlich im Lager. Jetzt begann der Abschnitt der Reise, währenddessen kaum ein Tag verging, ohne daß wir ein Grab hinter uns zurückließen. Von den Skeletten geführt, könnte man dem Wege der Karawane folgen; ein trauriger Weg, dessen Meilensteine Gerippe sind! Die Kamele pflegen, wie ich oft gesehen habe, zu weinen, wenn sie den Tod herannahen fühlen und das Blut in ihren Adern zu erstarren beginnt.
Jetzt durften wir uns endlich guten Wetters erfreuen. Die Sonne schien ordentlich warm, und alles trocknete von der Nässe auf dem Arka-tag. Hierdurch verringert sich das Gewicht der Lasten nicht wenig. Der Morgen des Johannistages war klar, aber vollständig winterlich. Sobald ich mein Frühstück und meinen heißen Tee erhalten hatte, inspizierte ich die[S. 134] Karawane. Heute wurde gemeldet, daß Hamra Kul, der Pferdeaufseher, ernstlich erkrankt sei. Er saß in seinem Zelte, sah elend aus und hatte überall Schmerzen; er erhielt Chinin und ein Reitpferd. Den Tag vorher hatten nämlich alle Muselmänner zu Fuß gehen müssen, weil die Pferde für die Lasten der gefallenen Kamele gebraucht wurden.
Dann ging es zu meinem prächtigen Reitpferd, das kaum auf seinen zitternden Beinen stehen konnte. Der Lama, der neben seiner Priesterwürde auch Arzt von Beruf war und eine ganze Kiste mehr oder weniger wirksamer Drogen aus Lhasa bei sich hatte, nahm sich seiner an und wollte dafür einstehen, daß er wieder Leben in das Tier bringen würde. Er öffnete ihm an beiden Vorderfüßen die Adern, so daß das dunkle Blut herausströmte. Dann verband er die Wunden, und das Pferd folgte uns mit stolpernden Schritten und erreichte abends das Lager. Mehrere Kamele waren elend, alle waren erschöpft, und einige gingen ohne Lasten. Man fühlt, daß der Tod die Karawane begleitet, sich seine Opfer auswählt und sie niederstreckt, und man fragt sich nur, an wen das nächste Mal die Reihe kommen wird. Die Hoffnung, in einigen Wochen wieder in günstigere, wärmere, grasreichere Gegenden zu gelangen, hielt uns jedoch aufrecht.
Der Johannistag verlief übrigens noch glücklich genug. Das Terrain legte uns keine Hindernisse in den Weg, und wir marschierten südwärts in einer Zickzacklinie, um die zahllosen kleinen Süßwasserseen und Tümpel, die das Hügelland kennzeichnen, zu umgehen. Die Seen sind gewöhnlich zugefroren. Dann aber erhob sich vor uns wieder eine nicht unbedeutende Kette, die bisher von den Hügeln verdeckt worden war. Turdu Bai, der stets an der Spitze ritt, wollte sie auf dem ersten besten Passe überschreiten, ich zog es aber vor, nach Westnordwesten in ein mächtiges Tal hineinzugehen, das sich in dieser Richtung hinzog. Beim ersten Weideplatz schlugen wir unser Quartier für die Nacht auf und wurden dabei mit einem schmetternden Hagelschauer traktiert.
Die erste Sorge im Lager ist das Untersuchen und Gruppieren der Tiere. Die gesunden dürfen frei umherlaufen, die schwachen müssen bei den Zelten bleiben. Der Lama ließ meinem Reitpferd noch einmal zur Ader und gab ihm darauf ein langdauerndes, eiskaltes Fußbad im nächsten Bache. Diese „Pferdekur“ muß doch heilsam gewesen sein, denn das Tier wurde sichtlich besser, graste eine Weile mit gutem Appetit und knabberte dann seine Maiskörner, wobei ihm die Augen vor Freude und Wohlbehagen leuchteten. Da wir sechs ganze Kamellasten Reis hatten, wurde beschlossen, unter den Mais für die Tiere künftig auch Reis zu mengen, um ihre Kräfte dadurch zu stärken und aufrechtzuerhalten, bis wir Gegenden mit frischem grünem Grase erreichten, und auch um die Lasten zu erleichtern.[S. 135] So verging dieser Johannistag glücklich und gut und ohne Verlust eines einzigen Lebens.
Ich war jetzt gerade zwei Jahre unterwegs und konnte dankbar und befriedigt auf die ausgeführte Arbeit zurückblicken.
25. Juni. Jetzt haben wir lange kein Brennmaterial gefunden, und die Saumleitern sind in demselben Verhältnis draufgegangen wie die Kamele. Ohne ein kleines Kohlenbecken in meinem Zelte kann ich nicht arbeiten. Die Morgen sind recht kalt, und die Nachttemperatur sinkt gewöhnlich unter Null herab, so daß die Erde ein paar Stunden gefroren bleibt, dann taut sie wieder auf.
Unsere Richtung führt jetzt fast ganz nach Westen, denn wir folgen noch immer dem Längentale, das mit dem Südfuße des Arka-tag parallel läuft. Wir legten nur 19,1 Kilometer zurück. Mein erstes Ziel ist der See, an dem wir am 28. und 29. September 1900 gelagert und bei dem ich damals eine astronomische Ortsbestimmung gemacht hatte, an die ich jetzt die neue Observationskette anknüpfen wollte.
Der Marsch war einförmig, wie er es in diesen breiten, leblosen, sterilen Haupttälern zu sein pflegt, wo eine Tierfährte eine außerordentliche Seltenheit ist. Es erweckte förmliches Aufsehen, als wir einmal entdeckten, daß eine Orongoantilope quer durch das Tal gelaufen war. Das Terrain ist stark wellenförmig, und die Aussicht nach vornhin erstreckt sich nicht sehr weit. Man geht einem die Aussicht versperrenden Landrücken entgegen, auf welchem der Führer und sein Pferd sich wie ein scharfer Schattenriß vom Himmel abheben, und man glaubt und hofft, daß der Mann dort ein endloses Panorama überblicken könne; doch man irrt sich, denn von dem Hügel sieht man nur ganz in der Nähe wieder einen solchen Landrücken. So geht es den ganzen Tag, bis wir endlich an einem ganz kleinen See rasten. Seine Fläche ist mit Eis bedeckt, an den Ufern aber ist offenes Wasser.
In der Dämmerung inspiziere ich wieder das Lager. Jetzt kommt es nie mehr vor, daß sich alle wohl fühlen. Hamra Kul ist wieder gesund, dafür aber hat jetzt Rosi Mollah, der Priester, Rachenkatarrh, und der alte Kameltreiber Muhammed Turdu klagt über Brustschmerzen. Beide bekommen Medizin, die dank ihrer eigenen Einbildungskraft auch hilft, und sind von allen Arbeiten befreit, bis sie wieder gesund sind. Mehrere von den anderen klagen über Kopfweh, weshalb sie je ein Antipyrinpulver nehmen müssen und damit getröstet werden, daß in diesen höheren Regionen niemand einem Anfalle von Bergkrankheit (Tutek) entgehen könne; ich selbst fühle jedoch keine Spur davon.
Mein Pferd ist entschieden außer jeder Gefahr, wird aber bis auf[S. 136] weiteres noch nicht zur Arbeit benutzt. Mehrere Kamele sind jämmerlich mager. Die zwei kleinen Füllen saugen und zerren an den Eutern ihrer Mütter, werden aber bei weitem nicht satt. Darum haben sie Weizensemmel fressen lernen müssen, die sie delikat finden und hinunterschlucken, aber man muß sie ihnen auch ins Maul stecken!
26. Juni. Heute herrschte ein höchst eigentümliches Wetter. Der Morgen war strahlend schön und die Luft sommerlich warm, aber schon früh erhob sich ein so außerordentlich heftiger Westwind, daß wir, die wir ihm gerade entgegenritten, nach Atem rangen und uns möglichst hinter denjenigen Kamelen hielten, die die höchsten Lasten trugen. Sich durch einen solchen Sturm durchzuarbeiten, strengt die Tiere, die es in der verdünnten Luft schon ohnehin schwer genug haben, noch mehr an. Man kann hier von einem Westpassate reden, so beständig scheint die Windrichtung zu sein. Als wir endlich unser Lager Nr. 61 vom vorigen Herbste erreichten, herrschte dort derselbe heftige Wind wie damals; Sand und Staub wirbelten in der Luft, und Zelte und Jurten drohten, zerfetzt und von den unglaublich gewaltsamen Windstößen fortgeweht zu werden.
Das heutige Lager, Nr. 24, fällt mit Nr. 61 vom vorigen Jahre zusammen, und ich gewann einen unschätzbaren Kontrollpunkt für die Karte. Von unserem früheren Besuche zeugten nur noch von den Feuern übriggebliebene Kohlen- und Aschespuren. Wir lagerten auf derselben Stelle am linken Ufer des kleinen Baches.
Der größere Teil des Sees war noch mit einer porösen Eisschicht bedeckt. Erst Mitte Juli wird der See wieder offen sein, aber nur, um Anfang November von neuem zuzufrieren. Die Eisverhältnisse sind natürlich bei den verschiedenen Seen sehr verschieden und richten sich nach dem Salzgehalt, der Größe und der mehr oder weniger geschützten Lage der Seen. Die kleinen Süßwassertümpel in der Nähe des Arka-tag sind den größten Teil des Jahres über zugefroren.
Heute herrschte jedoch Sommerwetter, und um 1 Uhr stieg die Temperatur trotz des heftigen Windes beinahe auf +20°. Es war ein warmer Luftstrom, ein richtiger Föhn, der über diese kalten, hohen Regionen hinfuhr; ein Sommerwind über einen zugefrorenen See.
Während des Rasttages, den wir hier verlebten, hatte ich glücklicherweise Gelegenheit, eine Ortsbestimmung zu machen. Sirkin und Turdu Bai rekognoszierten das Land nach Westen hin und fanden dort keine Hindernisse auf unserem Wege. Um diesen wichtigen Knotenpunkt zu fixieren und deutlich zu bezeichnen, errichteten die Kosaken einen doppelten Steinhaufen von Schieferplatten, in welche Sirkin und Schagdur ihren Namen einmeißelten, während der Lama sein ewiges „Om mani padme hum“ in[S. 137] eine große Scheibe einritzte (Abb. 235). Dieser Obo steht auf einem Hügel am rechten Ufer und ist leicht zu finden, wenn später einmal ein Reisender seine Schritte nach dieser Gegend lenken sollte. Meine Karte ist überdies so detailliert, daß man mit ihrer Hilfe auf unseren Lagerplatz direkt wird zugehen können. Die Muselmänner wollten auch nicht zurückstehen und errichteten ihre eigene Steinpyramide; ein gewisser Ehrgeiz trieb sie an, diese höher aufzutürmen, als der „heidnische“ Obo war.
Am 28. Juni zogen wir längs des Ufers weiter. Es war wirklich herzerquickend, daß man heute nicht nötig hatte, die Kamele steile Abhänge hinaufkeuchen zu sehen; sie gingen ruhig auf dem festen ebenen Kiesufer. Im Südwesten kamen wir an noch einen See, dessen Ostufer uns zwang, nach Südosten abzubiegen. Meine Absicht war jetzt, noch eine Zeitlang möglichst nach Südwesten zu ziehen, um die schwer passierbaren Berggegenden, die wir von der vorjährigen Reise her kannten, zu vermeiden.
Der neue See, an dessen Ufer das Lager Nr. 25 aufgeschlagen wurde, war ebenfalls mit ziemlich dickem Eise bedeckt.
Am 29. Juni marschierten wir ganze 27 Kilometer. Anfangs ging es nach einem niedrigen Passe hinauf, der, wie die ganze Gegend, schneefrei war. Von hier hatten wir nach Süden hin die herrlichste Aussicht über ein neues, breites und flaches Längental, das sich in ostwestlicher Richtung hinzog und reich an Seen war. Der größte von diesen lag im Südwesten; daß er salzig war, konnten wir daraus schließen, daß er völlig eisfrei war. Auf seinem Südufer erhoben sich feuerrote, weich abgerundete Hügel, deren grelle Farbe sich ebenso scharf von der sonst einförmig grauen Landschaft abhob wie der herrliche, rein marineblaue Wasserspiegel des Sees. Im Südosten und Süden zeigten sich drei dominierende Schneegipfel.
Jetzt handelte es sich nur darum, Wasser zu finden. In dem nach dem See hinunterführenden Tale floß ein Bach, der aber salzig war, und auf dem Westufer des Sees gab es keine Quellen. Eine Strecke weiter entdeckte Schagdur, der vorausritt, einen Fluß, an dem wir inmitten kärglicher Weide rasteten. Wie meistens in den offenen Tälern machte sich der Westpassat mit aller Kraft geltend. Ein Blatt aus meinem Notizbuche löste sich und flatterte im Winde dem nahegelegenen See zu, aber der Lama setzte sein Pferd in scharfen Trab und fing das Blatt im letzten Augenblicke noch glücklich auf. Bei Sonnenuntergang herrschte vollkommene Windstille; aber um 8 Uhr tobte ein Nordsturm von 17 Meter Geschwindigkeit in der Sekunde! Sein klagendes Geheul übertönte alle anderen Laute und wurde nur gelegentlich von dem Geschrei der Männer durchdrungen, wenn sich etwas gelöst hatte und fortfliegen wollte.
[S. 138]
Erst gegen Morgen legte sich der Sturm, und der neue Tag brach klar und schön an, obwohl der Passat noch ununterbrochen aus Südwest wehte. Ohne allzu große Anstrengungen überwanden wir die Höhen, die sich auf der Südseite des Sees hinziehen, und ich brauchte kein schwarzes Kreuz in den Kalender zu zeichnen. Der Marsch war freilich recht beschwerlich, denn wir mußten über drei Pässe, ehe wir wieder an fließendes Wasser gelangten, in dem wir rasch den Oberlauf desselben Flusses, an welchem wir zuletzt gerastet hatten, erkannten. Hätten wir hiervon eine Ahnung gehabt, so hätten wir uns natürlich die Pässe geschenkt und wären in dem harten Bette, in dem es sich vorzüglich marschierte, weitergezogen. Doch es sind ja unbekannte Teile der Erdrinde, die wir durchziehen, und dies ist gerade das Einzigschöne an der ganzen Reise.
Am 1. Juli gingen wir 27½ Kilometer nach Süden. Ich hatte allen Grund zu vermuten, daß, wie unser Schicksal sich auch gestalten würde, mit diesem Tage ein ereignisreiches Halbjahr beginnen werde. Auf unserem Wege erhob sich eine gewaltige Bergkette, deren höchste Partie, die mit einer ewigen, eisartig glänzenden Schneehaube bedeckt war, auf einer von beiden Seiten umgangen werden mußte. Tschernoff, der die westliche untersucht hatte, kam uns auf halbem Wege mit der Nachricht entgegen, daß dieser Weg für die Kamele unmöglich sei. Tscherdon und der Lama hatten auf der Ostseite mehr Glück gehabt, bereiteten uns aber auf einen schweren Übergang vor.
In langsamem Tempo schritt die Karawane nach der schwindelnden Höhe hinauf. Die Steigung nimmt zu, der Fluß wird immer wasserreicher, je mehr wir uns dem ewigen Schnee nähern, von dessen schmelzenden Zungen in den Klüften eine ganze Reihe kleiner Bäche in Schuttbetten herunterrieseln. Im Hauptbett ist das Wasser ganz rot und dick und wälzt sich dumpf und schwer talabwärts. Jegliche Vegetation hat aufgehört, nicht einmal ein Moosfleckchen kann in dem Schutte wurzeln und gedeihen. Endlich haben wir den letzten steilen Abhang besiegt. Die Kamele atmen laut und schwer, die Leute, von denen viele haben zu Fuß gehen müssen, um die Lasten zu überwachen, sinken kraftlos zu Boden, da es ihnen schwarz vor den Augen wird. Ganz oben auf dem Passe erwartet uns der Lama; sein rotes Gewand macht sich weniger als gewöhnlich geltend, denn die Gesteinart ist rotes Konglomerat, und die ganze Landschaft schillert in roten Schattierungen.
Obwohl fünf Kamele schwach waren und drei ohne Last gingen, erreichten sie alle diesen 5337 Meter hohen Paß, der also bedeutend höher als der Arka-tag, aber schneefrei ist. Ein Glück war, daß wir diesmal von einem Schneesturm verschont blieben. Der Südabhang dieses dominierenden[S. 139] Gebirgsstockes war dagegen fast ganz schneefrei. Doch sammelte sich auch hier ein ziemlich bedeutender Fluß, der nach Südosten abbog und zwischen einem Gewirr von Bergen verschwand. Wie schon so oft, konnten wir nicht feststellen, wo er blieb. Wahrscheinlich ergießt er sich in irgendeinen versteckt liegenden See. An seinem rechten Ufer wurde das Lager Nr. 28 aufgeschlagen. Von Weide und Brennmaterial konnte an diesem wüsten Orte nicht die Rede sein.
Es ist jetzt eine ausgemachte Sache, daß die Medizinkiste in jedem Lager herhalten muß. Tschernoff hatte wütende Kopfschmerzen, Turdu Bai klagte über Stechen in dem einen Auge und wurde mit Kokain behandelt, dessen Wirkung ihm ungeheuer imponierte. Hamra Kul ging es am Tage vorher ebenso, als ich ihm sein Zahnweh mit Zahntropfen stillte. Es war wohl mehr der Neugierde zuzuschreiben, daß heute wieder drei Patienten, besonders Islam Ahun aus Tscharchlik, über Zahnschmerzen klagten. Sie wollten wahrscheinlich ausprobieren, ob Hamra Kuls lebhafte Beschreibung von der Kraft des Heilmittels mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Am schlimmsten steht es mit Muhammed Tokta, der über sein Herz klagt und an Schlaflosigkeit leidet. Er ist schon lange von aller Arbeit entbunden und sollte sie nie wieder aufnehmen können. Von Zeit zu Zeit gab ich ihm Morphium zum Schlafen.
Die Medizinkiste wurde als ein wundertuender Talisman betrachtet. Sobald sie hervorgeholt wurde, versammelten sich alle, die gerade nichts zu tun hatten, vor meinem Zelte. Viele bittende Blicke wurden während der monatelangen Reise auf den Blechdeckel der Kiste gerichtet. Ich selbst war so glücklich, von ihrem Inhalt nie Gebrauch machen zu müssen.
Auch am 2. Juli wurde ein schöner Marsch von 26½ Kilometer gemacht, der uns durch eine Landschaft aus rotem Sandstein führte. Von dem schlechten Grase wenig gesättigt, müssen die Kamele täglich ihre schwere Lasten geduldig weiter über die Berge schleppen. Das Schlimmste ist, daß sie selbst leichter werden und von ihrem eigenen Fette zehren, das nicht ersetzt werden kann, weil sie keine genügende Nahrung erhalten. Von dem Mais sind jetzt nur noch drei große Säcke übrig. Werden wir Gegenden mit besserer Weide erreichen, ehe es zu spät ist?
Eine recht ansehnliche Bergkette zwingt uns, nach Südwesten zu gehen. Mehrere Tümpel und kleine Seen glitzern im Sonnenschein. Hier wanderte eine nichts Böses ahnende Orongohindin mit ihrem wenige Tage alten Jungen, das von Jolldasch gejagt, eingeholt und sofort totgebissen wurde. Ich bat Schagdur, die Mutter zu verfolgen, um ihrem Gram ein Ende zu machen, aber sie entkam, und ich habe es nicht verhindern können, daß sie noch lange voller Kummer ihr Kind suchen wird.
[S. 140]
Endlich finden wir ein nach Süden hinabführendes Flußtal. Nach und nach wurde es weniger bequem, als wir gehofft hatten, denn es drängte sich zu einem scheußlichen gewundenen Korridor zusammen, und der Boden desselben war mit Sandsteinplatten bedeckt, an denen die Kamele sich die Füße verletzten. Wir verlassen daher das Tal und ziehen über einen niedrigen, hügeligen Paß, auf dem Sirkin eine viel zu wenig scheue Antilope erlegte. Jolldasch stürmte blindlings auf das verwundete Tier los, wurde aber sehr kleinlaut, als sich ihm zwei spitze Hörner entgegenstreckten. Fleisch hatten wir stets in genügender Menge. Den Hunden ging es von der ganzen Gesellschaft am besten. Auch wenn die Jagd schlecht gewesen wäre, hätten sie doch an dem Fleische der gefallenen Karawanentiere übergenug gehabt. Jagd durfte nie als Sport betrieben werden, sondern nur wenn wir Fleisch brauchten. Wir mußten auch an die Munition denken. Augenblicklich hatte noch jeder Kosak 142 Patronen, welcher Vorrat allerdings völlig ausreichend war, wenn vernünftig damit umgegangen wurde; aber man konnte nicht wissen, was die Zukunft in ihrem Schoße barg, und daher mußten wir damit sparsam sein.
Von einer letzten, schwachen Schwelle erblickten wir wieder einen kleinen See. Sein südliches Ufer glänzte grün, und nach einer Weile befanden wir uns auf Gras, das freilich außerordentlich dünn und niedrig stand, aber doch besser war als seit langer Zeit, denn es war von diesem Sommer und weich. Kulanmist zur Feuerung war gesammelt worden, es blieb nur noch das Wasser zu versuchen. Tschernoff fand es schlecht, Tscherdon meinte, es sei ganz süß; Schagdur wollte es auch probieren und fand es mäßig. Es half schließlich nichts, ich mußte selbst absteigen, um zu kosten, und ich war der Ansicht, daß wir damit zufrieden sein könnten.
Ein charakteristischer Zug der Windverhältnisse dieser Gegenden, den ich seit mehreren Tagen beobachtet hatte, war folgender. Der Passatwind endet mit Sonnenuntergang; in der Dämmerung ist es so windstill, daß ich bei freibrennendem Licht und offener Tür Mittag esse. Gleich nach 8 Uhr erhebt sich ein nördlicher Sturm und bringt das Lager in Aufregung Alle müssen sich beeilen, ihre Zeltleinen straffzuspannen, die Zelte zu verankern und alle zufällig noch draußen umherliegenden Sachen in Sicherheit zu bringen. Die Funken stieben so dicht wie Kometenschweife um die Feuer, und es heißt aufpassen, daß sich auf der Seite, nach der der Wind weht, nichts Entzündbares befindet. Der Sturm hält wenigstens so lange an, als ich wach bin, d. h. bis Mitternacht, doch wenn ich morgens geweckt werde, also kurz vor 7 Uhr, ist die Atmosphäre wieder im Gleichgewicht. Hier gibt es also zwei herrschende Winde, einen westlichen und einen nördlichen, einen bei Tage und einen nachts wehenden.
[S. 141]
Vor dem Sturme gewährten unser Lager und seine Umgebungen an diesem Abend einen wirklich idyllischen Anblick, wenn man sich eines solchen Ausdruckes zur Bezeichnung einer tibetischen Landschaft bedienen darf. Die Sonne war untergegangen, aber im Westen sah man noch ihren Purpurschein. Im Osten stieg am dunkelblauen Horizont blaßgelb und kalt der Vollmond auf, dessen Licht durch einen dünnen leichten Abendnebel noch mehr gedämpft wurde.
Die auf den Hügeln zerstreuten Tiere weiden gierig (Abb. 236). Die Todeskandidaten unter den Kamelen liegen dicht aneinandergedrängt unter ihren weißen Filzmänteln neben Turdu Bais Zelt. Auch die beiden Jungen und ihre Mutter werden mit besonderer Sorgfalt gepflegt und bringen die ganze Nacht in liegender Stellung zu. Die kleinen Tiere werden stets zwischen zwei große Kamele gelegt, von denen eines die Mutter ist. Alle anderen Tiere weiden draußen im Mondschein, von ihren Wächtern und den Hunden vor den Wölfen geschützt, von denen wir in den letzten Tagen in der Gegend mehrfach Spuren gesehen haben.
Wir rasteten hier noch einen Tag. Ein Pferd, das gestern zurückgelassen worden war, kam heute an. Die gewöhnlichen Windgesetze gelangten auch heute zur Geltung, obwohl der Nordsturm früher als sonst einsetzte. Nachdem er über die Erde hingefahren ist, sieht diese merkwürdig reingefegt aus.
Nach meiner Ortsbestimmung mußte dieses Längental dasselbe sein, in welchem wir im vorigen Herbst Aldat begraben hatten. 30 Kilometer weiter östlich würde ein Wanderer zu seinem Erstaunen das einsame, verlassene, mit einem flatternden Yakschwanze geschmückte Grab des Jägers finden.
Am 4. Juli ging es beinahe direkt nach Süden über schwach wellenförmiges Land mit dünnem Graswuchs, zahlreichen Salztümpeln und ziemlich vielem Wild, besonders Kulanen und Antilopen. Yakdung ist sehr häufig und obendrein alt und trocken, so daß wir genügend Brennmaterial einsammeln konnten. Auch der Boden ist im allgemeinen merkwürdig trocken, ganz anders als im vorigen Herbst, wo wir hier beinahe im Schlamm ertranken. Es ist jetzt aber auch lange her, seit Niederschläge gefallen sind. Jetzt wirbelt der Staub im Winde hinter der Karawane auf.
Vor uns erhebt sich drohend ein neuer Paß. In einem mit Schutt bedeckten, ziemlich stark ansteigenden Tale gehen wir langsam nach dem Kamme hinauf, dessen Höhe 5210 Meter beträgt. Ein unbeladenes Kamel kann nicht mitkommen und wird mit einem Wärter zurückgelassen. Droben auf der Höhe gibt es keine andere Vegetation als Yakmoos. Die Aussicht nach Süden ist umfangreich; wir sehen nach dieser Richtung hin wohl vier Tagereisen weit, und keine unüberwindlichen Hindernisse drohen uns. Anders[S. 142] sieht die Landschaft im Norden aus, woher wir gekommen sind, denn dort türmen sich eine Menge Ketten und Kämme über- und durcheinander, und der Horizont wird von der Kette mit dem unterhalb des ewigen Schnees liegenden Passe abgeschlossen.
Die Landschaft schillert in blassen Farbenschattierungen, in denen Rot in verschiedener Stärke vorherrscht. Nur schwache Anflüge von Gelb und Grün deuten die Weideplätze an, die wir eben verlassen haben. Das Land erinnert an ein Wüstenbild. Hier und dort glänzen Schneestreifen, und über dem Ganzen wölbt sich der türkisblaue Himmelsdom.
Der vom Passe hinabführende Abhang, auf dem die Gesetze der Schwere den Kamelen wieder zu Hilfe kommen, wird von uns als eine Erholung betrachtet. An dem ersten Punkte, wo es wieder Gras gab, schlugen wir unsere luftigen provisorischen Hütten auf (5054 Meter). In einem trockenen Bette wurde ein Brunnen gegraben, der bald gutes Wasser gab, und am folgenden Morgen wurde eine Quelle entdeckt, an welcher Sirkin und Tscherdon zwölf Rebhühner schossen. Zwei Yake mußten ins Gras beißen. Wir haben es freilich gut, aber die Kamele, die aufs Weiden angewiesen sind, sehen mager und elend aus. Die Pferde sind nicht viel besser daran. Eines muß in diesem Lager Nr. 30 geschlachtet und den anderen muß ein Ruhetag gegönnt werden.
An den Rasttagen sind Schagdur und der Lama mit der Herstellung meines Mongolengewandes beschäftigt. Mit dem Lama ist eine merkliche Veränderung vorgegangen; sein Mut ist gewachsen, und er sehnt sich nach Süden und nach Lhasa zurück. Der mongolische Unterricht geht ununterbrochen weiter, und der Lama zeichnet für mich Pläne der heiligen Stadt, ihrer Tempel und ihrer freien Plätze. Er sieht die ganze Reise jetzt in hellerem Lichte an als früher und pflegt seine Ansicht darüber in folgender, außergewöhnlich intelligenter Redensart auszudrücken: „Mo bollne ikke mo bollne gué, sän bollne ikke sän bollne“ („Geht es uns schlecht, so geht es uns nicht sehr schlecht, geht es aber gut, so geht es uns sehr gut“).
Jeden Abend Schlag 9 Uhr mache ich eine Visite in der großen Jurte, die von Schagdur, Sirkin und dem Lama bewohnt wird. Es gilt, das meteorologische Journal für den Tag zu kontrollieren und das Thermohypsometer abzulesen, was ich stets selbst tue. Dann bleibe ich bei ihnen sitzen und plaudere eine Weile mit ihnen über unsere Zukunftsaussichten, und Turdu Bai und Hamra Kul müssen mir über das Befinden der Tiere Bericht erstatten. Wenn ich es für nötig halte, instruiere ich dann auch den oder die Männer, welche am folgenden Morgen rekognoszieren sollen. Heute Abend wurde mir mitgeteilt, daß kaum noch ein Sack Mais übrig sei und wir, wie es uns auch ginge, den Tieren so viel Reis und Mehl[S. 143] wie nur irgend möglich abtreten müßten. Turdu Bai hielt es für durchaus notwendig, nach Gegenden mit Weide zu eilen und dort die Kamele sich mindestens einen Monat lang wieder kräftigen zu lassen. Ja, sie sollten sich nachher auch ausruhen, wenn ich nach Lhasa ritt.
Eine zweite wenig erfreuliche Nachricht war, daß noch alle vorhandenen Schafe im Laufe des Tages durchgebrannt seien. Die meisten Muselmänner waren schon auf der Suche. Erst in der Dämmerung hatte man die Tiere vermißt. Tschernoff hatte sich zu Pferd aufgemacht und einige Hunde mitgenommen. Ich fürchtete, daß es den Schafen am Ende ebenso gegangen sein würde, wie wir es im vorigen Jahre schon einmal erlebt hatten, und mir graute vor der Strafpredigt, auf die ich mich vorbereiten mußte. Tatsächlich war das Kommando über die Herde viel zu sehr dem Leithammel Wanka überlassen worden, der indessen dieses Amt mindestens ebenso gut ausgeübt hatte wie ein Muselmann. Müde kamen die Suchenden gegen 9 Uhr zurück und wollten noch eine Stunde warten, bis der Mond aufging und ihnen erlaubte, der Spur der Herde zu folgen. Erst um Mitternacht wurde es im Lager lebendig, denn da brachte die ganze Gesellschaft die unversehrten Schafe vollzählig wieder heim. Die Tiere waren ein Tal hinaufgegangen und hatten sich in ein tiefes Flußbett gelegt.
6. Juli. Die Marschgeschwindigkeit nimmt in demselben Maße ab, wie die Kräfte der Tiere sinken. Selten sind wir imstande, mehr als 20 Kilometer zurückzulegen. Ich ziehe es dann vor, auf meinem jetzt ganz wiederhergestellten Pferde mit dem Lama vorauszureiten, und, wenn wir die Karawane aus den Augen verloren haben, auf einem Passe zu rasten. Die Kamele waren heute schlaffer als gewöhnlich, und es dauerte daher lange, bis das Glockengeläute näherkam.
Still und feierlich wie ein Friedhof dehnt sich dieses öde Gebirgsland vor uns aus, in das bisher noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Auf allen Seiten umgibt uns die ursprünglichste und ganz unberührte Natur. Wir durchziehen sie seit Wochen und Monaten und sind stets die einzigen Menschen, die diesen Teil der Erde bevölkern.
Noch immer herrscht derselbe Parallelismus wie in den Gegenden, die wir im vorigen Jahre durchreisten; alle Ketten und Kämme und alle Längentäler haben eine westöstliche Richtung, und wenn man, wie wir, nach Süden zieht, muß man sie alle in der Quere überschreiten. Kaum eine Tagereise geht zu Ende, ohne daß wir einen Paß überschritten haben, und gewöhnlich haben wir mit dem Tagemarsch zugleich auch ein paar Pässe hinter uns.
Auch heute hatten wir einen recht fühlbaren Paß, der sich nicht umgehen ließ. Merkwürdigerweise ist jedoch anstehendes Gestein eigentlich eine[S. 144] Seltenheit. Sowohl diesen wie den folgenden Tag wanderten wir über ganz weichen Boden, wo man nur auf dem Grunde der Täler Schutt findet. Später wurde der Boden sandig und infolgedessen trocken und tragfähig; auch das Gras wurde ein bißchen besser, als es bisher gewesen war. Wir lagerten an einer kleinen Quellader. Ein paar Kamele waren zurückgelassen worden, wurden aber abends geholt. Eines von ihnen war mein alter Reisekamerad von 1896; er blickte mit seinen glänzenden, rabenschwarzen Augen auf dieses Land, das ihm bald das Leben kosten sollte, und ging auf zitternden Beinen, als Sirkin ihn vor den photographischen Apparat führte (Abb. 237). Ich wollte mir sein Bild zur Erinnerung an die Dienste, die er mir geleistet, aufheben. Daß er bald sterben würde, war klar. Noch hielt er sich jedoch tapfer und schien beschlossen zu haben, seine Gebeine nicht eher der Erde zu schenken, als bis er keinen Schritt mehr gehen konnte. Hocherhobenen Kopfes stand er mit dem Packsattel in seinem weißen Mantel da und ahnte vielleicht, daß er bald von uns scheiden würde. Er hatte schon angefangen zu weinen, was die Leute für ein untrügliches Zeichen halten. Jetzt bekam er ein großes Weizenbrot und sollte keine Last mehr zu tragen brauchen.
Am 7. Juli begünstigte uns das Terrain in hohem Grade. Im Süden zeigte sich wieder ein See, nach dessen Ostufer wir hinsteuerten. Es kostete uns den ganzen Tag, nach seinem Südufer zu gelangen. Das Tal, dessen Mitte dieser mittelgroße See einnimmt, ist kesselförmig, flach und offen, und auch der See ist beinahe rund und tritt durch seine starken, frischen Farben sehr hervor. Das Wasser ist rein und grellblau und ist mit einem ziemlich breiten Gürtel von blendendweißen Salzkristallisationen umgeben, die von fern wie Eis oder Schnee glänzen. Am Westufer erheben sich ziegelrote Höhen.
Es war lebensgefährlich, sich dem feuchten eigentlichen Uferstreifen zu nahen, denn er bestand ausschließlich aus salzhaltigem Schlamm, und es war nicht leicht, eine Kanne Wasser zum Untersuchen herbeizuschaffen. Kutschuk mußte sich eine Art improvisierter Schneeschuhe an die Füße binden, um an den Rand des Sees gelangen zu können. Das Wasser war derartig mit Salz gesättigt, daß das Aräometer halb über der Oberfläche schwamm; die Skala genügte natürlich nicht entfernt, sondern es mußte eine besondere Marke in das Glas geritzt werden.
Dieser heimtückische Schlammstreifen war durch eine ausgeprägte Wulst scharf von den Abhängen getrennt, die noch etwas Gras trugen und auf denen wir ohne Gefahr hinziehen konnten. Im Südosten drohte uns der nächste Paß; wir wollten in der Mündung des zu ihm hinaufführenden Tales lagern. Es handelte sich nur darum, Wasser zu finden, das es hier[S. 145] nicht in solchem Überflusse gab wie im Arka-tag. Der Niederschlag war zu unserem Glück in der letzten Zeit unbedeutend gewesen; morastiger Boden hätte unsere erschöpften Kamele umgebracht.

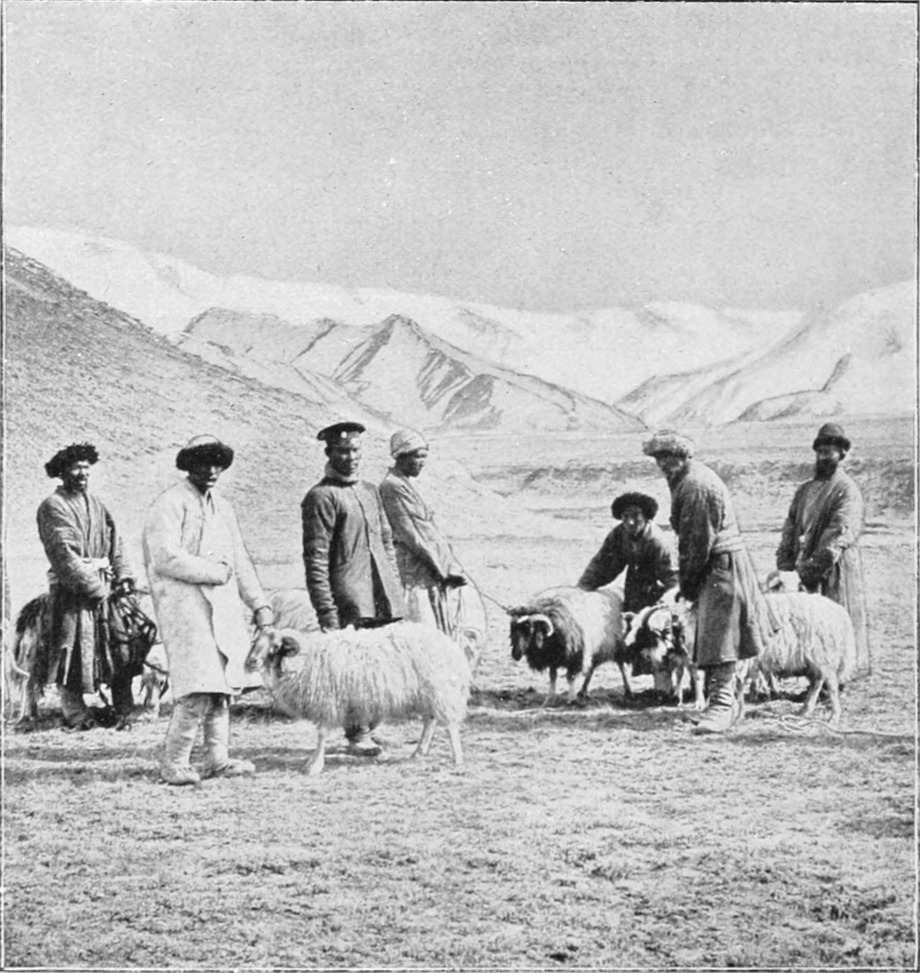
Ich ritt voraus die Talmündung hinauf; sie war ganz trocken. Auf ihrer anderen Seite fand ich doch noch ein paar kleine Tümpel mit schwach salzhaltigem Wasser, mit welchem die Hunde vorliebnahmen. Im Talgrunde aber griffen die Männer zu den Spaten; es wurde ein Brunnen gegraben, der in einer Tiefe von 56 Zentimeter kaltes süßes Wasser gab.
Obwohl wir am 8. Juli nur 14 Kilometer marschierten, konnten nur 27 Kamele das Lager Nr. 33 (5041 Meter) erreichen. Sie waren jetzt so erschöpft, daß wir aus Furcht, eines oder mehrere der Tiere zu verlieren, an und für sich unbedeutende Pässe umgehen mußten.
Der heutige Paß (5059 Meter) ließ sich jedoch nicht umgehen, und der Lama, der ihn rekognosziert hatte, versicherte, daß er nicht schwer sei. Die Steigung war auch unbedeutend, aber für die kraftlosen Tiere trotzdem mühselig. In der Nähe des Kammes grasten 8 Yake; einer von ihnen, ein alter Stier, war recht dreist, durfte aber nicht unnötigerweise geschossen werden; das Fleisch war vermutlich zäh und schlecht. Ein einzelner Kulan umkreiste uns in den tollsten Kurven und erregte durch seine urkomischen Manöver große Heiterkeit.
Auf der Südseite des Passes war das Relief der Landschaft verwickelter und ungünstiger. Mehrere Kämme zeigten sich, die überschritten werden mußten.
Jetzt ritt Schagdur voraus und meldete, er glaube kaum, daß die Kamele imstande sein würden, die nächste Schwelle zu überschreiten, da diese zu hoch für sie sei. Schon waren drei zurückgeblieben, auf die wir je eher, desto besser warten mußten, unter ihnen mein großer Veteran. Daher machten wir bei einem Tümpel Halt, obwohl die Weide dort schlecht war. Den Tag darauf schleppten sich zwei von den drei zurückgelassenen Kamelen noch nach dem Lager hin, das dritte lag kalt und steif auf dem Flecke, wo wir es verlassen hatten.
Daß es so nicht weitergehen konnte, war klar. Eine Veränderung mußte in der Marschordnung vorgenommen, alle schwachen Tiere mußten ausgeschieden werden, mit dem Reste würde ich dann in längeren Tagemärschen nach Süden ziehen. Zunächst mußte die Gegend rekognosziert werden, denn jetzt hatten wir das Gefühl, in einem Sacke zu stecken, aus dem wir irgendwo heraus mußten. Tschernoff ritt nach Osten und fand das Terrain dort ganz unmöglich und von steilen Bergen versperrt. Mollah Schah, der es nach Süden hin versucht hatte, erklärte, er sei dort über einige kleinere Pässe geritten, die nicht besonders schwierig seien.
[S. 146]
Dann wurde die Auslese vorgenommen. Elf Kamele, von denen fünf die letzten Tage schon keine Last mehr getragen hatten, und sechs Pferde sollten hier zurückgelassen werden, um sich einige Tage auszuruhen und dann unserer Spur in kurzen Tagemärschen nachgeführt zu werden. Dieser wichtige Auftrag wurde Tschernoff anvertraut; er wurde Chef der Nachhut, die außerdem noch aus Rosi Mollah, Mollah Schah, Kutschuk, Chodai Kullu und Almas, einem Tscharchliker, dessen hochtönender Name „das Juwel“ bedeutet, bestehen sollte. Die vier Hunde Maltschik, Hamra, Kalmak und Kara-Itt gehörten auch zur Gesellschaft, ebenso ungefähr die Hälfte des noch vorhandenen Dutzends der Schafe.
Die Auslese der untauglichen Kamele wurde von Turdu Bai und den Kosaken sorgfältig gemacht. Es waren ihrer zehn, aber beim Aufbruch wurde noch eines zurückgestellt. Acht Kamellasten, die beinahe ausschließlich aus Proviant bestanden, sollten von der Nachhut übernommen und auf die elf Kamele verteilt werden. Alle Instrumente und wichtigeren Dinge nahmen wir mit.
Ganz richtig war es wohl nicht, die Karawane gerade jetzt zu teilen, da wir uns bewohnten Gegenden näherten und vielleicht nötig haben konnten, in voller Stärke aufzutreten. Doch es blieb uns keine Wahl, und auch die Nachhut war mit zwei Gewehren und mehreren Revolvern bewaffnet.
Tschernoff hatte Befehl, noch zwei oder drei Tage im Lager Nr. 33 zu bleiben und dann unseren Spuren zu folgen, die in dem Boden ziemlich lange erkennbar sein mußten. An Stellen, wo man ein schnelles Verschwinden der Spuren befürchten konnte, wie in Talfurchen oder auf festgepacktem Schutt, wollten wir kleine Steinmale errichten. Wo ich mit der Hauptkarawane bleiben würde, wußte ich selbst nicht; es würde von Umständen, die uns unbekannt waren, und besonders von dem Vorkommen von Weide und menschlichen Spuren abhängen. Doch das spielte keine Rolle, denn selbst wenn Tschernoff einen ganzen Monat unterwegs sein sollte, hatte er ja nur der Spur zu folgen, bis er ins große Hauptquartier gelangte.
[S. 147]
Während des Rasttages im Lager Nr. 33 trat ein Umschlag im Wetter ein. Der Morgen war herrlich und klar, aber um die Mittagszeit schmetterte eine heftige Hagelbö auf uns herab, und bald folgte ihr eine zweite. Nachher sprühregnete es den ganzen Tag, und abends stürzte ein anhaltender Gußregen auf unsere Zelte nieder. Das eintönige Rauschen des Regens ist kein Vergnügen, wenn man weiß, daß alle Lasten dadurch an Gewicht zunehmen, Zelte und Jurten schwer und naß werden und das Erdreich aufweicht und sumpfig wird. Heute brauchte man nur ein paar Schritte ins Freie zu tun, um sich an den Stiefeln zolldicke Sohlen von Erde und Schlamm zu holen.
Am 10. Juli nahmen wir von den Leuten der Nachhut Abschied. Tschernoff hatte erkannt, daß es ihm als großes Verdienst angerechnet werden würde, wenn er möglichst viele von den elf Kamelen mit ins Hauptquartier brächte.
Nachdem es die Nacht tüchtig geschneit hatte, lag das Land wieder kreideweiß und winterlich da; der Boden war glatt und schlüpfrig, und dunkle Wolken segelten in rastloser Jagd nach Osten. In den trostlosen Umgebungen nahm sich die zurückbleibende Karawane noch erbärmlicher als gewöhnlich aus. Von den Tieren fanden es nur einige wenige der Mühe wert, in dem Schneeschlamme zu waten. Die anderen lagen und ruhten sich aus. Das Lager selbst sah trostlos elend aus, aber die Muselmänner wünschten uns glückliche Reise, und ich drückte Tschernoff zum Abschied die Hand; ich würde meinen tüchtigen, zuverlässigen Kosaken ja erst nach meiner Rückkehr von der Pilgerfahrt wiedersehen — wenn ich mit dem Leben davonkam.
Den ganzen Tag über war das Wetter unfreundlich. Ein anhaltender Hagelschauer war so heftig, daß wir halten und, in unsere Mäntel gehüllt, warten mußten, bis er vorüber war. Die Sonne, die sich darauf eine Weile zeigte, trocknete unsere Kleider, bis die nächste Bö uns wieder[S. 148] durchnäßte. Ich ritt mit dem Lama voraus und suchte nach einem Marsche von 23½ Kilometer den Lagerplatz aus. Obwohl die Karawane jetzt, da wir alle erschöpften Tiere zurückgelassen hatten, besser und schneller als gewöhnlich marschierte, mußten wir doch eine gute Weile auf sie warten, welche Gelegenheit der Himmel benutzte, um uns noch eine gründliche Dusche zu geben. Der Lama saß geduldig still, betete mit philosophischer Ruhe sein „Om mani padme hum“ und ließ dabei die 108 Perlen seines Rosenkranzes durch die Finger gleiten, während ich mich in eine Filzdecke hüllte, die stets auf meinen ungarischen Feldsattel geschnallt war.
Die Tagereise bot im großen und ganzen ziemlich vorteilhaftes Terrain, besonders nachdem wir zwei kleinere Pässe überschritten hatten. So weit zogen wir alle miteinander. Auf dem Südabhange des Passes grasten sechs Yake, und da die Jagd seit einigen Tagen keinen rechten Ertrag geliefert hatte, sollten jetzt Sirkin und Schagdur unseren Fleischvorrat verstärken. Nur ungern bequemen wir uns dazu, die Schafe zu schlachten, denn wir betrachten sie immer mehr als Kameraden, und überdies ist ihr Fleisch wenig wohlschmeckend, da die Tiere beständig in Bewegung sind und sich nicht satt fressen können. Die Kosaken erlegten je einen Yak, und Turdu Bai und Ördek begaben sich mit Messern und Beilen nach der Walstatt, um die besten Stücke für uns mitzunehmen.
Auf dem Passe (5186 Meter) wurde uns ein erfreulicher Anblick zuteil: wir sahen gleichmäßig offenes Land für ein paar Tagereisen. Aber in die Freude mischte sich auch Wehmut, denn im Südosten, Süden und Südwesten glänzte eine Kette mit gewaltigen Schneefeldern, die wir nicht würden umgehen können. In dem breiten Längentale, das sich wie gewöhnlich von Osten nach Westen bis ins Unendliche erstreckt, war die Weide knapp und bestand meistens aus Moos und wildem Lauch. Den letztern haben alle gern. Er wird in meine Suppen geschnitten; die Muselmänner kauen ihn roh und sagen, daß er gegen Bergkrankheit wirke, die Kamele fressen ihn mit wahrer Gier und ziehen ihn allem anderen vor. Wenn auf den Lagerplätzen weiter nichts zu tun ist, läßt Turdu Bai alle Mann Lauch pflücken, und auch während des Marsches macht er an Stellen, wo der Lauch dichter steht, einige Minuten Halt, um den Kamelen Zeit zum Abreißen der saftigen, wohlschmeckenden Stengel zu geben.
Wir befanden uns hier im Lager auf einer Höhe von 4982 Meter. Der 11. Juli war der Jahrestag zweier Ereignisse, die auch mit hohen absoluten Zahlen zu tun hatten und zu denen ich jetzt mit meinen Gedanken lebhaft zurückkehrte. Heute sind es vier Jahre, seit Andrée seinen kühnen, in jeder Beziehung glänzenden Ballonaufstieg von Spitzbergen machte und die Reise antrat, von der er nicht zurückkehren sollte. Ich sage absichtlich[S. 149] „glänzenden“, denn der Plan selbst war so kühn und großartig, daß keine andere Nation ein Gegenstück dazu aufweisen kann! Und die drei Märtyrer der Wissenschaft, die wir da verloren, hatten gezeigt, daß es noch tüchtige Männer im Schwedenlande gibt.
Am 11. Juli sind auch elf Jahre vergangen, seit ich den Gipfel des Demawend bestiegen hatte. Auch damals hatte ich einen saueren Tag, um meine 5715 Meter zu erreichen, aber damals handelte es sich um eine einzige, von freundlichen, lachenden Tälern umgebene Bergspitze, jetzt dagegen um endlose Räume, in denen wir uns mit schweren Schritten fortschleppten. —
Unsere Tagereise ging ungehindert nach Ostsüdost, aber ohne daß wir uns darum der hinter schwarzen Vorbergen versteckten Schneekette merklich näherten. Die Niederschläge waren reichlich, die Erde trocknete nicht mehr zwischen den Schauern, die alles in Schlamm verwandeln und die Kamele zum Ausgleiten bringen. Der Lama sagte, daß jetzt die Regenzeit ihren Einzug halte und zwei Monate dauern werde; „so ist es wenigstens in Lhasa“, fügte er hinzu.
Man erkennt die rücksichtslosen Regenböen schon von weitem; sie rollen einher wie blauschwarze Rauchmassen mit scharf abgegrenzter Front, vor welcher der blaue Himmel mit seinen weißer Watte ähnlichen Wölkchen zusammenschrumpft und verschwindet; hinter ihnen aber sieht es aus, als sei die Nacht selbst im Anzuge. Und man ist ihnen preisgegeben, kann nicht entrinnen; das Unwetter zieht herauf, Blitz und Donner kommen immer näher, die Schläge durchschneiden mit ohrenbetäubendem Krachen die Luft, die ersten schweren Tropfen und Hagelkörner fallen auf die Erde, und im Nu hat man die Bö über sich. Die Pferde werden unruhig und scheu, die Kamele versuchen sich jedes auf die geschützte Seite des anderen zu drängen, was die Lasten in Unordnung bringt. Man wird durch und durch naß, es rieselt und tropft von Mütze und Ärmeln, die Zügel liegen kalt und schmutzig in der Hand, die Filzstiefel saugen sich voll, und die ganze Annehmlichkeit des Rittes durch ein unbekanntes Land ist verschwunden. Wenn der Sturm über uns weggezogen ist, muß die Karawane wieder in Ordnung gebracht werden. Die Bergrücken scheinen mit der blendendsten weißen Farbe angestrichen zu sein.
Es gibt nichts Gemeineres als solch ein Wetter. Die Wanderung wird schwer und mühsam, das auf dem Erdboden ausgebreitete Bett ist feucht, und die Jurte verbreitet einen unangenehmen Geruch. Nur selten bietet sich eine Gelegenheit, die astronomischen und photographischen Instrumente zu benutzen, und das in Arbeit befindliche Kartenblatt ist nach einer Weile naß und knitterig.
[S. 150]
Während einer halben Tagereise folgten wir dem Flusse, an dessen Ufer wir gelagert hatten, nach Osten, nachher aber zogen wir auf leicht kupiertem Boden nach Südosten. Schließlich gelangten wir noch an einen Tümpel, wo wir für den Tag Halt machten. Die Zelte waren schon aufgeschlagen, als sich herausstellte, daß das Wasser salzig war. Ebenso ging es uns mit dem Brunnen, der gegraben wurde. Schagdur verschwand zu Pferd mit zwei kupfernen Kannen, und nach einer Stunde sahen wir ihn in vollem Galopp auf das Lager zureiten. Wir wunderten uns, daß er es so schrecklich eilig hatte, aber er erzählte sehr aufgeregt, daß er beinahe von einem Wolfe, den er jetzt für seine Frechheit bezahlen werde, überfallen worden sei. Der Wolf war ihm zweimal direkt zu Leibe gegangen, und er hatte zur Verteidigung nichts weiter gehabt als die kupfernen Kannen. Damit hatte er nach dem Wolfe geworfen und sich dann zu Pferd davongemacht. Wir konnten die große, beinahe weiße Bestie, welche die Verfolgung bis an das Lager fortgesetzt hatte, mit dem Fernglas beobachten. Doch als Schagdur und Sirkin mit ihren Flinten hinausritten, hielt es der Isegrimm für geraten, sein Heil in der Flucht zu suchen. Die Schafe wurden sicherer als gewöhnlich eingepfercht und die Pferde und Maulesel bewacht. Die Kamele hielten es nicht für der Mühe wert, sich nach den spärlichen Halmen zu bücken, die um diesen schlechten Lagerplatz herum in dem Schutte wuchsen, sondern kamen freiwillig nach Hause und legten sich neben ihre Plagegeister — die Lasten.
Nun mußte Ördek nach dem Flusse zurückreiten; es war schon stockdunkle Nacht, als er mit den gefüllten Kannen zurückkehrte.
Die ganze Nacht schneite es, und am folgenden Morgen verließ man mit Widerwillen die Jurte, um sich wieder in die Nässe hinauszubegeben. Es ist gerade wie beim Baden; wie man es auch anstellt, ohne Naßwerden geht es nicht ab.
In derselben Richtung (Südosten) durchzogen wir eine an Salztümpeln reiche Landschaft von lauter Hügeln und Landrücken und gingen über sechs kleine Pässe, bis wir einen bedeutenden Fluß erreichten, der in einen langgestreckten Salzsee mit weißen Salzkristallisationen an den Ufern mündete. Endlich sollten die Pferde getränkt werden. Der Fluß strömte außerordentlich langsam, kaum merkbar für das Auge. Sei es, daß er aus mit Salz gesättigten Gegenden kommt oder daß das Wasser des Sees bei Wind in den Fluß hinaufgeht, genug, um den ersehnten Labetrunk wurden wir schmählich betrogen, denn das Wasser war grimmig salzig. Bald darauf fanden wir indessen einen kleinen Tümpel mit süßem Wasser, und hier tranken alle Tiere nach Herzenslust (Abb. 238).
Auf dem zu unserer Rechten befindlichen Abhange weidete einsam ein[S. 151] großer schwarzer Yakstier. Da wir es für unnötig hielten, ihm das Leben zu nehmen, hetzten die Kosaken Scherzes halber die Hunde auf ihn. Diese umringten ihn mit wildem Geheul, hüteten sich aber wohl zu beißen. Jolldasch, der Spitzbube, zupfte ihn nur an den Seitenfransen. Der Yak drehte sich nach jedem Angreifer um, keuchte und schnaubte, richtete den Schwanz hoch auf und hielt die Hörner bereit. Dann und wann fuhr er schnell auf einen der Aufdringlichen los. Er war hiermit so beschäftigt, daß wir mit dem großen photographischen Apparate ganz nahe herankommen konnten; die Bilder wurden aber doch recht klein. Ich hielt das Tier fast für einen zahmen, Tibetern entlaufenen Yak, so ungeniert war es.
Nun kam Turdu Bai mit dem Todesurteil. Wir brauchten mehr Fleisch, sagte er. Die Hunde wurden fortgelockt, zwei Schüsse krachten gleichzeitig. Dem Yak schien weder der Knall noch die Kugeln das Geringste auszumachen. Seitdem die Hunde sich entfernt hatten, stand er regungslos da. Als sie aber wieder angriffen, geriet er in Wut und jagte sie den Abhang hinunter, stürzte dabei zu Boden und war schon tot, als wir herankamen.
Es war ein großer, schöner Stier, dessen Hörner infolge von früheren Kämpfen mit Nebenbuhlern an der Spitze ganz zersplittert waren. Fleisch und Fett wurden mitgenommen, der Rest blieb liegen, wahrscheinlich zum Frommen für Schagdurs Freund, den Wolf.
Es ist eigentümlich, zwei ganze Tagereisen zurückzulegen, ohne Wasser zu finden, und dabei sieht man überall Lachen, denn die Regenzeit ist da. Dennoch marschierten wir 20 Kilometer, ohne Trinkwasser zu finden. Als sich schließlich ein Kamel weigerte, uns über noch eine übrigens ganz unbedeutende Paßschwelle zu folgen, lagerten wir. Schagdur machte weiter oben eine Quelle ausfindig.
„Wo ist das gute Gras? Wo werden wir das Hauptquartier aufschlagen?“ fragen wir uns jetzt täglich. Wir müssen noch 383 Kilometer von dem nordwestlichen Ende des großen Sees Tengri-nor entfernt sein. Wir können aber kaum erwarten, Spuren von Menschen zu finden, bevor wir jenseits der mächtigen Kette angelangt sind, deren Schneegipfel heute ein paarmal zwischen den Hügeln auftauchten. Der wilde Yak hatte entschieden nie Menschen gesehen, sonst hätte er sich auf das Photographiertwerden, das ihm das Leben kostete, gewiß nicht eingelassen. Merkwürdigerweise ist gerade diese Gegend sehr reich an Schädeln und Gerippen von Kulanen und Orongoantilopen. Doch stammen diese Skelette nur von verendeten Tieren her, denn wenigstens die Kulane werden von den Tibetern nie getötet.
Am 13. Juli zogen wir in dem offenen Längentale (Abb. 239) weiter und brauchten die Kamele nicht mit Pässen zu quälen. Das Gras ist schlecht;[S. 152] eine neue Art davon tritt auf, die der Lama „Buka-schirik“ oder Yakgras nennt und die auf der Pilgerstraße der Mongolen nach Lhasa und in der Umgegend dieser Stadt allgemein vorkommen soll. Wild ist in diesen Gegenden häufig; wir sehen Yake, Kulane, Orongoantilopen, Hasen und Rebhühner. An einem großen Flusse hielten wir es für das Klügste, das Lager aufzuschlagen, da wir so lange kein gutes Wasser mehr gehabt hatten.
Am 15. Juli stieg die Temperatur auf +11,1 Grad, nachdem sie nachts auf −3,4 Grad heruntergegangen war. Wir marschierten noch immer nach Südosten, um nach einer Einsenkung in dem gewaltigen Kamme, der uns im Süden von den Geheimnissen des heiligen Landes trennte, umherzuspähen. Hatten wir erst diesen Wall, der möglicherweise auch klimatische Bedeutung besaß, überwunden, so würden wir sicher in wärmere Gegenden gelangen, die eine bessere Weide boten und vielleicht von Tibetern bewohnt waren. Noch hatten wir aber keine Spur von Menschen gesehen.
In der Mitte des heutigen Marsches überschritten wir einen sehr großen Fluß, den größten, den wir seit dem Tarim gesehen hatten (Abb. 240, 241). Er strömte nach Südwesten, einem großen See zu, den wir nur aus der Ferne zwischen Hügeln und Bergen hatten hervorglänzen sehen. Die Wassermenge, die sich auf etwa zwanzig große und ebensoviele kleine Arme verteilte, betrug wohl 23 Kubikmeter in der Sekunde, die Stromgeschwindigkeit 1 Meter in der Sekunde und die größte Tiefe 60 Zentimeter. Hätte der Fluß nur eine einzige Rinne gehabt, so wären wir ohne die Hilfe des Bootes nicht hinübergekommen. Es erforderte mehr als eine halbe Stunde, um das andere Ufer dieses großen Wasserlaufes, der von den Schneebergen im Süden kommt, zu erreichen.
Die Hügel des linken Ufers waren von einer aus 75 Tieren bestehenden Yakherde geradezu schwarzgetüpfelt. Sie halten sich im Winter unten in den großen Längentälern auf, aber ihre Sommerfrischen liegen auf den mit Yakmoos bewachsenen Halden in der Nähe des ewigen Schnees.
Gerade vor uns, höher oben in dem breiten, offenen Talgrunde, zeigte sich etwas, das wir für einen Menschen hielten, der uns hochaufgerichtet mit steifer Haltung entgegenkam, aber infolge der Entfernung und der zitternden Luft nur undeutlich zu unterscheiden war. Sirkin, der Lama und Turdu Bai untersuchten den Gegenstand mit dem Fernglas und erklärten bestimmt, es sei ein Mann; der Lama fügte hinzu, der Mann sammle Yakmist und hinter ihm seien zwei schwarze Zelte zu sehen. Also schon jetzt Tibeter mit großen Yakherden? Es wäre fatal, mitten auf dem Marsche von Tibetern überrascht zu werden; nun würde die burjatische Verkleidung umsonst sein und durch alle unsere Pläne ein Strich gemacht werden!
[S. 153]
Auch ich sah mir diesen rätselhaften Wanderer lange an. Wir warteten eine ganze Weile, um ihn näherkommen zu lassen. Doch mit der Zeit verwandelte sich unser Mann in einen Kulan, den wir in Verkürzung gesehen hatten; die schwarzen Zelte waren einfach die Schatten einer Erosionsterrasse, und die Herde bestand aus wilden Yaken, die, sobald sie unsere Karawane witterten, angefangen hatten, sich talaufwärts zu entfernen.
Bald darauf scheuchte Jollbars einen jungen Hasen auf, dem es sicher schlecht gegangen wäre, wenn er den Hund nicht durch seine schnellen Seitensprünge ermüdet und sich dann in eine kleine Erdhöhle geflüchtet hätte. Hier war er jedoch auch nicht sicher, denn Schagdur holte ihn mit der Hand heraus, band ihn und streichelte das erschreckte Tierchen. Als die Karawane und alle Hunde vorbeigezogen waren, löste ich seine Bande, um ihm die Freiheit wiederzuschenken. Er hüpfte mit leichten Sprüngen vergnügt fort und schien ganz erstaunt, daß er aus einem solchen Abenteuer mit heiler Haut davongekommen war; aber noch war er nicht weit gelangt, als ein Falke, den wir nicht bemerkt hatten, auf ihn herabstieß. Schagdur eilte hinzu, kam aber zu spät. Der Falke ließ seine Beute mit ausgehackten Augen in Todeszuckungen liegen.
Derartige Ereignisse sind die einzigen Unterbrechungen der langen, einförmigen Ritte. Ich reite stets neben dem Lama, um mich im Mongolischen zu üben, und allmählich nehmen unsere Pläne nach Lhasa eine immer deutlichere Gestalt an.
Am linken Ufer eines neuen Flusses, der sich weiter abwärts mit dem großen vereinigt, war die Weide besser als seit langem und überall so viel Yakdung vorhanden, daß wir dort das Lager aufschlagen konnten. Das Wetter war strahlend hell, in der Luft summten sogar Fliegen. Ein wenig weiter oben zeichneten sich die schwarzen Umrisse von 20 Yaken ab, und Kulane wie Antilopen waren zahlreich vertreten. Ein Kulan spazierte ganz in unserer Nähe auf dem gegenüberliegenden Ufer umher. Zwei Hunde schwammen über den Fluß und jagten ihn eine Strecke weit, er blieb aber sehr ruhig, graste weiter und ließ die Hunde bellen, soviel sie wollten. Nicht einmal Rebhühner und Wildgänse mit ganz kleinen Jungen fehlten in dieser Gegend, die uns außergewöhnlich gastfreundlich aufnahm.
Am 16. Juli blieben wir im Lager Nr. 38. Turdu Bai und Hamra Kul wurden in das gewaltige Tal hinaufgeschickt, in dem ich es nicht gleich mit der ganzen Karawane versuchen wollte; konnte es doch so schwer zu erklimmen sein, daß wir hätten wieder umkehren müssen.
Gerade als ich das Universalinstrument zum Observieren aufgestellt hatte, brach ein heftiger Hagelschauer los. Der Himmel wurde im Westen schwarz, der Donnergott rollte mit seinem schweren Wagen durch die Wolken,[S. 154] und die Schläge folgten so dicht aufeinander, daß die Erde unter ihnen bebte. Ich mußte hübsch wieder unter Dach kriechen. Die Hagelkörner schmetterten auf die Filzdecken meiner Jurte und tanzten wie Zuckerkügelchen auf dem Erdboden, der bald weiß wurde.
Nun ertönte Geschrei und Rufen. Tscherdon, der die Wache hatte, meldete, daß die anderen beiden Kosaken einen großen Bären aufgetrieben hätten, der in scharfem Galopp nach dem Lager eilte, aber rechtzeitig nach Osten abschwenkte, mit raschen Schlägen über den Fluß schwamm, die gegenüberliegende Uferterrasse hinaufkletterte und, die beiden Reiter hinter sich, die Flucht fortsetzte.
Kaum war die wilde Jagd an uns vorübergesaust, als von Tscherdons Zelt ein Schuß krachte. Ein großer, alter, weißgrauer Wolf war vor dem Lager umhergeschlichen und mußte ins Gras beißen.
Nach einer guten Stunde kehrten die Kosaken in scharfem Trab zurück und sprengten gerade auf mich los; es war ihnen anzusehen, daß sie mir etwas Wichtiges mitzuteilen hatten. Der Bär war ihnen nach einem letzten Schusse freilich entkommen, dafür aber waren die Jäger, geradewegs in ein tibetisches Lager hineingeritten! Ein mit einer Flinte bewaffneter Mann war bei ihrem Herannahen hinter einem Hügel verschwunden, einige Pferde weideten in der Nähe, und die 20 Yake, die wir gestern gesehen hatten, waren also doch zahme Tiere.
Nun waren die Kosaken, die sich mit dem Manne nicht hatten verständigen können, schleunigst umgekehrt, um mir von dem Geschehenen Mitteilung zu machen.
Der Lama war sehr verdutzt, als ihm die gefährliche Wirklichkeit auf den Leib rückte. Solange wir keine Spur von Menschen gesehen hatten, war ihm mein Plan als etwas Unbestimmtes, noch in weiter Ferne Schwebendes erschienen, aber jetzt standen wir an dem Punkte, wo die ersten Eingeborenen auftauchten und von welchem wir daher aufbrechen mußten. Wir fingen an zu glauben, daß der Kulan, den wir gestern gesehen hatten, doch am Ende wirklich ein Mann, jedenfalls aber ein Omen gewesen sein müsse, ein Vorzeichen, daß menschliche Wohnungen nicht mehr weit entfernt seien.
Wir berieten uns eine Weile über die Sachlage. Es war keine Zeit zu verlieren, denn auf die Kosaken hatte es den Eindruck gemacht, als hätten die Tibeter ihre Yake und Pferde nach dem Lager geholt, um bald aufzubrechen. Wir mußten sie festhalten, denn teils konnten sie uns wichtige Aufklärungen über Wege und andere Verhältnisse geben, teils würde es besser sein, wenn wir versuchten, ihr Vertrauen zu gewinnen und mit ihnen zusammenzureisen, um sie so zu verhindern, unsere Ankunft zu verkünden,[S. 155] welche Nachricht andernfalls wahrscheinlich wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund bis nach Lhasa dringen würde.
Ihr Lager war, nach Sirkin, nicht mehr als drei Kilometer von uns entfernt. Sie mußten uns auf jeden Fall gesehen haben, als wir gestern ankamen; man konnte sich jedoch nicht wundern, wenn sie sich absichtlich abseits hielten. Waren es tibetische Nomaden oder tangutische Räuber? Oder am Ende nur friedliche Yakjäger, die Fleisch und Felle auf zahmen Yaken nach Süden transportierten? So früh hatte ich nicht erwartet, Menschen zu treffen. Merkwürdig ist es auch, daß wir bisher noch keine Spur von alten Feuerstellen gesehen hatten.
Einstweilen beauftragte ich den Lama und Schagdur, sofort dorthin zu reiten und mit ihnen zu reden. Auch der Kosak kleidete sich in ein mongolisches Gewand und sah, dank seiner Rasse, wie ein echter Mongole aus, der er in Wirklichkeit ja auch war. Ich gab ihm Silbergeld mit für den Fall, daß die Tibeter geneigt wären, uns einige von ihren Pferden, sowie Tee und Tabak zu verkaufen, und damit sie sehen sollten, daß sie es mit ganz freundschaftlich gesinnten, ehrlichen Leuten zu tun hatten.
Die beiden Männer sprengten wieder durch den tiefen Fluß und verschwanden in der Dämmerung.
Gerade jener Augenblick, den ich gern solange wie möglich hinausgeschoben gesehen hätte, war jetzt ganz unerwartet eingetreten. Es ist klar, daß es für uns wallfahrende Pilger vorteilhaft gewesen wäre, wenn das starke Hauptquartier möglichst weit nach Süden hätte vorgeschoben werden können, so daß wir nicht zu weit von ihm abgeschnitten waren. Wir hatten verabredet, vorsichtig vorzudringen und Halt zu machen, sobald wir Menschenspuren entdeckten. Ja, wenn wir während des Marsches in der Ferne Herden oder Zelte erblickten, wollten wir sofort anhalten, so daß wir Pilger wenigstens Zeit hätten, uns „umzukleiden“, damit wir später, wenn wir zurückritten und uns dem heiligen Lande auf einem anderen Wege näherten, nicht dem Verdachte ausgesetzt wären, zu der großen europäischen Karawane zu gehören.
Nach ein paar Stunden kamen die Reiter in dunkler Nacht unverrichteter Sache wieder. Die Tibeter waren aufgebrochen; ihre Spur ging nach Osten. Ihr Feuer aus Argol (Yakdung) glühte und rauchte noch. Schagdur glaubte, daß sie erst nach dem Schusse der Bärenjäger auf uns aufmerksam geworden seien und sofort eingepackt hätten. Nach Ansicht des Lamas waren es drei Yakjäger gewesen; zwei Yakschädel und einige Hufe lagen auf der Erde verstreut. Wir überlegten, ob wir es versuchen sollten, die Tibeter einzuholen; aber da sie sicher beabsichtigten, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag zu marschieren, mußten wir aus Rücksicht auf den Zustand unserer Pferde auf die Verfolgung verzichten.
[S. 156]
Mit dem Frieden war es von diesem Tage an in unserem Lager vorbei. Nachts wurden Wachen aufgestellt, und die Karawanentiere durften nicht aus den Augen gelassen werden. Wir fingen an, halb auf Kriegsfuß zu leben, und mir stieg der Gedanke auf, daß es am Ende gefährlich sei, die Karawane zu verlassen; sie konnte leicht überfallen werden, da es jetzt ohne Zweifel als bekannt gelten durfte, daß eine Karawane im Anzuge war. Deshalb beschloß ich nach Beratung mit Schagdur zunächst, daß Tscherdon im Hauptquartier zurückbleiben müsse, um die Zahl der Verteidiger für den Fall eines Angriffes zu vergrößern. Später würde sich dann auch noch Tschernoff mit der Nachhut zu ihnen gesellen.
Dagegen hielten wir es für unnötig, das Hauptquartier schon hier anzulegen, denn es war keine Aussicht vorhanden, daß wir mit unseren schlechten Pferden die heilige Stadt eher erreichen würden als die vergrößerten, übertriebenen Gerüchte, die bald in Umlauf sein würden. Von hier aus hätten wir 1100 Kilometer hin und zurück gehabt, mehr, als unsere Tiere aushalten konnten, besonders da es sich um einen forcierten Ritt handeln würde.
Da Turdu Bai und Hamra Kul nichts von sich hören ließen, mußten wir noch einen Tag im Lager Nr. 38 bleiben. Während desselben wurde unsere ganze mongolische Ausstattung in Ordnung gebracht, so daß für den Fall einer plötzlichen Trennung von der Karawane alles in Bereitschaft war. Auf der inneren Seite meines einen mongolischen Stiefels wurde eine lederne Hülse für ein Thermometer angebracht; für Uhr, Aneroid und Notizbuch wurden Taschen in meinen Pelz genäht.
In der Dämmerung zeichneten sich die Schattenrisse unserer beiden Kundschafter ab. Beide meldeten, daß so weit, wie sie talaufwärts vorgedrungen seien, keine Hindernisse vorlägen. Sie hatten an ein paar Stellen alte Feuerspuren gesehen, die zeigten, daß die Gegend ihres Yakreichtums wegen bekannt war.
Am 18. Juli gingen wir südostwärts bis an den Punkt, wo das letzte Gras wuchs. Dreimal mußten wir über den Fluß hinüber. Eines der Kamele konnte kaum den Lagerplatz noch erreichen; es war jedoch bedeutend fetter als die anderen und schien ganz gesund zu sein. Es war entschieden nur faul; aber als es sich auch am folgenden Morgen nicht bewegen ließ, die Wanderschaft bergauf fortzusetzen, wurde es zurückgelassen. Die Nachhut würde auf jeden Fall hier vorbeikommen und es mitnehmen. Langweilen würde sich das arme Tier hier in der Einsamkeit schon, aber von Wölfen würde es nichts zu fürchten haben; diese greifen nie ein Kamel an, das einen Packsattel trägt, behaupten die Muselmänner.
Auf einem kleinen Hügel neben dem Lager wurde eine Jurtenstange[S. 157] aufgepflanzt und an ihrer Spitze eine Konservendose festgebunden, in der ein Zettel lag, auf den ich in türkischer Sprache geschrieben hatte: „Wir haben hier ein Kamel zurückgelassen; wenn es nicht hier ist, so folgt seinen Spuren, bis ihr es findet!“ Es war möglich, daß das Tier, wenn es sich erholt hatte, auf die Idee verfiel, seine Kameraden zu suchen.
Wir hatten also eines der achtzehn verloren. Fragend folgte es uns mit den Blicken, als wir unbarmherzig weiterzogen. Darauf beugte es den Hals, um zu grasen, und wir sahen es nie wieder. Denn gerade hier machte die Nachhut, die nicht immer an derselben Stelle lagerte wie wir, einen Umweg. Sie sahen das verlassene Kamel nicht mehr; es war das einzige Tier, das ohne Hoffnung auf Rettung lebendig zurückblieb und von dessen weiteren Schicksalen wir nie etwas erfahren sollten.
Unser Zug geht auf unfruchtbarem Boden nach Südosten weiter; Schnee und Hagel lassen uns wenig von den Umgebungen sehen — heute haben wir vollständigen Winter nach der gestrigen Sommerwärme. Auf dem linken Ufer des Flusses geht es immer höher hinauf. Yakdung lag überall, aber Herden sahen wir merkwürdigerweise nicht; wir hatten den Eindruck, daß sie kürzlich verscheucht sein müßten. Als Zeichen von Jägerbesuchen fanden wir an drei Stellen Feuerherde, von denen einer zehn Tage alt sein konnte und aus einigen kreisförmig aufgestellten Steinen bestand, in deren Mitte Asche lag. Ein schlanker Tonkrug war hier in Scherben gegangen; der Hals lag noch da.
[S. 158]
Noch einen Tag sollten wir uns nach immer höheren Regionen hinaufarbeiten, und es galt jetzt, die gewaltige Schneekette, die wir solange zur Rechten gehabt hatten, zu übersteigen.
Die Kamele halten sich tapfer, aber ihre Kräfte sind im Schwinden. Das Dromedar scheint der nächste Todeskandidat zu sein; es ist nur noch Haut und Knochen und weint abends schmerzlich. Trotzdem spannte es seine Kräfte aufs äußerste an und legte ehrenvoll die 19,1 Kilometer zurück. Als Abendmahlzeit hatte es ein paar gewaltige Weizenbrote, Heu aus einem Packsattel und ein paar Klumpen rohes Schaffett bekommen, das an stärkenden Eigenschaften alles übertreffen solle.
Die Sonne und die Hochalpenlandschaft wurden bald von undurchdringlichen Wolken verdeckt. Unsere Straße ging nach Südsüdwest, und das Unwetter kam uns gerade entgegen. Was nützt einem bei solchem Wetter ein Pelzbaschlik? Hagel und Schnee schlagen mir wagerecht ins Gesicht, bleiben im Pelz sitzen, schmelzen und rinnen mir am Halse hinunter. Manchmal muß man stehenbleiben und dem Unwetter den Rücken kehren, um Atem zu schöpfen. Die Gegend ist verborgen unter diesen scheußlichen Wolkenvorhängen, durch deren Hagelschauer wir reiten müssen. Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen zu zeichnen und zu schreiben! Wenn es sich für eine Weile aufklärt, wundern wir uns, daß wir dem gewaltigen Gletschermassiv zur Rechten nicht sichtlich nähergekommen sind. Wir schreiten freilich ununterbrochen nach dem Passe hinauf, aber ganz unglaublich langsam.
Auf beiden Seiten des Passes laufen mehrere Gletscherzungen aus; sie sind vollständig überschneit, und jede von ihnen entsendet einen Bach. Am Rande der Gletscher sehen wir große Yakherden; wir zählen über 300 Tiere, darunter einige ganz kleine Kälber. Tscherdon schoß eines der letzteren für unseren Proviantvorrat. In dem Maße, wie wir uns näherten, zogen sie sich über den Paß nach der Südseite hinüber. Die Abhänge,[S. 159] auf denen sie im Moose weideten, sahen von ihren dichten Reihen wie schwarzgestreift aus.
Mitten in dem flachen Tale, in dem wir nach der Paßschwelle hinaufziehen, rieselte ein Bach, der nur ein oder zwei Meter breit, aber oft einen Meter tief ist. Büschel von feuchtem, dichtem Yakgras bildeten seine Ufer. Daß sich der tibetische Ochs hier sehr wohl fühle, bewiesen die reichlichen Dungmassen, die umherlagen. In dem Bache leben kleine Fische, die sich besonders in den ruhigeren Becken aufhalten. Fische 5000 Meter über dem Meere! Wie gewöhnlich wurden Exemplare in Spiritus mitgenommen.
Schließlich hören Bäche und Gletscherabflüsse auf, die Steigung nimmt zu, und ich gelangte mit dem Lama auf diesen himmelstürmenden Paß, dessen Höhe 5462 Meter betrug. Die Karawane mühte sich noch auf dem Abhange ab. Ein großer Yak, der böse und herausfordernd aussah, versperrte den Weg nach Süden. Er wedelte mit dem Schwanze in der Luft, senkte die Hörner und machte gar keine Miene zu entfliehen. Wir hielten es für geraten, die Ankunft der Schützen abzuwarten; doch sobald die ersten Kamele auf dem Kamme auftauchten, trottete der Yak ab.
Inzwischen wurde das uns im Süden erwartende Land mit dem Fernglas gemustert. Vor uns breitete sich ein Gewirr von Bergen und Ketten, ein Labyrinth von Tälern aus. Ein bedeutender Fluß sammelte sich am Südabhange; wir folgten ihm abwärts. Hier hielten sich sieben alte Yake auf, die von den Hunden mit Todesverachtung angegriffen wurden. Vier suchten sofort ihr Heil in der Flucht, drei hielten eine Weile stand. Als aber die Angreifer ihre Attacke auf einen Yak konzentrierten, machten sich die beiden anderen ebenfalls aus dem Staube. Der letzte hatte verzweifelte Mühe, sich die Hunde vom Leibe zu halten. Er entschloß sich schließlich für die schlaue Taktik, sich mitten in den Fluß zu stellen, wo das Wasser um ihn schäumte und die Hunde scheu machte. Nach einer Weile kamen zwei Kameraden zurück, um sich nach ihm umzusehen, aber die Hunde waren des Spieles schon beinahe überdrüssig, hatten sich hingesetzt und schauten ihr Opfer nur noch an.
An dem Punkte des Tales, wo den Kamelen die Lasten für die Nacht abgenommen wurden, war das Gras bedenklich mager. Mitten auf ebenem Boden lag ganz regungslos, den Blick auf uns gerichtet, ein Rebhuhn, auf das einer der Kosaken schoß. Es taumelte im Todeskampfe auf; dabei stellte sich heraus, daß es auf drei kleinen Küken gelegen hatte, die unverletzt piepend um die Mutter herumliefen. Wenn man sich nicht zum Troste sagen könnte, daß man in diesen unwirtlichen Gegenden jedes Wild, das einem in den Weg kommt, zu erlegen berechtigt ist, weil man sein eigenes Leben damit fristen muß, so würde man sich wie ein Räuber und Schurke[S. 160] vorkommen, wenn man ein so idyllisches Familienleben gewaltsam zerstört und solch ein bescheidenes Glück von der Erde vertrieben hat. Es dauerte lange, bis ich die Erinnerung an diesen feigen Schuß los wurde. Ich suchte mich damit zu trösten, daß die Hunde das Rebhuhn, das mit seinen drei Küken abends in die Bratpfanne kam, doch totgebissen haben würden.
Die Kamele müssen lange rupfend umhergehen, ehe sie so viel Gras im Maule haben, daß es sich des Kauens und Schluckens verlohnt. Das Gras ist zäh und hart, und die Wurzeln bleiben beim Rupfen daran sitzen, denn der Erdboden ist von den Niederschlägen aufgelöst.
Der Lama, der ein kluger Mensch ist, bemerkte ganz richtig, daß diese gigantische Bergkette für die Tibeter dieselbe Rolle spiele wie der Arka-tag für die Bewohner von Ostturkestan; sie ist eine Grenzmauer gegen das unbekannte, unbewohnbare Land, eine Grenze, die selten überschritten wird, und dann nur von Yakjägern. Zwischen dieser Kette und dem Arka-tag liegen die höchsten und unfruchtbarsten, daher auch am schwersten zugänglichen Teile von Tibet. Jetzt hatten wir noch 280 Kilometer bis nach dem Nordufer des Tengri-nor, und die ersten Lagerplätze der Nomaden konnten nicht mehr sehr weit sein.
Am Morgen des 21. Juli erwachte ich bei Schneetreiben. Kompakte, beinahe schwarze Wolkenmassen hängen längs des Kammes der ewigen Schneekette. Diese wird ganz von ihnen eingehüllt, und man würde von ihrem Dasein keine Ahnung haben, wenn nicht zwei Gletscherzungen, den Tatzen eines ungeheueren Eisbären vergleichbar, unter dem Saume des Wolkenmantels herunterhingen. Die Schneegrenze dürfte sich hier etwa 100 Meter über der Paßhöhe befinden. Trotz dieser bedeutenden absoluten Höhe kamen keine nennenswerte Fälle von Bergkrankheit vor. Nur Tscherdon, der Yaken nachgelaufen war, hatte Kopfweh.
Durch eine Hagelbö nach der anderen reiten wir zum Passe hinauf. Auf der rechten Seite mündet hier ein Nebental, und der vereinigte Fluß, der nun die Richtung nach Südost einschlägt, mußte uns den Weg nach tieferliegenden Gegenden mit Weideland zeigen. Wir beschlossen, ihm zu folgen, soweit er ging.
Gerade in dem Talknie lagen zwei gewaltige Eistafeln, in denen hier und dort Waken gähnten, unter denen man das Wasser des Flusses strömen sah. Manchmal muß man sich darüber wundern, daß die ziemlich gebrechlichen Eisbrücken nicht unter den Kamelen einstürzen. Bald wird das Eis zusammenhängender und dicker. Der Fluß strömt frei in der Mitte des Talbodens, und auf jeder Seite begleitet ihn ein ununterbrochenes dickes Eisband mit senkrechten oder überhängenden Wänden (Abb. 242).
[S. 161]
Die Karawane ging auf der rechten Eisscholle, die bei einer Biegung des Flusses unterbrochen war, so daß wir auf den Schuttboden hinunter mußten. Die Eistafel war jedoch lotrecht und 1,97 Meter hoch, so daß alle Äxte, Stangen und Spaten in Tätigkeit gesetzt werden mußten, um einen Weg zu bahnen (Abb. 243). Diese Arbeit dauerte eine gute Stunde, während welcher Schagdur weiterritt. Mir sah diese Straße höchst bedenklich aus, denn das Tal verschmälerte sich immer mehr; wahrscheinlich war es ein tief eingeschnittenes Durchbruchstal, das uns nicht mehr herauslassen würde.
Der Eisabhang wurde mit Sand bestreut; dann führten wir alle Tiere vorsichtig hinunter, um in der 20–40 Meter breiten Rinne zwischen den Eisbändern weiterzuziehen, wobei wir meistens im Flusse selbst gingen. Auf dem Talboden war es tüchtig naß; es spritzte und patschte um die Kamele. Von den Eisrändern tropfte und rieselte es im Regen, umsomehr als sich die Temperatur den ganzen Tag einige Grade über dem Gefrierpunkte hielt.
Wir waren schon eine Strecke weit in der Nässe gewatet, als wir Schagdur trafen. Fünf, sechs Kilometer könnten wir noch marschieren, sagte er, weiter aber nicht. Dort hörten die Eisbänder auf und ein Hohlweg beginne, in dem der Fluß zu einem tiefen, unpassierbaren Strom zusammengedrängt werde. Schagdur war mit seinem Pferde noch in ein Meter tiefem Wasser geritten, dann aber umgekehrt.
Da dazu kam, daß sich die Wassermenge des Flusses bis zum späten Abend stündlich vergrößern mußte, beschloß ich umzukehren. Man konnte ja in einer solchen Falle in eine, gelinde ausgedrückt, ungemütliche Lage geraten und von oben und unten abgeschnitten werden. Das Wasser würde nachdrängen und das Tal so füllen, daß wir auch nicht wieder zurückkönnten. Und Talerweiterungen, wo man die Kamele nach den Seiten hätte führen können, hatte der Späher nicht gesehen.
Also das Ganze kehrt gemacht und wieder zurück durch diese angenehme Passage mit ihren unzähligen Furten, Waken und Tümpeln. Jetzt war alles noch mehr durchweicht, und in den Spuren der Kamele hatte sich Wasser angesammelt. Überall rieselt und sprudelt es, und das Eis knackt und kracht. Es füllt im Winter ohne Zweifel das ganze Tal aus, wird aber von dem von den Gletschern gespeisten Flusse im Frühling schließlich durchbrochen. Es mag eigentümlich erscheinen, daß solche Eismassen bis Mitte Juli liegenbleiben können; doch dies hat seinen Grund teils in der absoluten Höhe, teils in der hohen, schützenden Bergwand, die sich auf der Südseite des Tales erhebt.
Da, wo die Richtung des Tales nach Südosten überging, verließen wir unsere Spur und gingen am Ufer des von rechts kommenden Nebenflusses hinauf. Damit der Nachhut unsere vergebliche, anstrengende Eiswanderung[S. 162] erspart bliebe, wurde in der Talbiegung ein Steinmal errichtet und davor an der Erde aus Steinstücken eine Pfeilspitze angebracht, die nach Südwesten zeigte.
Statt, wie wir gehofft, die Reise nach Süden und wärmeren Gegenden hinunter fortsetzen zu können, mußten wir wieder ein völlig unfruchtbares Tal hinaufziehen. Der Hagel schlug heftiger als je nieder. Es war ziemlich gleichgültig, wie die Gegend aussah, denn heute konnten wir nicht mehr weiter, und da es sich hier um einen neuen Paß handelte, war auch keine Hoffnung vorhanden, daß wir eher Weide finden würden als auf seiner anderen Seite.
Gegen Abend klärte sich der Himmel auf; ich lag auf meinem Bett, rauchte meine Pfeife und betrachtete die Kamele, die mit Engelsgeduld nach Gras suchten. Die Sonne sinkt, die Wolken färben sich rotbraun, und als es dämmerig wird, schmettern wieder schwere Regentropfen auf die schon feuchten Filzdecken der Jurte. Nun wird das Licht angezündet, die Arbeit geht weiter, und der Abend verfließt in gewöhnlicher Ruhe. Wir plaudern eine Weile in Sirkins Zelt und tauschen unsere Meinungen darüber aus, wie Tschernoff mit den erschöpften Kamelen der Nachhut hier durchkommen wird. Wir beraten auch über die Reise nach Lhasa. Sollten wir nicht einige Platz erfordernde Sachen, wie Stearinkerzen und den kleinen photographischen Apparat in dem Packsattel eines Maulesels durchschmuggeln können? „Nein“, erklärte der Lama, „hierzulande ist man nie sicher; sie stehlen uns vielleicht das ganze Tier mit Sattel und allem.“
Der nächste Tag brachte uns hinsichtlich der Terrainverhältnisse keine Änderung zum Bessern. Nachdem wir noch ein Steinmal errichtet hatten, schritten wir zu dem Passe hinauf, der von fern sehr leicht aussah, in Wirklichkeit aber schwerer zu übersteigen war als der vorige.
Ich ritt mit dem Lama in dem Flußbette aufwärts, das der einzige Weg mit festem Boden war; denn entfernt man sich nur ein wenig von ihm, so sinkt das Pferd in den Morast ein, und man muß schnell abspringen und versuchen, wieder auf tragfähigen Boden zu gelangen. Die Abhänge bestehen nach dem Flußbette zu aus einer breiähnlichen Schlammmasse, die, nach den oft vorkommenden Quer- und Randspalten zu urteilen, sich in wenn auch unmerklich gleitender Bewegung befindet. Die absolute Höhe, die recht fühlbare Steigung und der lose Boden könnten vereint auch die beste Karawane vernichten.
Zwei Stunden brauchten wir zum Hinaufreiten; nachher mußten wir dort zwei Stunden auf die anderen warten. Ein rasender Hagelsturm tat das Seine, den Boden noch mehr aufzuweichen. Es ist qualvoll anzusehen, wie die Kamele, wenn sie in den Brei einsinken, sich abmühen und[S. 163] abquälen, um sich wieder herauszuarbeiten. Nur fünfzehn erreichten den Paß, zwei waren mit je einem Manne zurückgelassen worden. Ihre Lasten übernahmen Pferde, deren Reiter zu Fuß gehen mußten.
Der Südabhang war zehnmal schlimmer; dort war es weder möglich, festen Boden zu finden, noch zu Pferd zu sitzen. Ein Mann geht voraus, um das Erdreich zu prüfen, ihm folgt Turdu Bai mit den Kamelen. Er eilt so schnell, wie er nur kann, vorwärts, damit die Kamele nicht zu tief in den Schlamm einsinken können. Das nützt ihm jedoch wenig. Gebrüll ertönt; ein Seil hat sich gespannt und ist gerissen, ein Kamel ist im Versinken begriffen. Alle Mann müssen ihm heraushelfen, nachdem ihm die Last abgenommen worden ist; dann schreitet der Zug weiter. Es ist ein Wunder, daß es gelingt, denn das Kamel sinkt bis an die Knie in den Schlamm ein, der jetzt so dünnflüssig ist, daß sich die Gruben sofort wieder schließen. Der Regen gießt herab, und die dämmerungsdunkeln Wolken lassen nirgends ein Aufhellen ahnen. Ein Maulesel bleibt in einem Sumpfloche stecken und kann nur mit Mühe gerettet werden. Von Menschen und Tieren rieselt und tropft das Wasser herunter, und alle atmen mühsam und schwer. Ein hoffnungsloses Land! Nicht genug damit, daß uns hier die Menschen den Zutritt verweigern, auch die Elemente und die Erde verschwören sich, um uns totzuquälen, bevor wir die erfrischenden Weidegründe und die belebende Ruhe erreicht haben, von denen wir nachts träumen! Wie würde es Tschernoffs elf schlechten Kamelen hier ergehen? Ich machte mich mit dem Gedanken vertraut, daß kein einziges von ihnen die beiden Pässe und den Morast, der mit jedem Regentage immer schlimmer wurde, überleben würde.
Endlich erreichten wir einen größeren Fluß. Woher er kam und wohin er strömte, konnten wir bei dem jetzt herrschenden, ungeheuer dichten Schneeregen nicht sehen. Was wir aber mit Befriedigung fühlten, war, daß sein Kiesboden wenigstens nicht nachgab und uns nicht, wie eben noch die Erde, zu verschlingen drohte. Alles war schon so durchnäßt, daß es nichts mehr machte, wenn wir auch noch in diesem Flusse plätscherten. Ein wenig weiter abwärts entdeckte ich auf dem rechten Ufer Gras und Schagdur einen großen Tonkrug. Der Lama war der Ansicht, daß seine Größe darauf schließen lasse, daß keine Nomaden in der Gegend wohnten, denn im anderen Falle würden sie sich nicht mit einem solchen Dinge geschleppt haben. Jäger, die auf ihren Gebirgswanderungen eines festen Lagerpunktes zum Ausruhen bedürfen, hätten den Krug hier ein für allemal zurückgelassen.
Wir waren eben mit dem Aufschlagen der Zelte fertig, als sich auch schon die nächste Regenbö einstellte. Arme Karawanentiere! Sie mußten die eiskalte Dusche über sich ergehen lassen.
[S. 164]
Von den zurückgelassenen Kamelen konnte nur eines noch das Lager erreichen. Das andere war unmittelbar unter dem Schlammpasse geblieben, wo Hamra Kul die Nacht bei ihm zubringen wollte. Das Kamel steckte dort buchstäblich im Schlamm, und alle Versuche, ihm herauszuhelfen, waren fruchtlos geblieben. Es hatte seine Kräfte in der Verzweiflung aufs äußerste angespannt, war aber nur immer tiefer in den Morast geraten, der es nun festhielt. Hamra Kul ließ mich hiervon durch einen Kameraden benachrichtigen und mich zugleich fragen, was er tun sollte. Ich schickte zwei Männer mit Proviant und etwas Feuerung zu ihm. Sie sollten alle drei die Nacht bei dem verunglückten Kamele zubringen; am Morgen, wenn die obere Schicht des Bodens ein wenig erstarrt war, so daß man wie auf Eis an das Kamel herangehen konnte, sollten sie versuchen, ob sie es nicht mit Hilfe von Spaten und Filzdecken herauszuziehen vermöchten. Alle übrigen Leute sollten ihnen zu Hilfe kommen, da wir auf jeden Fall einen Tag liegenzubleiben beabsichtigten. Li Loje hatte nämlich nur einen Kilometer weiter flußabwärts viel bessere Weide gefunden, wohin die Tiere schon am Abend geführt wurden.
Alle Versuche, dieses an und für sich gesunde, fehlerfreie Tier zu retten, mißlangen. Es sank während der Nacht immer tiefer ein und wurde, wie die Leute meldeten, am Morgen, halb in diesem heimtückischen, verfluchten Boden festgefroren, tot gefunden. Nur einmal war es mir bisher passiert, daß uns ein Kamel in einem Sumpfe erstickt war, sonst war es uns stets geglückt, die Tiere noch zu retten. Der Leser kann sich einen Begriff von den Schwierigkeiten machen, die mit der Reise durch ein Land verbunden sind, in welchem sich die Erde auftut, um die Karawanentiere zu verschlingen! Mit jedem Tage wunderte ich mich immer mehr, daß die Kamele sich unter diesen fürchterlichen Strapazen noch so gut hielten.
Während des Ruhetages im Lager Nr. 43 gingen Sirkin und Schagdur auf die Jagd. Nachher berichteten sie, daß sie in einer Entfernung von nur 3 — 4 Kilometer talabwärts Hügel gefunden, die mit vortrefflichem Grase, besserem, als wir je gehabt hätten, bewachsen seien. Turdu Bai hielt sich fast den ganzen Tag draußen bei den Kamelen auf; er hatte sich den Genuß, sie wieder zu sehen, nicht verkürzen wollen. Er erklärte, daß die Weide hier in der Gegend für einen vollen Monat ausreiche und nur ein längerer Aufenthalt die Karawane retten könne. In aller Eile beschloß ich, am folgenden Tage, 24. Juli, nach den Weideplätzen, welche die Kosaken entdeckt hatten, aufzubrechen und dort das große Hauptquartier anzulegen. Dort sollte das Lager befestigt, eine astronomische Ortsbestimmung ausgeführt und die letzte Hand an unsere mongolische Ausrüstung gelegt werden, und von dort wollten wir in der Richtung nach Lhasa aufbrechen.[S. 165] Es war hohe Zeit! Einige Muselmänner hatten auf ihren Streifzügen nach Brennmaterial einen Flintenschuß gehört. Wir hatten vielleicht Nachbarn in der Gegend, und jetzt hieß es aufpassen.
Anfangs war es meine Absicht gewesen, auf dem Ritte nach Süden die beiden burjatischen Kosaken und den Lama mitzunehmen. Da jedoch unsere Ankunft von den Yakjägern, auf die wir so unerwartet gestoßen waren, ganz gewiß schon erzählt worden, wagte ich nicht, nur einen Kosaken im Hauptquartier zurückzulassen. Wenn es auch nicht wahrscheinlich war, daß die Tibeter unseren Rückzugspunkt angreifen würden, so erforderte es doch die Klugheit, auf jede Möglichkeit vorbereitet zu sein. Es konnte noch lange dauern, bis Tschernoff mit den Trümmern der Nachhut anlangte. Daher beschloß ich, auch Tscherdon zurückzulassen, der mit seinem Magazingewehre zur Sicherheit des Lagers beitragen würde. Es tat mir sehr leid, ihm dies mitteilen zu müssen, und ich hatte es möglichst lange hinausgeschoben. Ich wußte, daß es für ihn eine sehr große Enttäuschung sein würde, denn die Wallfahrt nach Dscho (Lhasa) ist in der lamaistischen Welt ebenso verdienstvoll wie der Titel eines Hadschi, eines Mekkapilgers, bei den Muselmännern. Doch ich tröstete ihn damit, daß es wenig wahrscheinlich sei, daß es uns gelänge, die Wachsamkeit, mit der die Tibeter jetzt ohne Zweifel ihre Stadt hüteten, zu täuschen, und versprach ihm, daß er vor dem Ende dieser Reise ebenso wie die anderen Gelegenheit haben sollte, einen Tempel zu besuchen.
Ein Kosak zeigt übrigens nicht, was er empfindet oder denkt, er antwortet nur: „Wie der Herr befehlen!“; der Wille des Vorgesetzten ist für ihn Gesetz. Doch ich wußte nur zu gut, daß diese Wendung der Dinge den guten Tscherdon sehr betrübte.
Für uns drei Pilger wurde die Sachlage dadurch ebenfalls anders — unsere Truppe verkleinerte sich um ein Viertel. Das Unternehmen war jedoch in jedem Falle so gewagt, daß es keine Rolle spielte, ob wir drei waren oder vier.
Viele Fragen stürmten auf mich ein, als wir am 24. Juli aufbrachen. War es das letztemal, daß ich in Gesellschaft meiner Karawane marschierte? Würde ich sie wiedersehen und würde dann im Lager alles ruhig sein?
Es wurde ein kurzer Marsch, kaum drei Kilometer; das Tal fällt ziemlich rasch ab, und der Fluß bildet schäumende Stromschnellen. Er wird unaufhörlich überschritten. Auf den Uferhügeln wird die Weide immer besser, sie ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt, sondern bildet besonders da, wo die Abhänge der Südsonne ausgesetzt und vor den kalten Nordwinden geschützt liegen, kleine Rasenflecke von üppigem, saftigem Grase.
[S. 166]
Auf dem flachen Gipfel eines Hügels am linken Ufer des Flusses wurde der wichtige Lagerplatz in 5127 Meter Höhe ausgewählt, wo wir uns unter so eigentümlichen Verhältnissen trennen sollten. Die Weide war hier gut genug, aber vom strategischen Gesichtspunkte aus war die Lage unvorteilhaft. Die Aussicht wurde auf allen Seiten von Hügeln versperrt, die den Lagerplatz beherrschten, und wenn irgendein räuberischer Tangutenstamm auf den Gedanken verfiele, feindselig vorzugehen, würde sich hier ein Überfall mit größter Leichtigkeit ausführen lassen.
Während der beiden Tage, die ich noch im Lager Nr. 44 weilte, wurden die letzten Vorbereitungen zur Abreise getroffen. Die Tiere, die uns begleiten sollten, fünf Maulesel und vier Pferde, wurden mit besonderer Sorgfalt gepflegt und durften die letzten Reste des noch vorhandenen Maises verzehren. Ihre Hufe wurden neu beschlagen, ihre Sättel und Decken ausgebessert.
Alles Gepäck, das wir mitnehmen wollten, wurde in zwei mongolischen Kisten untergebracht. Von den Instrumenten waren es nur 3 Kompasse, 2 Uhren, 1 Aneroid, 2 Thermometer, 3 Paar Schneebrillen und die Veraskopkamera mit 8 Dutzend Platten. Ferner folgende absolut notwendige Dinge: das Blatt Lhasa der asiatischen Karte des russischen Generalstabs, Notiz- und Marschroutenbücher in Miniaturausgaben, sowie Tinte, Papier und Federn, Zirkel, Rasiermesser und Seife, denn jetzt galt es, daß der ganze Kopf stets frisch rasiert blieb; andere Waschutensilien waren nicht nötig, im Gegenteil war es wünschenswert, möglichst schmutzig zu werden, um dadurch eine echtere mongolische Farbe zu erhalten. Eine Schere, eine Laterne, ein Beil, ein Dutzend Stearinlichter und einige Schachteln Zündhölzer, einige Medikamente, 10 Jamben in Silber, Pfeifen und Tabak gehörten zum Unentbehrlichen. Der Proviant bestand aus Mehl, Reis, Talkan und Fleisch. Zehn Konservendosen wurden für die ersten Reisetage mitgenommen; jede geleerte Dose sollte in Seen oder Flüssen versenkt werden, um, falls man uns beobachtete, nicht Verdacht zu erregen. Die Bewaffnung bildete ein russisches Magazingewehr, ein Berdangewehr und ein schwedischer Offiziersrevolver nebst 50 Patronen für jede Waffe. Einige Kleinigkeiten, welche die Mongolen ständig bei sich tragen, fehlten uns auch nicht. Auch ich trug einen Rosenkranz, ein Gavo (Amulettfutteral) mit Götzenbild um den Hals, ein am Gürtel hängendes Messer in Scheide, chinesische Elfenbeinstäbchen zum Essen, einen ledernen Tabakbeutel, ein Feuerzeug mit Stein und Zunder und die lange Pfeife (Abb. 244). An Kleidern, Stiefeln und Mützen hatte jeder von uns eine doppelte Ausrüstung, denn wir hatten alle Aussicht, bald durchnäßt zu werden. Alles, was Gefäß hieß, wie Kochtöpfe, Kannen, Tassen, war echt mongolisch. Das[S. 167] kleinste und leichteste Zelt wurde unsere Wohnung. Für die Nachtwache nähte der Lama einen prächtigen Mantel aus dickem weißem Filz, der sich später als sehr praktisch erwies.
Alle diejenigen Sachen, die bei den Tibetern sofort Verdacht erregt hätten, wurden in der einen Kiste unter dem Proviant verborgen. Vieles davon konnte ohne Bedauern ins Wasser geworfen werden, falls unsere Lage kritisch wurde. Dagegen müßte es uns schon sehr schlecht gehen, ehe ich mich von den Instrumenten und den gemachten Aufzeichnungen trennen würde. Für Uhr, Aneroid, Kompaß und Thermometer hatte ich besondere Taschen im Futter, die so gut versteckt waren, daß nur ein sehr dreister Untersucher imstande sein würde, sie zu entdecken.
Als alles bereit und die astronomische Beobachtung ausgeführt war, wurde die Abreise auf den 27. Juli festgesetzt.
Am letzten Abend verschloß ich meine kostbaren Kisten, außer derjenigen, in der die Chronometer in ihren Futteralen in Watte eingebettet lagen. Sirkin hatte lernen müssen, sie mit größter Vorsicht aufzuziehen, um sie bis zu meiner Rückkehr in Gang zu halten. Ja, vorsichtig war er, ganz übertrieben vorsichtig! Schon am ersten Abend nach unserer Abreise blieb der eine Chronometer stehen, weil Sirkin nicht gewagt hatte, ihn ganz aufzuziehen, aus Furcht, die Feder könnte springen. Dasselbe passierte am Tage darauf mit dem zweiten Chronometer. Es schadete jedoch nicht viel, denn durch Wiederholung der Beobachtungen im Lager Nr. 44 erhielt ich die Zeit später wieder.
Wie gewöhnlich, sollte das meteorologische Observatorium die ganze Zeit über von Sirkin besorgt werden, der zu diesem Zweck einen eingefriedigten Schuppen baute, in dem die Instrumente geschützt standen.
In Gegenwart aller wurde Sirkin feierlich zum Führer und Chef des Hauptquartiers ernannt; seinen Befehlen sollte geradeso gehorcht werden, als ob ich sie selbst erteilt hätte. Doch stand Turdu Bai als Sachverständigem das Recht zu, Vorschläge zum Aufbruche nach einem Punkte in der Nachbarschaft zu machen, sobald das Land um das Lager herum nahezu abgeweidet war. Er hielt es für angemessen, den ersten kurzen Umzug nach etwa zehn Tagen vorzunehmen; sie hatten überreichlich Zeit, sich die allerbesten Weideplätze in der Gegend auszusuchen. Infolgedessen würde das Lager Nr. 44 keine bleibende Statt haben. Damit wir Pilger bei unserer Rückkehr die Unserigen wiederfinden könnten, sollte auf dem ursprünglichen Lagerplatze ein Dokument mit Auskunft über das neue Lager, seine Richtung und seine Entfernung von ersterem, niedergelegt werden. Zogen sie wieder um, so sollte ein neues Dokument deponiert werden.
[S. 168]
Ich redete mit jedem der Männer besonders und ermahnte sie, ihre Pflicht zu tun. Li Loje hatte jedoch seine eigenen Pläne. Nachdem er gebeten hatte, mich nach Lhasa begleiten zu dürfen, und dies ihm bestimmt abgeschlagen worden war, bat er, auf demselben Wege, den wir gekommen, über das Gebirge nach Tscharchlik zurückkehren zu dürfen, — 950 Kilometer! Mollah Schah und Hamra Kul wollten ihn begleiten. Da die Sache ein Stück aus dem Narrenhause war, erklärte ich ruhig, es stehe ihnen frei zu gehen, doch könnten wir unter den jetzigen Verhältnissen keine Pferde entbehren; nur Li Loje, der sein eigenes Pferd mitgebracht, könne also reiten. Proviant wolle ich ihnen geben, und Li Loje habe ja auch seine eigene Flinte.
Ich holte die von mir nach und nach zusammengestellte Übersichtskarte herbei und rief ihnen jeden Lagerplatz, auf dem wir seit Tscharchlik gerastet, ins Gedächtnis. Dann prophezeite ich ihnen, wie ihre verrückte Wanderung ablaufen würde. Zuerst würde Mollah Schah, der ein alter Mann sei, zusammenbrechen und zurückgelassen werden, denn er werde doch wohl nicht glauben, daß die beiden anderen einen Kranken auf dem Pferde mitschleppen würden. Dann werde die Reihe an Li Loje kommen, der nicht übertrieben kräftig sei. Hamra Kul würde freilich, sagte ich, da es das Leben gelte und er ein starker, kräftiger Mann sei, Tscharchlik erreichen können. Erreichen aber werde er es nie, denn er werde vorher im Arka-tag von Wölfen überfallen und zerrissen werden. Ich wünschte ihnen jedoch eine glückliche Reise und sagte, ich wollte hoffen, daß Allah seine schützende Hand über ihnen halte.
Sei es, daß diese Schilderung tiefen Eindruck auf sie machte oder daß sie von selbst wieder zur Vernunft kamen, genug, abends erschienen sie als Büßer in meinem Zelte, fielen vor mir auf die Knie und flehten mich an, sie um Gotteswillen hierzubehalten, was ihnen auch in Gnade bewilligt wurde. Ich bin mir nie darüber klar geworden, was für ein böser Geist eigentlich in sie gefahren war, und ich war zu sehr mit meinem eigenen gewagten Plane beschäftigt, um zu versuchen, den Grund zu erforschen. Sie selbst versicherten, die Veranlassung sei nur Heimweh und nicht Furcht vor den Tibetern gewesen, aber Sirkin hatte am selben Tage in einem hinter dem Lager befindlichen Tale die frischen Spuren eines Mannes gesehen, der teils gegangen, teils geritten war, und die Hunde hatten die letzten Nächte wütend gebellt. Es wurde schon im Lager geflüstert, daß wir von Tibetern beobachtet und bewacht würden. Ich glaubte indessen nicht daran, denn Kulane zeigten sich oft bald auf dem einen, bald auf dem anderen Hügel, und die beobachteten Spuren konnten recht gut von ihnen herrühren. Etwa zwanzig Raben kreisten wie schwarze Furien[S. 169] über dem Lager. Unter den ernsten Verhältnissen, in denen wir jetzt lebten, erschienen sie uns abscheulicher als sonst.



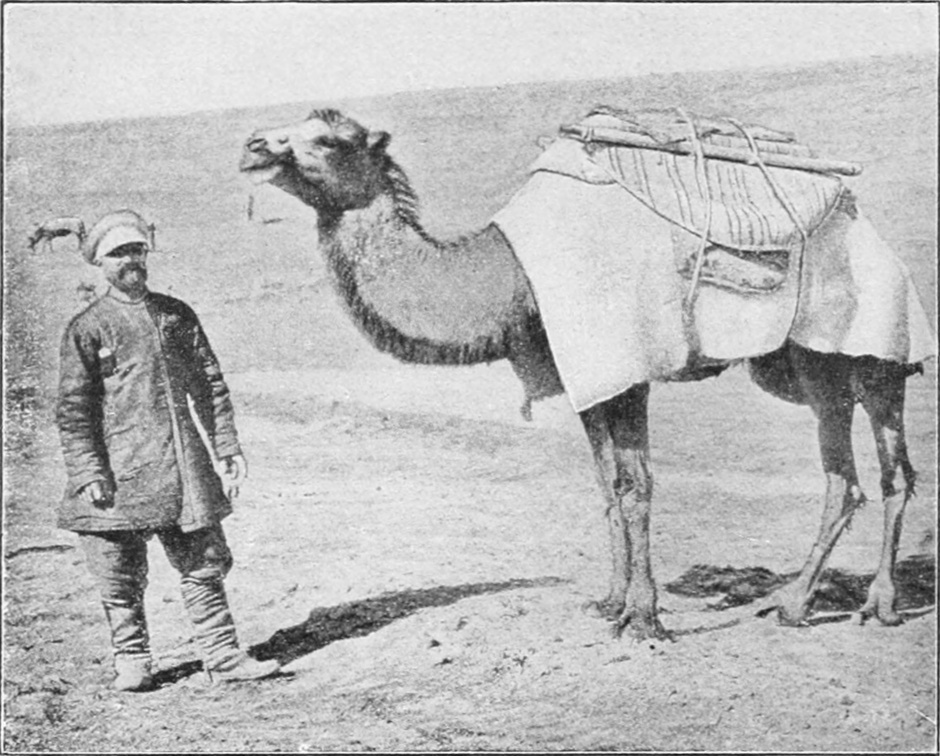

Schließlich sprach ich mit Sirkin allein und erklärte ihm die ganze Tragweite des Wagnisses, in das wir uns stürzten. Er hörte schweigend zu, schüttelte aber langsam den Kopf.
„Wenn wir in dritthalb Monaten nicht wieder hier sind“, sagte ich, „so müßt ihr aufbrechen und nordwärts nach Tscharchlik ziehen, von dort aber nach Kaschgar zurückkehren.“
Ich glaubte allerdings nicht, daß man uns totschlagen würde, aber jedenfalls mußte ich mich auf alle Möglichkeiten vorbereiten und solche Anstalten treffen, daß meine Karten und Aufzeichnungen um jeden Preis gerettet würden. Sirkin erhielt den Schlüssel zur Silberkiste, damit er in Tscharchlik eine neue Karawane ausrüsten konnte. Er bekam die Übersichtskarte über den von uns zurückgelegten Weg, und im übrigen würde ihr Ortssinn die Leute nicht im Stiche lassen; sie würden sich ohne Schwierigkeit zurückfinden. Es war freilich wenig wahrscheinlich, daß ein einziges Kamel noch eine solche Reise überleben würde, aber einige der Pferde sollten sie doch wohl aushalten können, und Sirkin wußte, welche Kisten um jeden Preis gerettet werden mußten. Wie lange sie auch im Lager Nr. 44 bleiben würden, stets sollte Tag und Nacht strenge Wache gehalten werden. Besonders da, wo die Tiere weideten, sollten sich stets einige bewaffnete Leute mit ein paar Hunden befinden.
Dann ging ich zum letztenmal unter „zivilisierten“ Verhältnissen zu Bett, schlief sofort ein und erwachte nicht eher, als bis Schagdur kam, um mich zu dem verhängnisvollen Aufbruch zu wecken.
[S. 170]
Eiligst kleidete ich mich in den mongolischen Anzug und wurde vom Scheitel bis zur Sohle ein Mongole (Abb. 245). Die während des Rittes zu gebrauchenden Instrumente, sowie Tabak und Fernglas wurden in ihren Verstecken untergebracht. Schon vom ersten Augenblick an fühlte ich mich in meinem mongolischen Rocke sehr gemütlich; er saß weich und gut, und das einzige, was ich entbehrte, waren die vielen Taschen, die ich in meinem Ulster hatte. Der Kompaß und das Marschroutenbuch wurden einfach vorn in den Rock gesteckt und von der gelben Leibbinde festgehalten. Auf dem Kopfe trug ich eine gelbe Mütze mit aufgekrempeltem Vorderrand. Die dicken, plumpen Mongolenstiefeln, mit denen ich schon lange gegangen war, damit sie genügend getragen und abgenutzt aussähen, paßten mir vortrefflich und waren infolge ihrer dicken Sohlen und aufwärtsgekehrten Spitzen auf feuchtem Terrain außerordentlich praktisch. Der Rock selbst hatte eine tiefdunkelrote Farbe. Der gelbe Pelz war heute morgen nicht nötig, da die Sonne sehr freundlich schien und Fliegen und Schmetterlinge die Luft erfüllten.
Ich sollte meinen Schimmel reiten, der jetzt schon lange wiederhergestellt war, und war gerade dabei, meinen weichen, bequemen Mongolensattel zurechtzurücken, als Sirkin von hinten kam und mich auf Mongolisch anredete. Er stockte jedoch sofort in seiner Rede und war ganz verdutzt, als er sah, daß ich es war; er hatte geglaubt, es sei der Lama. Ich fühlte mich durch diesen Irrtum außerordentlich geschmeichelt; meine Verkleidung konnte also entschieden für genügend gelten.
Jetzt wurden alle Hunde angebunden, außer Malenki und Jollbars, die uns freiwillig folgten. Unsere kleine Karawane wurde beladen, wir stiegen zu Pferd und ritten ab. Der Abschied rief viele Tränen hervor; Sirkin wandte sich ab, um seine Rührung zu verbergen, Hamra Kul aber weinte laut wie ein Kind und begleitete uns noch etwas zu Fuß, mit seinen großen Stiefeln ganz unbekümmert durch den Fluß watend.
[S. 171]
Das Lager Nr. 44 verschwand hinter den Hügeln, und wir trabten schnell talabwärts. Würden wir diesen friedlichen Ort je wiedersehen? Ich zweifelte nicht an der mächtigen Hand, die bisher stets meine Schritte, durch Wüsten und über Berge, gelenkt hatte. Schagdur schwelgte förmlich in dem Gedanken an das beginnende Abenteuer. Der Lama war ruhig wie ein Stoiker, und als ich ihn der am Kum-köll getroffenen Verabredung gemäß fragte, ob er im Lager zu bleiben wünsche, wollte er nichts davon hören; jetzt wolle er mich nicht verlassen, sondern mit mir ziehen, wenn es ihm auch das Leben kosten sollte.
Schagdur ritt einen Falben, der Lama den kleinen, dreisten Maulesel, der im vorigen Jahr, bei dem See, wo die Leute die beiden Denkmale errichteten, beinahe verlorengegangen wäre. Meine beiden Reisegefährten führten die Lasttiere, und Ordek, der eines der Pferde ritt, hatte ein Auge auf die Lasten. Er sollte uns die beiden ersten Tagereisen begleiten, um nachts die Tiere zu bewachen. Noch drei Nächte würden wir drei Pilger also ordentlich ausschlafen können, ehe die Aufgabe, unsere Tragtiere zu bewachen, uns selbst zufiel.
Ein paar Stunden weit begleiteten uns Turdu Bai und Tscherdon. Dann kehrten auch sie nach einem letzten Lebewohl um. —
Das Flußtal ist eng und zwischen steilen Hügeln eingeschlossen. Den Fluß überschritten wir schon zu Anfang neunmal. Die ganze Landschaft leuchtet rot, denn hier haben wir roten Sandstein, der derartig verwittert ist, daß man ihn selten als anstehendes Gestein antrifft. Grus und Blöcke sind dafür um so häufiger.
Am rechten Ufer, wo eine gute Furt durch zwei kleine Steinmale bezeichnet war, sah man Spuren eines Jägerlagers. Drei rußige Steine bildeten eine Unterlage für einen Kochtopf. Auch ein noch nicht lange erlegter, aber jetzt ganz zusammengetrockneter Yak legte von menschlichen Besuchen Zeugnis ab. Ein Bär war gestern oder heute hier gewesen und hatte den Kadaver umgedreht.
Nachdem wir den Fluß noch ein paarmal gekreuzt haben, mündet unser Tal in weites, offenes, nur in der Ferne von Bergen begrenztes Terrain aus. Der Fluß durchzieht diese Ebene nach Nordosten, während wir den Weg nach Südosten einschlagen. Im Norden steht die vor kurzem überschrittene, so schwer zugängliche Bergkette mit zwei Pässen.
An Wild sahen wir zahlreiche Kulane, Hasen und Murmeltiere, sowie einen Wolf; später machten die Hunde noch einen Rundtanz mit einem alten Yak, den sie aufgespürt hatten. An einem offenen Quellbecken (Namaga), wo das Gras üppig stand, schlugen wir Lager, denn einer der Maulesel begann bedenklich zu hinken. Ich zündete Feuer an, indes die[S. 172] Männer die gröberen Arbeiten besorgten; Pferde und Maulesel wurden mit einem Stricke zwischen Vorder- und Hinterbein geknebelt, was sie verhindern sollte, sich allzuweit zu entfernen.
Darauf wurde das einfache Mahl von gebratenem Fleisch, Reis, Brot und Tee zubereitet; beim Essen bedienten wir uns der Hände, der chinesischen Stäbchen und einer kleinen mongolischen Holztasse — Luxusartikel, wie Gabeln und Löffel, enthielten unsere Kisten nicht. Nur der Lama hatte keinen Appetit; er litt an heftigen Kopfschmerzen und befand sich wirklich schlecht. Es wäre doch hart, wenn er jetzt, da wir ihn so weit gebracht hatten, nicht imstande sein würde, die Reise mitzumachen; es stand aber zu befürchten, daß er mit Ördek würde umkehren müssen.
Ich lag noch eine Weile auf der Erde und ließ mich von der Abendsonne bescheinen, doch um 8 Uhr gingen wir zur Ruhe, weil wir nichts weiter zu tun hatten. Ördek hütete die Tiere, aber die drei Pilger schliefen zum ersten Male brüderlich zusammen in ihrem Wallfahrtszelte. Der Mond schien über der stillen Gegend; es war ein Segen, daß wir während dieser Nächte sein Licht hatten.
In diesem Lager wurde beschlossen, daß Ördek uns noch einen Tag begleiten sollte, denn dem Lama ging es sehr schlecht; er schwankte im Sattel und mußte oft absteigen, um eine Weile auf der Erde zu liegen.
Das Terrain ist in dieser Gegend vorzüglich, und wir legten auf dem festen Boden mit größter Leichtigkeit beinahe 40 Kilometer zurück. Die Hügel und Täler, die wir hierbei passieren, sind arm an Gras, aber desto reicher an Kulanen und Yaken, die bei verschiedenen Gelegenheiten zu Hunderten auftraten. Sie nehmen aber auch mit Moosen und Kräutern vorlieb, die unsere zahmen Tiere nicht fressen würden. Spuren von Menschen fehlen noch. Von Zeit zu Zeit reitet einer von uns auf den nächsten beherrschenden Hügel hinauf, um Umschau zu halten. Jetzt würden wir freilich, wenn wir Reiter oder ein Nomadenlager sähen, als ehrliche Pilger direkt dorthin reiten, aber wir mußten doch Ördek Gelegenheit geben, vorher unbemerkt zu verschwinden und nach dem Lager Nr. 44 zurückzureiten.
Die Richtung ist Ostsüdost. Im Osten erhebt sich ein gewaltiges Schneemassiv, und diesseits desselben liegt ein See von reinblauer Farbe. Am Seeufer, längs dessen wir nach Südosten hatten ziehen wollen, stiegen senkrechte, wie immer ziegelrote Sandsteinfelsen, das gewöhnliche Kennzeichen der tibetischen Landschaft, unmittelbar aus dem Wasser empor. Sie zwangen uns zu einem verdrießlichen Umwege nach Südwesten über beschwerliche Hügel, hinter denen wir wieder ans Ufer gelangen und an ihm auf viel bequemerem Terrain weiterziehen konnten. Konzentrisch längs des Ufers[S. 173] geordnete Absätze und Wälle lassen auf den ersten Blick erkennen, daß dieser Salzsee im Austrocknen begriffen ist.
Allzuweit konnten wir nicht reiten, um unsere schon angegriffenen Tiere nicht zu ermüden, und es wurde Zeit, ans Lagerschlagen zu denken. Trinkwasser schien es in der Nähe dieses Salzsees nicht zu geben. Wir folgten einem Kulanpfade zwischen zwei Uferwällen in der Hoffnung, daß er uns zu einer Quelle führen würde.
Im Süden des größeren Sees schimmerte jetzt der Spiegel eines kleineren Gewässers, das merkwürdigerweise süß war, obgleich seine Ufer ebenso flach und kahl aussahen. Obschon es hier sowohl mit der Weide wie mit der Feuerung schlecht bestellt war, wählten wir hier doch einen Platz für das zweite Nachtlager aus.
Der Lama fühlte sich besser, und die Stimmung war sehr gut. Wir saßen plaudernd um das Feuer und entwarfen unsere Pläne für die Weiterreise nach der heiligen Stadt. Ich berechnete die Marschroute des Tages und teilte den anderen mit, wie lang unser Weg noch sei. Der Lama erzählte von der Strenge, mit der die Tibeter in Nakktschu alle Pilger, die aus der Mongolei kommen, untersuchen. Wir hielten es daher für das Klügste, diesen Ort zu vermeiden und uns auf gebahnten oder ungebahnten Wegen nach dem Ostende des Tengri-nor zu begeben, um von dort nach dem Passe Lani-la zu gehen. Wir würden auf diese Weise die großen Pilgerstraßen zwischen Nakktschu und Lhasa erreichen und unter den übrigen Pilgern verschwinden.
Darauf folgte eine komische Szene. Mein Kopf sollte rasiert werden. Ich setzte mich neben dem Feuer auf die Erde, und Schagdur hauste mit der Schere wie ein Vandale in meinen Haaren. Nachdem ich auf diese Weise geschoren war, wurde mein Kopf eingeseift. Ördek kam mit dem Rasiermesser, und nach einer Weile glänzte mein Schädel wie eine Billardkugel. Schagdur und der Lama schauten zu und fanden die Situation höchst interessant. Schließlich nahm ich selbst den Schnurrbart vor, der ebenfalls ohne Erbarmen entfernt wurde, obgleich ich es eigentlich für jammerschade hielt, mein sonst ganz vorteilhaftes Aussehen auf solche Weise zu verschimpfieren. Ich tröstete mich damit, daß ich die Brauen und Wimpern behalten durfte.
Nachdem die Verwüstung so über mein Haupt hingegangen war, sah ich gräßlich aus. Doch hier war ja niemand, mit dem ich zu kokettieren brauchte, und es war schließlich einerlei, wie man in diesen ebenso glattrasierten Gebirgsgegenden aussah.
Meine Behandlung war jedoch noch nicht fertig. Wie ein alter, geübter Quacksalber begann der Lama mit sachverständiger Miene unter[S. 174] seinen Papieren, Beuteln und Medikamenten umherzusuchen und schmierte mir dann das Gesicht mit Fett, Ruß und brauner Farbe ein. Bald war das Werk getan, und nun glänzte ich wie eine Kanonenkugel in der Sonne. Ein kleiner Handspiegel überzeugte mich, daß ich wirklich schön echt aussah. Mir konnte vor mir selbst Angst werden, und ich mußte eine gute Weile in das Glas starren, ehe ich völlig davon überzeugt war, daß dieser mongolische Pavian wirklich mit meiner eigenen Person identisch war. Als die Salbe trocken war, nahm meine Haut eine mehr grauschmutzige Schattierung an.
Unser Lagerplatz lag offen auf der schmalen Landenge zwischen den beiden Seen; nur im Südwesten erhoben sich einige niedrige Hügel. Die Gegend konnte für vollkommen sicher gelten, denn weder alte noch frische Menschenspuren waren irgendwo zu sehen, und die Hunde verhielten sich ruhig. Gegen 5 Uhr erhob sich ein Nordsturm, der Wolken von Sand und Staub über den Salzsee und unser Lager jagte. Wir nahmen unsere Zuflucht zu der Jurte, und bereits um 8 Uhr fanden wir, daß es Schlafenszeit sei, und krochen auf dem Filzteppiche des Zeltes in unsere Pelze. Ördek bewachte die Pferde und Maulesel ungefähr 200 Schritte vom Lager entfernt. Er sollte die ganze Nacht wachbleiben, damit wir noch einmal gründlich ausschlafen könnten; am Morgen sollte er dann auf einem der vier Pferde nach dem Lager Nr. 44 zurückreiten.
Um Mitternacht wurde das Zelttuch auseinandergeschlagen. Ördek steckte den Kopf herein und flüsterte mit angsterfüllter Stimme: „Bir adam kelldi“ — ein Mann ist gekommen! Seine Worte wirkten wie ein Donnerschlag. Alle drei stürmten wir mit den Flinten und dem Revolver in die Nacht hinaus (Abb. 246). Der Sturm tobte noch immer, und der Mond schien bleich durch zerrissene, schnell hinjagende Wolken. Ördek zeigte uns den Weg und berichtete, daß er zwischen den am entferntesten weidenden Pferden eine dunkle Gestalt habe umherhuschen sehen. Dies hatte ihn so erschreckt, daß er nach dem Zelte gelaufen war, anstatt Alarm zu schlagen.
Die Folge davon war natürlich, daß wir zu spät kamen. In dem matten Lichte des verschleierten Mondes sahen wir gerade noch, wie einige dunkle berittene Gestalten davonsprengten und zwei Pferde vor sich herjagten. Einen Augenblick darauf verschwanden sie hinter den Hügeln. Eine ihnen von Schagdur nachgeschickte Kugel richtete keinen Schaden an. Er, der Lama und Ördek verfolgten die Spur, während ich im Lager blieb, das vielleicht von einer ganzen Bande umringt war. Nach einer Stunde kehrten sie zurück, ohne etwas Weiteres gehört oder gesehen zu haben.
Jetzt berieten wir uns sofort über die Sachlage. Zunächst zählten wir unsere Tiere; alle Maulesel und die beiden schlechtesten Pferde waren[S. 175] noch da und weideten in größter Ruhe. Aber die beiden besten Pferde, mein lieber Schimmel und Schagdurs Falbe, waren fort. Aus den Spuren ergab sich, daß die Räuber drei berittene Männer gewesen waren, die sich, direkt gegen den Wind, an das Lager herangeschlichen hatten. Sie waren zu Fuß gegangen und hatten ihre Pferde in einer gut versteckten Bodensenkung geführt, in der zuzeiten Wasser nach dem großen See strömt. Von dort war einer der Männer allein auf allen vieren weiter gekrochen, bis er sich ganz in der Nähe der hintersten Pferde befand. Er hatte sie durch sein Aufspringen scheu gemacht und nach dem Ufer hinabgejagt, wo ihm die beiden anderen Männer mit den tibetischen Pferden entgegengekommen waren. Alle waren im Handumdrehen aufgesessen und dann über die Hügel gejagt, bei denen sie schon angekommen waren, als wir, noch ganz schlaftrunken, aus dem Zelte stürzten.
Ich glaube nicht, daß ich mich in meinem ganzen Leben je so geärgert habe wie diesmal. Sich seine Pferde vor der Nase der Nachtwache fortstehlen zu lassen, wenn man obendrein noch zwei große, bissige Hunde hat! In der ersten Wut wollte ich die ganze Reise nach Lhasa bis auf weiteres aufschieben und die Diebe ihren Streich teuer bezahlen lassen. Ich wollte sie wochenlang verfolgen, bis wir sie in Sicht hätten, und sie dann ebenso überfallen. Den einfältigen Ördek, der früher stets so tüchtig gewesen war, auszuzanken, vergaß ich dabei vollständig. Aber sein Mut beschränkte sich auf die Wüsten und andere unbewohnte Gegenden, und er mochte gewissermaßen recht darin haben, daß Menschen von allem, womit man zu tun haben kann, das Schlimmste sind, viel schlimmer als Tiger und Sandstürme.
Nach und nach bekämpfte ich meinen Verdruß und erwog mit wiedergewonnener Ruhe unsere Lage. Wir folgten der Spur noch einmal bis auf die Höhen der Hügel, wo sie im harten Gruse verschwand. Schagdur wollte sich durchaus auf die Verfolgung machen, das Magazingewehr brannte ihm in den Händen. Er wollte sein Pferd, das er die ganze Zeit wie sein Kind gepflegt hatte, unter keiner Bedingung einbüßen. Doch auch er beruhigte sich, als ich ihn daran erinnerte, daß diese Männer, waren sie nun gewerbsmäßige Räuber oder nur Yakjäger, die sich die Gelegenheit nicht hätten entschlüpfen lassen wollen, ganz gewiß nicht vor dem nächsten Abend Halt machen würden. Wir hatten gar keine Aussicht, sie mit unseren müden Tieren einzuholen; sie hatten unsere besten Pferde, die ledig liefen, genommen, und ihre eigenen waren ganz gewiß kräftig und an die Bergluft gewöhnt.
Ferner kannten sie das Terrain, wir aber nicht. Sie konnten den Flußlauf und Schuttbetten, wo sich keine Spur verfolgen ließ, benutzen und uns auf diese Weise leicht irreführen.
[S. 176]
Und schließlich, wenn zwei von uns die Verfolgung aufnahmen und zwei zurückblieben, so zersplitterte sich unsere kleine, an und für sich zu schwache Truppe, und die Klugheit verbot uns entschieden, einen so abenteuerlichen Plan auszuführen. Wir mußten froh sein, daß die Diebe sich mit zwei von unseren Tieren begnügt hatten, und ich tröstete Schagdur mit der Bemerkung, daß ich, wenn ich einer der Tibeter gewesen wäre, alle unsere Tiere gestohlen hätte, um uns jegliche Verfolgung ganz unmöglich zu machen.
Wir hatten eine nützliche Lehre und eine Warnung bekommen! Aus dem Scherz war auf einmal Ernst geworden; hier galt es mehr als je die Augen offenzuhalten! Mitten zwischen diesen öden, stillen Bergen war eine Räuberbande, wie Gespenster in der Nacht, aus dem Schutze der Erde aufgetaucht; nicht einmal die Hunde hatten etwas gemerkt. Mit den Yakjägern vom Lager Nr. 38 hatten die Diebe vermutlich nichts gemein, dagegen ist es wahrscheinlich, daß die von Sirkin in unserem Tale gesehene Spur und der von den Muselmännern gehörte Schuß auf irgendeine Weise mit unseren nächtlichen Gästen in Zusammenhang standen. Sie hatten uns gewiß keinen Augenblick aus den Augen verloren, sie hatten sich vor der großen Karawane nicht sehen lassen wollen und hatten in irgendeinem versteckten Tale gelagert, aber stets auf eine Gelegenheit zum Überfall gelauert, die sich ihnen früher oder später darbieten mußte. Sodann hatten sie unsere kleine Pilgerschar beobachtet, waren uns von fern, durch Hügel verdeckt, gefolgt, hatten uns wie Wölfe umlauert und waren jetzt vom Sturm unterstützt worden.
Sicher war diese Erfahrung für uns nützlich. Mit einem Schlag waren wir uns über unsere Lage klar und erkannten, daß wir künftig auf dem Kriegsfuß leben und jeden Augenblick auf einen Überfall gefaßt sein mußten.
Ein kleines Feuer wurde vor dem Zelte angezündet; dort ließen wir uns nieder. An Schlaf war diese Nacht nicht mehr zu denken. Die Pfeifen wurden hervorgeholt, wir hüllten uns in unsere Pelze und plauderten, während der Mond von Zeit zu Zeit zwischen unheildrohenden Wolken hervorguckte. Dann wurde Tee gekocht, der nebst Reis und Brot unser Frühstück bildete. Beim ersten Tagesgrauen erhoben wir uns und rüsteten uns zum Aufbruch. Ich nahm den zweiten großen Schimmel, Schagdur Ördeks Pferd; der Lama hatte seinen Maulesel behalten.
Als die Sonne aufging, saß der arme Ördek weinend am Feuer. Er war ganz außer sich vor Angst, jetzt allein und unbewaffnet die 70 Kilometer nach dem Lager Nr. 44 zu Fuß zurücklegen zu müssen. Er bat und flehte, uns begleiten zu dürfen, und versprach, ein andermal besser aufzupassen; als ich aber unbeweglich blieb, bat er um den Revolver. Doch[S. 177] das nächtliche Abenteuer hatte uns gelehrt, daß es nicht ratsam war, in diesem Land ohne Waffen zu reisen.





In aller Eile schrieb ich auf ein ausgerissenes Tagebuchblatt einen Brief an Sirkin. Ich beschrieb kurz, was geschehen war, und ermahnte ihn, auf seiner Hut zu sein. Räuber streiften in der Gegend umher, und da sie offenbar mit unseren Verhältnissen völlig vertraut seien, müsse Tag und Nacht die strengste Wachsamkeit beobachtet werden. Vor allem hätten die im Lager Zurückgebliebenen darauf zu achten, daß nicht noch mehr Karawanentiere gestohlen würden. Ferner befahl ich ihm, die Diebe durch Tscherdon, Li Loje und noch einen Mann verfolgen zu lassen; mehr als eine Woche dürfe aber diesem Versuche nicht geopfert werden. Alle weitere Auskunft werde Ördek erteilen, der auch die Stelle kenne, von welcher die Spur ausgehe.
Von der durchwachten Nacht schmerzten mir die Augen, als die Sonne aufging. Ördek steckte den Brief in den Gürtel und erhielt noch eine Schachtel Zündhölzer, damit er sich bei seinem Nachtlager Feuer anzünden konnte. Als wir uns trennten, sah er aus wie ein zum Tode Verurteilter, der zum Richtplatze geht. Kaum aber waren wir zu Pferd gestiegen, so sahen wir ihn halb laufend längs des Ufers verschwinden. Er glaubte natürlich, es werde den ganzen Tag Räuber regnen und jeden Augenblick könne eine Flintenkugel durch die Luft pfeifen. —
Später, als alle unsere Sorgen um Lhasa glücklich überstanden waren, erzählte er selbst, wie sein Rückzug abgelaufen war. Am 29. Juli hatte er den ganzen Tag nicht eine Minute Halt gemacht. Er hatte es nicht gewagt, auf freiem Felde unseren Spuren nachzugehen, sondern sich wie eine wilde Katze in trockenen Bachbetten und Rinnen, sie mochten gerade oder krumm sein, weitergeschlichen. Den ganzen Tag über hatte er sich nach der Dämmerung und der Dunkelheit gesehnt. Doch als diese eingetreten war und der Regen schnurgerade herniederströmte, erschreckte ihn auch das nächtliche Dunkel, und er glaubte, überall Räuber zu sehen. Ein paarmal hatten ihn friedliche Kulane beinahe um den Verstand gebracht und ihn veranlaßt, sich wie ein Igel zusammenzurollen.
Endlich erreichte er in pechfinsterer Nacht den Eingang unseres Tales und beschleunigte seine Schritte noch mehr. Der Fluß rauschte laut in seinem Bette und übertönte jeden anderen Laut. Unaufhörlich glaubte Ördek jemand hinter sich herschleichen zu hören. Jeder Stein war ein lauernder Schurke, der nach seinem Herzen zielte. Wie er im Regen und in der Dunkelheit über die steilen Hügel gekommen war, wußte er selbst nicht; er war nur immer vorwärtsgeeilt, gestolpert, gefallen, wiederaufgestanden und unzähligemal durch den Fluß, dessen Wasser ihm bis zu den Hüften ging, gewatet.
[S. 178]
Als er schließlich das Lager erreichte, wäre er von der Wache, die Lärm schlug, beinahe erschossen worden. Er hatte den Mann jedoch noch rechtzeitig angerufen, wurde erkannt und von seinen erstaunten Kameraden sogleich mit Fragen bestürmt. Eine gute Weile konnte er nicht antworten. Vor Müdigkeit erschöpft, brach er nach Atem ringend zusammen. Den Brotfladen, den er als Proviant mitbekommen, hatte er nicht angerührt, und sein Appetit kam erst wieder, nachdem er den ganzen nächsten Tag geschlafen hatte.
Ördeks Bericht und mein Brief erschreckten natürlich die Daheimgebliebenen, die das Schlimmste befürchteten, da es schon die zweite Nacht war, daß unser Lager einem Attentate ausgesetzt gewesen war. Indessen hatte die Nachricht das Gute, die Wachsamkeit aufs äußerste zu schärfen, und hätten sich ungebetene Gäste dort in der Nähe sehen lassen, so wären sie mit scharfen Patronen empfangen worden.
Gleich am Morgen rüstete sich Tscherdon, um unsere Diebe zu verfolgen. Er nahm Turdu Bai und Li Loje mit; Ördek konnte nicht mitgehen. Trotz des Regens war unsere Spur auf dem ganzen Wege deutlich erkennbar gewesen, und auch die Spur der Diebe wurde gefunden. Sie hatten am Morgen in einer Entfernung von 30–40 Kilometer vom Salzsee gerastet und waren dort von mehreren der Ihren mit 15 Yaken erwartet worden. Dann hatten sie den Ritt eine so lange Strecke auf Grus und im Wasser fortgesetzt, daß die Spur völlig verschwand und nicht wiederzufinden war. —
Doch kehren wir zu unserer Pilgerfahrt zurück. Nachdem wir von Ördek Abschied genommen hatten, zogen wir nach Südosten und Ostsüdosten und legten auch an diesem Tage beinahe 40 Kilometer zurück (Abb. 247). Die Maulesel hätten noch weitermarschieren können, aber wir mußten die Pferde schonen. Zwischen dem Lagertümpel und einem anderen Gewässer, an dessen Ufern wir ziemlich frische Spuren von Schafherden sahen, zogen wir ein breites, grasreiches Tal hinauf. Rechts von unserem Wege ließen wir eine kleine hügelige Paßschwelle liegen, deren Ecke von ein paar Hundert Yaken rabenschwarz erschien. Wir musterten sie mit dem Fernglase und erwarteten ihren Wächter zu sehen, denn die Tiere machten keine Miene zu entfliehen. Vielleicht waren sie zahm. Doch als wir uns der Herde näherten, ergriff sie die Flucht, und Menschen zeigten sich nicht. Demnach konnten wir darauf rechnen, noch ein paar Tage lang keine Nomaden zu treffen, denn die wilden Yake halten sich nicht in der Nähe menschlicher Wohnungen auf.
In offenem Terrain mit freier Aussicht nach allen Seiten schlugen wir das Lager an einem kleinen Bache auf, an dem es gutes Gras und[S. 179] Yakdung zum Feuern in Fülle gab. Jetzt waren wir nur noch drei, und ich mußte beim Abladen, Zeltaufschlagen und allerlei gröberen Arbeiten helfen, was ich sonst nie nötig gehabt hatte, außer im Jahre 1886, als ich zweimal fast allein durch Persien gereist war.
Während Schagdur und der Lama die Tiere besorgten und sie auf der besten in der Gegend aufzufindenden Weide zur Hälfte, d. h. mit einem Stricke zwischen dem rechten Vorder- und dem linken Hinterbeine, fesselten, sammelte ich in meinem weiten Mantel trockenen Yakdung, welche Beschäftigung mir höchst interessant erschien. Die beiden anderen Pilger sprachen ihre Verwunderung darüber aus, daß es mir gelungen war, in kurzer Zeit einen so ansehnlichen Haufen zusammenzubringen.
Jetzt hieß es nicht mehr „Eure Exzellenz“, denn ich hatte Schagdur und dem Lama strengstens verboten, mir die geringste Spur von Ehrerbietung zu erweisen. Sie sollten mich im Gegenteil wie einen Stallknecht behandeln. Schagdur sollte als der Vornehmste von uns angesehen werden und hatte auf den Lagerplätzen seine Befehle zu erteilen. Ebenso streng war es verboten, russisch zu sprechen; von nun an durfte nur noch Mongolisch über unsere Lippen kommen. Schagdur spielte seine Rolle ausgezeichnet, und dasselbe dürfte ich auch von mir sagen können. Anfangs wurde es meinem Kosaken schwer, mich zu kommandieren, nach ein paar Tagen ging es aber ausgezeichnet!
Der Lama brauchte nicht als Schauspieler aufzutreten; er war, der er war, und so sollte es sein. Am schlimmsten war es für mich, der ich in zwei Rollen zugleich auftreten mußte, als Mongole und als Handlanger. Nachdem ich jedoch mit dem Dungsammeln zur Zufriedenheit meiner Herren fertig geworden war, aß ich zu Mittag, trank Tee, rauchte eine Pfeife, ging ins Zelt, legte mich nieder und schlief wie ein Stock bis 8 Uhr. Ich war da allein, die anderen trieben die Tiere zur Nacht ein. Noch eine Stunde durften diese in unserer unmittelbaren Nachbarschaft grasen. Schagdur und der Lama waren an diesem Abend weniger heiter als sonst. Sie hatten, während ich schlief, drei Tibeter zu Pferde gesehen, die von einem Passe im Osten kamen und nach Nordwesten ritten, wobei sie unserem Lager die Flanke zukehrten, so daß man nur ein paarmal hatte sehen können, daß es ihrer drei waren. An einem Punkte hatten sie gehalten, wie um sich zu beraten, worauf sie sich dem Lager genähert hatten, dann aber waren sie hinter einem Hügel verschwunden, um sich nicht wieder zu zeigen. Sie erwarteten wohl die Nacht, und ihr Benehmen kam uns höchst verdächtig vor. Es war uns jetzt klar, daß wir von Spionen und reitenden Späherpatrouillen umgeben waren; ob uns diese Reiter aus eigenem Antrieb oder auf Befehl beobachteten, konnten wir natürlich nicht wissen.
[S. 180]
Um 8½ Uhr wurden die Tiere an ein längs der Erde zwischen zwei Pflöcken straffgespanntes Seil gebunden, und jetzt und in Zukunft folgender Lagerplan beobachtet. Der eine Eingang des prismatischen Zeltes war vom Winde abgekehrt und stand weit offen; unmittelbar davor waren die Tiere angebunden. Nächtliche Besuche kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach gegen den Wind, besonders da, wo sie Hunde vorfinden.
Sobald es dunkelte, ließen wir das Feuer ausgehen und trugen die draußen noch umherliegenden Sachen, wie Kisten, Küchengeräte und Sättel, in das Zelt. Der große, schwarze Jollbars wurde vor den Pferden und Mauleseln angebunden. Von ihm konnte man das erste Warnungssignal erwarten. Malenki, ein bissiger, schwarz und weiß gefleckter Karawanenhund, war auf der Windseite hinter dem geschlossenen schmalen Ende des Zeltes angebunden.
Die Nacht wurde in drei Wachen, 9–12, 12–3 und 3–6 Uhr geteilt; gewöhnlich übernahm ich die erste, der Lama die letzte.
Jetzt hatte ich meine erste Nachtwache. Es war keine Kunst wach zu bleiben, denn teils hatte ich schon, während es noch hell war, ausgeschlafen, teils konnte man sich jeden Augenblick auf einen Überfall gefaßt machen. Schon vor 9 Uhr schliefen meine von den Anstrengungen der vorigen Nacht ermüdeten Kameraden und schnarchten laut.
Ich begann meinen Wachdienst, bald dicht bei dem Zelte, bald weit von ihm entfernt umherschlendernd. O diese finsteren Nächte, diese endlosen Stunden! Nie werde ich meine müden Schritte zwischen Malenki und Jollbars hin und zurück bis ins Unendliche vergessen! Die Minuten vergingen so langsam! Ich zählte zehn, zwanzig solche Promenaden, aber nur einige Minuten, höchstens eine Viertelstunde hatten sie in Anspruch genommen. Ich spielte mit Jollbars, der vor Freude heulte, wenn ich ihn besuchte, ich klopfte den Pferden und den Mauleseln den Rücken und ging dann weiter, um Malenki, der ganz allein hinter dem Zelte lag, zu streicheln.
Der Morgen war warm gewesen, und von Zeit zu Zeit hatte es tüchtig geregnet, der Abend aber war einigermaßen klar. Um 9½ Uhr brach ein Höllenwetter los. Der Himmel überzog sich mit rabenschwarzen Wolken, die von innen heraus durch zuckende Blitze erhellt wurden, und der Donner rollte mit infernalischer Kraft ringsumher in den Bergen und über unserem einsamen Lager.
Das Allerschlimmste aber war der Regen, der die Erde peitschte und wolkenbruchartig herniederströmte. Nie ist mir ein so entsetzlicher Regen vorgekommen. Er schmetterte und prasselte auf das Zelt, das einzufallen drohte und durch dessen Tuch ein feiner Staubregen in das Innere sprühte und sich dabei verteilte wie die Dusche einer Spritzflasche Eau de Cologne.[S. 181] Alles wurde durchnäßt, aber die Schlafenden kümmerten sich nicht um den Regen, sondern krochen nur tiefer unter ihre Pelze und fuhren fort Bretter zu sägen. Die Regentropfen trommelten lustig auf die mongolische Kasserolle und ihren Deckel, die wir beim Feuer hatten stehenlassen. Ich setze den schlüpfrigen Spaziergang zwischen den Hunden noch eine Weile fort, suche dann aber, naß wie eine ersäufte Katze, in der Zelttür Schutz. Von dem Mondschein hatte ich keinen Nutzen, denn die Wolken waren trostlos kompakt, und es sah aus, als wollte der Regen überhaupt nicht aufhören. Ganz undurchdringlich bleibt jedoch das Dunkel nicht; der Mond liefert wenigstens eine sehr schwache, diffuse Helle, in der sich die Umrisse der Karawanentiere ein wenig schwärzer als die Nacht um sie her abzeichnen, so daß ich von Zeit zu Zeit ihre Rücken zählen kann.
Ich zünde eine Pfeife und einen Lichtstumpf an, den ich in eine kleine Holzschachtel stelle; bei seinem Schein schreibe ich meine nächtlichen Betrachtungen nieder. Immer nur einen Satz, dann wieder eine Runde um das Lager. Es trieft mir von den Ärmeln, und die Mütze sitzt wie festgekleistert auf meinem kahlen Schädel. Nach den Abspülungen erinnerte mein geschminktes Antlitz sehr an das Fell eines Zebras. Die Temperatur sank nicht unter +4°, und von Kälte war daher keine Rede.
Der Regen strömt ohne Unterbrechung nieder, und sein eintöniges Plätschern übertönt alle anderen Geräusche. Doch was war das? Ein klagender Ton in der Ferne! Sollten die Tibeter gerade so ein Hyänenkonzert anstimmen wie 1896 die Tanguten bei Karascharuin-kubb? Nein, bewahre, es war Jollbars, der vor Ärger heulte, weil er draußen liegen und sich vollregnen lassen mußte. Und was war dies wieder für ein Lärm? Nur ein entfernter Donnerschlag. Der Donner und der Regen täuschen mich unaufhörlich. Ich eile mit dem Revolver unter dem Mantel ins Freie, stehe und warte dort eine Weile in der Nässe, horche angestrengt nach allen Seiten, da aber „im Schipkapasse alles ruhig“ ist, kehre ich zu meinem Lichtstumpfe zurück; die Pfeife will nicht mehr brennen, alles ist naß.
Die Stunden vergehen immer langsamer, und der Regen läßt nicht nach. „Das wird morgen ein schöner Ritt werden!“ dachte ich. Das einförmige Atmen der halbschlafenden Maulesel wirkt einschläfernd, und die Lider fangen an mir schwer zu werden. Es passierte mir aber nie, daß ich auch nur fünf Minuten einschlummerte. Sollten wir noch einmal überlistet werden, so sollte es wenigstens nicht während meiner Wache geschehen; ich hätte mich vor meinen Kameraden wie ein Hund geschämt und mich selbst verachtet.
Dann und wann schlagen die Tiere mit den Schwänzen, wenn der Regen ihre Seiten kitzelt. Die Hunde knurren bisweilen dumpf, und ich[S. 182] mache dann sofort die Runde um das Lager. Um 11½ Uhr streifte ich in der Dunkelheit umher, fest entschlossen, nicht eher ins Zelt zurückzukehren, als bis die Mitternachtsstunde geschlagen hätte und damit die Stunde meiner Befreiung gekommen wäre.
Es war denn auch 12 Uhr vorbei, als ich mich wieder bei meinem Lichtstumpfe niederließ. Jetzt rieselte es vom Pelze herunter, und die Stiefeln waren klatschnaß. Schagdur schlief so fest, daß es mir widerstrebte, ihn zu wecken, und ich hatte mich selbst überredet, seine Wache um eine halbe Stunde abzukürzen, als beide Hunde auf einmal wütend zu bellen begannen. Der Lama erwachte und eilte mit seiner Flinte hinaus, ich folgte ihm mit dem Revolver, das Licht wurde ausgelöscht, und wir schlichen uns gegen den Wind nach der verdächtigen Stelle hin. Dort hörte man deutlich Pferdegetrappel, und in einer anderen Richtung glaubte der Lama Hundegebell zu vernehmen. Er wollte schießen, aber ich wollte unter keinen Umständen derjenige sein, der anfing; gefiel es den Tibetern, uns den Krieg zu erklären, dann sollte ihnen freilich mit gleicher Münze heimgezahlt werden!
Daß sich einige hundert Meter von uns Reiter aufhielten, unterlag keinem Zweifel. Ich ließ den Lama beim Zelte bleiben, weckte Schagdur und ging mit ihm leise und vorsichtig in der Windrichtung, dann und wann lauschend. Da hörten wir, wie sich das Pferdegetrappel hastig entfernte; darauf wurde alles ruhig, und die Hunde stellten ihr Gebell allmählich ein.
Jetzt war die Reihe an Schagdur. Ich hörte seine Schritte draußen in dem Schmutz, als ich unter meinen feuchten Pelz kroch. Solche Nächte bringen mehr Spannung als Ruhe und sind mehr interessant als gemütlich. Aber man gewöhnt sich wohl daran, dachte ich, und nach einer Weile schlief ich gut und fest.
Schon um 5 Uhr weckte uns der Lama, der die letzte Wache hatte und es wohl für besser hielt, weiterzureiten als in den Tag hineinzustarren. Behaglich und vergnügt ist einem nach einer solchen Nacht gerade nicht zumute, nein, ungemütlich, steif, naß und frostig! Alles riecht schlecht und sauer; aber das gehört natürlich zur Sache und trägt dazu bei, den Eindruck der Echtheit zu erhöhen. Von wohlriechenden Lhasapilgern hat man noch nie reden hören! Und was mich betrifft, so fand ich, daß das Ganze sich gut anließ. Unter Verhältnissen wie den unsrigen wird die Stimmung außerordentlich von der Sonne beeinflußt. Man sehnt sich danach, sich umsehen zu können; die Nacht mit ihren heimtückischen Schatten ist auch dem unangenehm, der sich im Dunkeln nicht fürchtet.
Meine Muselmänner hatten mich entschieden für unzurechnungsfähig[S. 183] gehalten, als ich auf dieses wahnsinnige Unternehmen auszog. Es war in der Tat wahnsinnig, das läßt sich nicht leugnen, so viel zu wagen, ja das Leben zu riskieren, nur aus Lust, Lhasa zu sehen, das in seiner Topographie und seinem Aussehen durch Beschreibungen, Karten und Photographien von Punditen und Burjaten weit besser bekannt ist als die meisten Städte des innersten Asien. Doch ich muß ehrlich gestehen, daß ich mich nach den zwei Jahren ruhiger, friedvoller Wanderungen durch unbewohnte Teile des Kontinents und nach all meiner strebsamen Arbeit nun einmal nach einem wirklich haarsträubenden Abenteuer sehnte. Ich fühlte das unwiderstehliche Bedürfnis, meine Person in eine Lage zu bringen, in der das Leben auf dem Spiele stand, eine Situation, die Geschicklichkeit und Umsicht erforderte, wenn sie nicht zu einer Niederlage werden sollte, und in die wir uns so tief verwickeln würden, daß es noch schwerer wäre, sich mit heiler Haut wieder herauszuwickeln. Tatsächlich sehnte ich mich mehr nach dem Abenteuer als gerade nach Lhasa. Der Lama hatte mir die Stadt so gründlich beschrieben, daß ich sie schon satt bekommen hatte. Ich wollte die Tibeter sehen, mit ihnen reden und ausfindig machen, weshalb sie die Europäer so verabscheuen. Ein unkritischer junger Mann hat vor einigen Jahren erzählt, daß er in Tibet gefoltert worden sei, aber seine haarsträubenden Beschreibungen schreckten mich nicht ab — aus dem einfachen Grunde, weil ich ihnen keinen Glauben schenke. Es wäre wirklich ein großer Gewinn für die Menschheit, wenn Personen, denen es schwer wird, bei der Wahrheit zu bleiben, das Bücherschreiben bleiben lassen wollten!
[S. 184]
Der Appetit ist so früh am Morgen schlecht. Das Frühstück besteht nur aus Brot und Tee (Abb. 248); doch sobald die Pfeife angezündet ist und man im Sattel sitzt, geht der Tag seinen ebenen Gang, obwohl das Zeichnen der Marschroute die Geduld auf die Probe stellt, wenn man ein Pferd hat, das sich wie eine alte abgenutzte Dreschmaschine bewegt.
Der Tag war ebenso trübe und düster wie die Nacht. Die Sonne läßt sich überhaupt nicht blicken; schwere, schwarze Wolken hängen überall, Vorhängen vergleichbar, und sie sehen so schwer aus, daß man meint, sie müßten herunterfallen und zerreißen.
Der Lama glaubte am Morgen, im Südwesten ein schwarzes Zelt zu sehen, und stimmte dafür, daß wir dorthin reiten und Erkundigungen einziehen sollten; ich zog es jedoch vor, geraden Weges auf den nächsten Paß in den südlichen Bergen, die jetzt von Hagel und Schnee kreideweiß waren, loszugehen.
Sobald wir in das Tal, in welchem ein Bach strömte, eintraten, nahm die Steigung zu und wurde bald steil. Wir verließen das Tal und ritten über Hügel von rotem, pulverisiertem Sandstein im Zickzack zum Passe hinauf. Von dort kamen wir einen steilen Abhang hinunter in ein ziemlich breites, südostwärts führendes Tal.
In einer Talweitung lag der Kadaver eines Schafes mit seiner Last, die aus Salz in einem zweiteiligen Beutel bestand. Wahrscheinlich hatte eine tibetische Schafkarawane unsere kleinen Räuberseen besucht, wo das Salz an einigen Stellen offenliegt und leicht erreichbar ist und wo wir auch Spuren einer Herde gesehen hatten. Feuerstätten werden immer häufiger; von tibetischen Mahlzeiten übriggebliebene Knochen und Schädel liegen umher.
Als unser Tal nach Südwesten abschwenkte, verließen wir es und ritten über die nächste Bergkette, wo Schagdur bald einen ziemlich stark[S. 185] benutzten Weg entdeckte. Von dem Passe hatten wir wieder eine umfangreiche, obgleich wenig aufmunternde Aussicht: Berge und Kämme überall, soweit der Blick nach Süden und Südosten reichte. Kein Mensch, kein schwarzes Zelt in Sehweite! Wir hatten also noch eine Frist vor neugierigen Blicken; aber wir ahnten doch, daß verborgene, schleichende Späher uns nicht aus den Augen ließen.
Der Himmel ist bleischwer und düster, und die Stunden vergehen langsam und ermüdend. Auch der Tag hat seine Spannung; wir wissen nichts von diesem Lande und seinen Verhältnissen, aber wir sind überzeugt, daß früher oder später etwas Außergewöhnliches eintreten wird. Wir müssen jede Minute auf unserer Hut sein, sonst wird uns ein Streich gespielt, wenn wir es am wenigsten erwarten.
Von dem Passe folgten wir einem deutlich ausgetretenen Wege, der in ein an Sümpfen, Tümpeln, Quellen, Bächen und üppiger Weide reiches Tal hinunterführte. Der in Hülle und Fülle vorhandene Yakdung war hier umgedreht worden, um besser zu trocknen; man beabsichtigte also, wiederzukommen und ihn zu holen. Überall waren Spuren von Nomadenlagern sichtbar.
Weiter abwärts schien die Weide abzunehmen. Als wir einen strategisch geeigneten Platz fanden, beschlossen wir daher, für die Nacht hier zu bleiben. Auf der 70 Meter breiten Landenge zwischen zwei kleinen Seen wurde unser nasses Zelt aufgeschlagen. Wir sehen der bevorstehenden Nacht mit einem gewissen Unbehagen entgegen und fragen uns, was sie wohl bringen werde.
Schon um 8 Uhr wurden die Tiere in gewöhnlicher Weise gebunden. Die Luft war ruhig, aber alle Himmelsrichtungen konnten als gleich unsicher gelten. Diese Nacht war noch ärger als die vorige; es war, als ob Tausende von Dachrinnen ihren Inhalt über unser Lager ausschütteten. Aber die hierzulande vorgeschriebene Regenzeit war da, und wir hatten kein Recht, uns zu beklagen. Wenn man, wie ich diesmal, vier Stunden Wache hält und bis auf die Haut naß wird, so weiß man ganz genau, wie ein richtiger, ehrlicher Regen beschaffen sein muß.
Von Zeit zu Zeit saß ich, einigermaßen geschützt, in der Zelttür. Es klatscht in den Packsätteln der Maulesel, von deren Ecken das Wasser in dicken Strahlen rinnt, wie in einer Waschmaschine. Die Tiere schütteln sich, daß die Tropfen nach allen Seiten spritzen. Bisweilen spitzen sie die Ohren, und die Hunde knurren dumpf. Malenki darf frei umherlaufen und schnüffelt auf einem alten Lagerplatze nach Knochen, denn er und Jollbars haben seit ein paar Tagen nichts als Brot bekommen.
[S. 186]
Auf einmal fing der eine zu bellen an, und der andere stimmte bald ein. Es war nur ein Schreckschuß, denn nur einer der Maulesel hatte sich losgemacht und spazierte einen Abhang hinauf. Mir blieb nichts übrig, als ihn wieder einzufangen; aber dies war leichter gesagt als getan. Er war munter und lebhaft und sprang umher, und es dauerte lange, ehe ich ihn bei der Halfter packen konnte. Sein Betragen demoralisierte einen seiner Kameraden, der das Manöver wiederholte und gleichfalls mit großer Mühe eingefangen wurde.
31. Juli. Als ich nach mehrstündigem Schlafe geweckt wurde, um beim Einpacken und Beladen zu helfen, stürzte der Regen noch ebenso lustig nieder wie bisher, aber hier gab es keine Gnade: hinauf in den Sattel, sobald der Tag anbrach, und fort nach Südosten über beschwerliches, stark kupiertes Terrain. Jetzt hatte unsere kleine Gesellschaft keinen trockenen Faden mehr an sich, so daß uns der Regen eigentlich wenig genierte; aber wir sehnten uns danach, daß die Sonne sich einmal über uns erbarmte und uns trocknete.
Als ich mich auf meinen weichen, gepolsterten Sattel setzte, tropfte das Wasser aus ihm; nachher erhielt ich vom Regen eine so gründliche Dusche, daß das Wasser von meinen Kleidern in die Stiefel rann, in denen es bei der geringsten Bewegung plätscherte. Erhob ich meinen Arm, so klang es ungefähr, als ob ein Spüllappen ausgerungen werde. Das Ganze war recht betrübend; wenn es doch lieber geschneit hätte!
Der Weg, dem wir noch immer folgten — schon jetzt war deutlich zu erkennen, daß er nach Lhasa führte —, ging über fünf Pässe, von denen jedoch die beiden letzten nur in kleineren Abzweigungen zwischen Tälern lagen, deren Bäche einem Haupttale zuströmten. Im Osten sah man den sich schlängelnden Fluß.
Unser Weg vereinigt sich mit einem anderen, von links kommenden. Er ist deutlich ausgeprägt, weil eine große Yakherde ihn benutzt hat. Infolge des heftigen Regens, der alle Spuren bald vertilgen mußte, konnten wir annehmen, daß die Tiere hier ganz kürzlich, vielleicht erst am Morgen, vorbeigezogen waren, und wenn wir uns beeilten, mußten wir die Karawane noch einholen können.
Es dauerte auch nicht lange, so unterschieden wir ganz fern im Südosten eine Menge schwarzer Punkte; es waren Yake, und später trat auch eine Schafherde aus dem Halbdunkel hervor. Ein Zelt, das bisher verdeckt gewesen war, tauchte am Ufer eines Baches auf. Schagdur und ich ritten weiter, während sich der Lama dorthin begab. Wir nahmen als selbstverständlich an, daß die Besitzer des Zeltes mongolische Pilger seien, und hatten beabsichtigt, uns ihnen anzuschließen; es stellte sich jedoch[S. 187] heraus, daß es Tanguten waren, die nach dem berühmten „Tempel der zehntausend Bilder“ in Kum-bum pilgerten. Sie blieben auf jedem Lagerplatze einen oder mehrere Tage, reisten sehr langsam und waren, ihrer Meinung nach, noch eine Monatsreise von Lhasa entfernt. Sie zeigten bedenklich viel Interesse für uns und wollten alles wissen, wer und wie viele wir seien, woher wir kämen, wohin wir zögen usw. Sie hatten 50 Yake, einige Pferde und drei Hunde, die von Jollbars und Malenki greulich zerzaust wurden.
Die Schafherde zählte nicht weniger als 700 Tiere und wurde von einer alten Frau gehütet, die augenscheinlich an Pilger gewöhnt war, denn sie zeigte keine Furcht. Nach all dem Regen, Schmutz und Dreck sahen wir wie leibhaftige Vagabunden aus, und kein Ritter von der Landstraße brauchte sich mehr vor uns zu schämen. Die Eleganz war gewissenhaft abgespült worden.
Die Alte teilte uns mit, daß wir im nächsten Tal ein schwarzes Zelt finden würden, wo man uns alles, dessen wir bedurften, vor allem Auskunft über den Weg nach Lhasa geben könne.
Einen Kilometer von dem Zelte, das sich richtig an der angegebenen Stelle befand, lagerten wir, der Vorsicht halber noch immer auf freiem Felde.
Der Lama begab sich sofort zu den Tibetern und kehrte sehr befriedigt zurück. In dem Zelte, das von Hunden bewacht war, hatte er einen jungen Mann und zwei Frauen angetroffen, die sich entschuldigten, uns heute Schafe, Milch, Fett und Tsamba nicht verkaufen zu können, da es Feiertag sei; wenn wir uns aber bis morgen geduldeten, so sollten wir erhalten, was sie abgeben könnten. Womit sie uns aber gleich versehen könnten — weil wir friedliche Mongolen seien —, sei trockener Yakdung. Der Lama brachte einen ganzen Sack voll mit; es war zu schön, denn sonst wäre es uns in der ewigen Nässe kaum möglich gewesen, ein Feuer anzumachen. Auf die Frage, ob sie uns zwei Pferde verkaufen würden, hatte er die Antwort erhalten, daß darauf nur der Hausherr, der ausgegangen sei, Bescheid geben könne.
Der Lama hatte kaum über seine Mission Bericht erstatten können, als auch schon der in Frage stehende Mann in eigener hoher Person auf einem Hügel erschien, wo er in gebührender Entfernung stehenblieb und uns betrachtete. Ohne Ziererei oder Furcht kam er mit, als der auf ihn zugehende Lama ihn zu uns einlud, und setzte sich vor der offenen Zelttür auf den nassen Boden.
Dieser unser erster Tibeter mochte ein Mann von 40 Jahren sein; sein Name war Sampo Singi. Ein mehr schwarzes als sonnverbranntes,[S. 188] bartloses, runzeliges Gesicht; rabenschwarzes, schmutziges Haar in zottigen Strähnen, aus denen das Regenwasser auf den zerlumpten, sackähnlichen Mantel niedertropfte, Stiefel von grobem, ursprünglich weißem Filz, eine Leibbinde mit daranhängendem Tabaksbeutel und einer Pfeife, alles greulich schmutzig; dies war seine äußere Erscheinung. Sampo Singi war barhäuptig und, bis auf die Stiefel, barbeinig; mit anderen Worten, er hatte keine Hosen an. Es muß erfrischend sein, unter solchen Umständen bei Regenwetter zu reiten!
Unaufhörlich schneuzte er sich mit den Fingern mit einer bewundernswerten Energie; der Sicherheit halber machten wir es ebenso, da man ja nicht genau wissen konnte, ob die tibetische Etikette derartige demonstrative Handgreiflichkeiten in Gegenwart von Fremden nicht geradezu vorschrieb. Das Bild, das wir bei dem Regenwetter boten, muß ein Anblick für Götter gewesen sein; schade, daß es weiter niemand sehen konnte.
Sampo Singi untersuchte ganz ungeniert unsere Effekten — Instrumente und Tagebuch hatte ich rechtzeitig eingesteckt. Unsere oben engen, nach unten weiter werdenden Holznäpfe gefielen ihm besonders, und er machte die sachverständige Bemerkung, daß die Mongolen stets derartige Gefäße hätten. Mir gegenüber zeigte er kein Mißtrauen, war ich doch beinahe ebenso schmutzig wie er selber.
Nachdem die Bekanntschaft gemacht war und die Vertraulichkeit zugenommen hatte, gelang es dem Lama, aus Sampo Singi herauszuquetschen, daß unser gestriger Lagerplatz zwischen den beiden kleinen Seen Merik hieß. Den Fluß, den wir heute im Osten gesehen und ziemlich nahe zur Linken gehabt hatten, nannte er Gartschu-sängi. Der heutige Lagerplatz trug den Namen Gom-dschima, und der nächste Gebirgskamm im Südwesten hieß Haramuk-lurumak. Er teilte uns auch mit, daß wir während zweier weiterer Tagemärsche kaum Aussicht hätten, Nomaden zu treffen, auf dem dritten aber würden wir auf viele Zelte stoßen. Wenn wir kurze, langsame Tagereisen machten, würden wir bis Lhasa 12 Tage brauchen, marschierten wir aber so tüchtig wie heute (42,2 Kilometer), so würden wir die Stadt in 8 Tagen erreichen. Der Weg, auf dem wir uns jetzt befanden, führte richtig nach dem Passe Lani-la.
Schagdur und der Lama pflegten zu schnupfen, und Sampo Singi nahm sich auch eine gehörige Prise. Das hätte er jedoch lieber nicht tun sollen, denn er geriet in ein verzweifeltes Niesen, das gar kein Ende nehmen wollte. Er nahm es aber nicht übel, daß wir über ihn lachten. Ganz unschuldig fragte er, ob wir unseren Schnupftabak zu pfeffern pflegten, und ließ sich nicht in Versuchung führen, als ihm noch eine Prise angeboten wurde.
[S. 189]
Jetzt besann sich Schagdur auf seine Würde und brüllte mich an: „Geh und treibe die Pferde ein, Bursche! Was hast du hier zu gaffen?“ Man konnte nicht wissen, ob Sampo Singi Mongolisch verstand, jedenfalls sah er nicht im mindesten erstaunt aus, als ich sofort nach den Hügeln lief und unsere Tiere nach dem Zelte zu treiben begann. Bevor ich weit mit ihnen gekommen war, hatte sich der Alte zum Glück entfernt, sonst würde seine Intelligenz mehr als ausreichend gewesen sein für die Überlegung: „Der Bursche da hat noch in seinem ganzen Leben keine Maulesel eingetrieben!“ Hatte ich sie endlich alle auf einem Haufen, so gefiel es dem Sarik Kullak oder „Gelbohr“, nach dem vortrefflichen Grase, von dem ich ihn eben fortgejagt hatte, zurückzugaloppieren. Ich mußte umkehren und das Vieh von neuem holen; aber wenn ich zum Haufen zurückkam, hatte sich dieser zerstreut, und mit der Disziplin war es vorbei. Schließlich erwischte ich drei Maulesel und ließ sie nicht eher wieder los, als bis sie festgebunden waren.
Unter dem Zelttuche der schweren Wolkenmassen warf die Sonne noch beim Untergehen einen Abschiedsblick hervor, der einige Minuten über die Weidegründe der ersten Nomaden hinstrahlte, und gegen 9 Uhr machte uns auch der Mond einen flüchtigen Besuch. Aber schon gleich nach 10 Uhr erhob sich der Weststurm, und ich, der ich die Wache hatte, mußte das Zelt, so gut es gehen wollte, festmachen. Eines der im Laufe des Tages gezeichneten Kartenblätter flog in die Nacht hinaus, wurde aber noch eingeholt und gerettet. Dann strömte der Platzregen wieder taktfest und trostlos von dem gleichmäßig schwarzen Himmel herab; nur mit Mühe konnte ich sehen, wo die Tiere standen.
In dieser Nacht fühlten wir uns bedeutend ruhiger als gewöhnlich. Seit dem unerwarteten Zusammentreffen mit den Yakjägern hatten wir keine Eingeborenen getroffen, wohl aber hatten wir sie wie böse Geister um uns herumspuken gefühlt, ja sie hatten uns sogar einmal überrumpelt. Jetzt dagegen, da wir friedliche Nomaden als nächste Nachbarn hatten, brauchten wir kaum nächtliche Besuche zu fürchten, und Sampo Singi hatte uns versichert, daß hier in der Gegend keine Räuber umherstreiften. Doch für alle Fälle wurde der Nachtdienst auf dieselbe Weise wie gewöhnlich verrichtet. Der einzige Unterschied war, daß ich im Zelte ein kleines Feuer unterhielt, das noch mehr dazu beitrug, unsere bereits genügend eingeschmutzten Sachen zu schwärzen.
1. August. Als ich mit den Worten: „Drei Tibeter kommen auf Besuch“ geweckt wurde, regnete es merkwürdigerweise nicht. Ich sprang auf und versteckte die Kleinigkeiten, die einen geheimnisvollen Fremdling hätten verraten können. Zwei Männer und eine Frau erschienen; daß sie[S. 190] in friedlicher Absicht kamen, sah man schon von weitem, denn sie führten ein Schaf am Strick und trugen verschiedene Sachen.
Sampo Singi führte wieder das Wort und reihte seine Delikatessen an unserem Feuer auf. Ach, was für schöne Sachen; jetzt würden wir nach der knappen Kost der letzten Tage wie Fürsten tafeln! Ein großes Stück Fett (Mar), einen Napf saure Milch (Scho), eine hölzerne Schale mit Käsepulver (Tschorá), eine Kanne Milch (Oma) und einen Klumpen Sahne (Bema): konnten wir uns ein lukullischeres Frühstück wünschen?
Alles war Primaware, außer der Sahne, die beinahe an einen Bund aufeinandergelegter, bedenklich rußiger und haariger Hautlappen erinnerte. Das Käsepulver ist eines der Ingredienzien der „Tsamba“, die im übrigen aus Mehl, Tee, Fett- oder Butterstücken, was man gerade hat, alles in einer Schüssel verrührt, zu bestehen pflegt. Ich muß gestehen, daß es mir nie gelungen ist, mich an diese von den Mongolen hochgepriesene Delikatesse zu gewöhnen.
Um so besser wußte ich die sauere Milch zu würdigen. Sie übertraf alles, was ich mir hatte denken können, und hätte mir ein höheres Wesen, als sie verzehrt war, unter allen Delikatessen der Erde freie Wahl gelassen, so würde ich ohne Zögern um noch etwas sauere Milch gebeten haben! Sie war dick, weiß und säuerlich; in der ganzen Welt hat die „Scho“ der Tibeter nicht ihresgleichen!
Alles dieses sowie das Schaf sollten nun bezahlt werden, und Schagdur zog einige chinesische Silberstücke hervor. Sampo Singi wog sie und fand sie gut, erklärte aber, nur Silbergeld von Lhasa annehmen zu können. Da wir solches nicht besaßen, prüften wir ihn auf seine Empfänglichkeit für blauen chinesischen Stoff, und das wirkte. Mit wahrem Genusse strich er darüber hin und ließ ihn zwischen den Fingern rauschen; er besah ihn in der Nähe und aus der Ferne, mit einem Worte: er hatte angebissen. Die Schweinsaugen seiner edeln Gattin glänzten vor Begierde. Wir hatten von diesem Zeuge zwei Pakete zu Tauschzwecken mitgenommen, und Sampo Singi wollte das eine haben. Das asiatische Parlamentieren und Feilschen begann, und schließlich mußte er sich mit 12 Ellen, dem dritten Teile eines Paketes, begnügen. Pferde konnte er jedoch nicht entbehren, so sehr wir ihn auch in Versuchung führten. Als der Handel abgeschlossen war, hielt jede Partei die andere für übervorteilt.
Nun baten wir Sampo Singi, das Schaf zu schlachten und zu zerlegen, dann sollte er als Lohn für seine Gastfreiheit und für die uns erwiesene Freundlichkeit das Fell behalten dürfen; hiermit war er sehr zufrieden. Ich beobachtete mit diplomatischer Gleichgültigkeit, wie er dabei vorging. Er legte das Tier auf die linke Seite und band ihm drei Beine[S. 191] zusammen, das linke Vorderbein aber ließ er frei. Dann schnürte er ihm einen dünnen, weichen Lederriemen mehreremal sehr fest um das Maul. Darauf legte er den Kopf des Schafes so, daß die beiden wagerechten, Korkzieher ähnlichen Hörner den Boden berührten, und stellte sich auf sie. Das Schaf lag jetzt wie in einem Schraubstock mit seinem Kopfe am Boden festgenagelt. Als Sampo Singi so weit war, steckte er Daumen und Zeigefinger der rechten Hand in die Nasenlöcher des gefangenen Schafes, um es durch Ersticken zu töten. Ich sah heimlich nach der Uhr, wieviel Minuten hierzu erforderlich sein würden, vergaß nachher aber, das Resultat aufzuschreiben; doch erinnere ich mich, daß es eine geraume Zeit dauerte und für mich eine entsetzliche Pein war, das arme Tier zappeln und zucken zu sehen, während seine Augen immer weiter aus ihren Höhlen traten. Die ganze Zeit über betete der Alte mit verzweifelter Zungengeläufigkeit „Om mani padme hum“, was mich an die Art der Muselmänner, Schafe zu töten, erinnerte. Wie um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen und dem Schöpfer zu schmeicheln, plappern auch sie Gebete zum Lobe des Ewigen her, während sich der kalte Stahl von unschuldigem Blute rötet.
Endlich wurde das Schaf still, seine Beine fielen schlaff nieder, und Sampo Singi richtete sich auf. Es war hart, diese Tierquälerei mitanzusehen, ohne sie verhindern zu dürfen. Ich hütete mich aber wohl, mich und meine Gefühle zu verraten, und im übrigen ist auch jede Einmischung in alte, feststehende Gebräuche völlig nutzlos.
Sodann frühstückten wir miteinander von den gekauften Milchspeisen, und die Hunde erhielten zum Lohn für ihren tadellosen Wachtdienst eine tüchtige Portion Fleisch. Die Frau war von ihrem Zeuge derart entzückt, daß sie ganz den Appetit verloren hatte und nur bald diesem, bald jenem von uns freundlich zunickte. Ihre Kleidung war die der Männer; das struppige schwarze Haar war in zwei Zöpfe geteilt, stand aber eigentlich in rattenschwanzähnlichen Büscheln nach allen Ecken und Enden. Sie trug Filzstiefel mit einfacher Buntstickerei, die einst recht hübsch gewesen war. Wie sie es angefangen hatte, so fabelhaft schmutzig zu werden, wie sie war, begriff ich nicht, beneidete sie aber aufrichtig darum. Meine vermutlich feinere Haut wurde unaufhörlich vom Regen „rein“ gewaschen, auf ihrer Haut aber saß die Schmutzschicht so dick und kompakt, daß sie mit Aussicht auf Erfolg als Treibbeet für Frühkartoffeln hätte benutzt werden können. Die Poren in der Gesichtshaut der Tibeter müssen verschwunden sein; jedenfalls ist es sicher, daß ihre Öffnungen beständig verstopft bleiben.
Sampo Singi half uns bereitwillig beim Beladen unserer Tiere. Das Zelt war von all den Regenschauern, die es eingesogen hatte, doppelt so schwer geworden.
[S. 192]
Der ehrliche Nomade wünschte uns glückliche Reise nach Lhasa und angenehmen Aufenthalt in dieser Stadt, und der Lama versicherte, er habe dies in so manierlicher Weise getan, daß ihm die lamaistischen Finessen sichtlich nicht fremd seien. Es war ihm augenscheinlich nicht darum zu tun, uns noch hier zu behalten; sonst hätte er uns gewiß vor dem bevorstehenden Tagemarsche gewarnt. Er sagte nur, daß wir einen Paß zu überschreiten hätten und daß der Weg nach Lhasa überall deutlich erkennbar sei, weiter nichts. Wir versprachen, ihn auf dem Rückwege wieder aufzusuchen. Wir taten dies auch, aber ohne Erfolg, denn er hatte seine Penaten bereits nach anderen Weideplätzen geflüchtet.
In halber Dämmerung brachen wir um 9 Uhr auf; der Himmel verhieß uns wenig Gutes, und bleischwer hingen die Wolken über der Erde. Über Hügel und Bergausläufer näherten wir uns dem Flusse Gartschu-sängi, der bei näherer Besichtigung nichts weniger als einladend aussah. Sein Tal drängt sich zusammen, und die schwere Wassermasse rauscht dumpf unten zwischen den Felsen, während wir oben dem oft ziemlich beschwerlichen und gefährlichen Wege über Pässe und Höhen folgen. Murmeltiere und Hasen kommen hier besonders häufig vor, und die Hunde machen sich mit ihrer Verfolgung viele unnötige Mühe.
Fünf Minuten, nachdem wir Gom-dschima verlassen hatten, brach die heutige Regenflut los, und peitschte die Erde wie mit Ruten; bald waren wir wieder pudelnaß (Abb. 249).
Nachdem wir über einen letzten kleinen Paß und einen steilen Abhang hinuntergegangen waren, erweiterte sich die Landschaft, und vor uns dehnte sich ein ebener Talgrund aus, der im Süden, soweit man vor dem Regen sehen konnte, nicht von Bergen begrenzt wurde. Den Gartschu-sängi verloren wir auf der linken Seite aus den Augen.
In zähem Schlamme geht es nach Südosten weiter, und wir hüten uns, den Weg aus dem Auge zu verlieren. Der Regen spült über die Erde, unsere Sättel rutschen in der Nässe hin und her, unsere förmlich am Leibe klebenden Anzüge glänzen von Wasser, und aus den Mähnen der Pferde rieselt es. Wenn die Hunde stehenbleiben, um sich zu schütteln, sind sie von einer Wolke sprühender Tropfen umgeben.
Eine Strecke weit ist das Terrain wieder etwas kupiert, das Gras ist gut, und man sieht oft verlassene Lagerplätze.
Jetzt führte der Weg gerade nach dem rechten Ufer eines so breiten, gewaltigen Flusses, daß wir ihn von fern für einen See hielten, dessen gegenüberliegendes Ufer vom Regen verschleiert wurde. Doch das laute Aufschlagen der Regentropfen auf der Wasserfläche wurde bald durch ein dumpferes Getöse wie vom Heranwälzen großer Wassermassen übertönt.[S. 193] Auch die gelbe, trübe Farbe verriet einen Fluß, und als wir am Ufer standen und die Wellen nach Westsüdwesten rollen sahen, war unser Schicksal deutlich besiegelt, denn hinüber mußten wir um jeden Preis.
Der Fluß, der kein anderer war als der Satschu-sangpo, den schon Bonvalot, Prinz Heinrich von Orleans und Rockhill vor mir in derselben Gegend überschritten hatten, war infolge des ewigen Regens zu ungeheuren Dimensionen angeschwollen und teilte sich in seinem breiten Bette in 20 Arme, von denen jeder an und für sich schon einen ziemlich großen Fluß bildete. Vier Arme waren kolossal, und es erschien mir fast unmöglich, sie zu durchwaten. Doch ohne einen Augenblick zu zögern und ohne die Furt erst genauer zu untersuchen, ging der Lama, der stets voranritt, gerade in das Wasser hinein, und die beiden anderen Pilger folgten ihm. Es lief noch glücklich ab, und nur ein paarmal betrug die Tiefe mehr als einen Meter. Ich erwartete immer, den Lama, der den kleinsten Maulesel ritt, in den trüben Wellen verschwinden zu sehen. Von der Tiefe kann man sich bei so trübem Wasser vorher natürlich keinen Begriff machen.
Wir hatten uns über die halbe Anzahl von Armen hinübergearbeitet und rasteten einige Minuten auf einer Schlammbank mit kaum fußtiefem, langsam fließendem Wasser. Man atmet von seiner Angst um die kleine Gesellschaft auf und freut sich, so weit gekommen zu sein. Die Annehmlichkeit der Lage ist jedoch zweifelhaft. Hinter uns der halbe Fluß, vor uns die andere Hälfte, und wir stehen mitten in dieser rauschenden, tosenden Wassermasse, die vom Tale herunter auf uns losstürmt und die Absicht zu haben scheint, uns zu überwältigen und mitzureißen. Es schwindelt einem vor den Augen; die ganze ausgedehnte Wasserfläche ist auf allen Seiten in Bewegung, doch uns kommt es vor, als wären wir es, die durch das Tal jagen. Die Ufer sind vor dem Regen, der die Wasserfläche peitscht, nicht zu sehen; jeder Bach, jede Rinne in der Nachbarschaft trägt zum Anschwellen des Flusses bei, jeder Tropfen liefert seinen Tribut zum unwiderstehlichen, gewaltsamen Vorwärtsstürmen der Wassermasse.
Der Lama stemmte seinem Maulesel die Fersen in die Seite und begab sich wieder in tiefes Wasser hinein. Er hatte noch nicht zehn Schritt zurückgelegt, als es dem Maulesel schon bis an die Schwanzwurzel ging und der Reiter die Knie hochziehen mußte, um wenigstens die Stiefelschäfte über dem Wasser zu haben. Der Maulesel, der unsere beiden mit Leder überzogenen Kisten trug, geriet in eine höchst bedenkliche Lage. Die Kisten wirkten, bevor das Wasser in sie hatte eindringen können, wie Korkkissen, und das Tier verlor infolgedessen den Boden unter den Füßen, beschrieb dabei einen halben Bogen und wurde mit unwiderstehlicher Kraft von der Strömung ergriffen. Der Strudel riß das Tier natürlich in den[S. 194] schnellsten Strömungslauf, wo nur noch sein Kopf und die beiden Kisten über dem Wasser sichtbar waren. Ich gab es verloren, aber es zog sich auf bewunderungswürdige Weise aus der Geschichte. Beim Herumtasten im Flusse stieß es schließlich wieder auf festen Grund und es war gerade so dicht an das linke Ufer getrieben worden, daß es selbst hinaufkletterte, wobei es die jetzt halb mit Wasser gefüllten Kisten noch immer im Gleichgewichte auf dem Rücken hatte. Die Strömung hatte das Tier aber schon so weit abwärts getrieben, daß es ziemlich lange Zeit erforderte, um es wieder zu holen.
Sobald wir das Manöver des Maulesels gewahrten, schrien wir dem Lama verzweifelt zu, er solle umkehren; er hörte aber keinen Ton. Das Wasser wirbelte und schäumte um ihn herum wie unterhalb eines Mühlrades, er setzte sich aber nur höher in den Sattel und trieb seinen Maulesel an, der immer tiefer sank. Seine Todesverachtung war bei dieser Gelegenheit großartig, wenn man bedenkt, daß er, wie wir, mit einem schweren, tropfnassen Schafpelze bekleidet war und obendrein überhaupt nicht schwimmen konnte. Ich hatte die Leibbinde abgenommen und den Pelz aufgeknöpft, damit ich ihn jeden Augenblick abwerfen konnte, und ich war vollständig auf ein Bad vorbereitet, obgleich ich durchaus keine Sehnsucht danach verspürte. Man wird in der nebelkalten Luft steif und unlustig, und das Wasser ist zu kalt, um einladend zu sein, wozu noch kommt, daß jetzt alles, was Waschen und Reinlichkeit heißt, unseren mongolischen Prinzipien widerstreitet.
Das Glück steht jedoch dem Kühnen bei. Bald sahen wir den Maulesel sich höher aus dem Wasser erheben, und der Lama konnte die Stiefel wieder in die Steigbügel stecken. Für uns, die wir auf unseren hohen Pferden saßen, war der Übergang weniger gefährlich.
Der Satschu-sangpo hatte jedoch beschlossen, mich zur Strafe für unser dreistes Unterfangen nicht ohne eine kleine Taufe zu entlassen. „Wagst du es zu versuchen, nach dem Allerheiligsten von Tibet vorzudringen, so sollst du wenigstens nicht vergessen, daß du dem Hindernisse, das ich dir in den Weg gelegt habe, Trotz geboten hast.“
Der letzte Arm, einer der vier größten, war nur 30 Meter breit, aber tief, schäumend und reißend. Ich war ein wenig zurückgeblieben und hatte nicht gesehen, wo die anderen, die sich bereits am Ufer befanden, hinübergewatet waren. Daher ritt ich gerade auf ihren Landungsplatz zu. Das Wasser stieg um mich herum immer höher, und der Schimmel sank immer tiefer. Mir wurde schwindlig, als das Wasser mir über die Stiefelschäfte ging, dann aber stieg es über die Knie, über den Sattel, und bald guckten nur noch Hals und Kopf des Pferdes aus den um mich[S. 195] herumschäumenden Wellen hervor. Der Lama und Schagdur standen am Ufer, brüllten mir etwas zu und zeigten, wo die Furt ging; ich aber hörte nichts als das Tosen der Wassermassen. Nun ging mir das Wasser schon bis an die Rippen, und es wurde Zeit, das Pferd seinem Schicksal zu überlassen. Doch gerade in diesem Augenblick verlor es den festen Boden unter den Füßen und begann zu schwimmen, und ich hielt mich unwillkürlich an seiner Mähne fest. Dies war klug, denn bald hatte das Pferd wieder Grund gefaßt und erkletterte schließlich mit verzweifelter Anstrengung das steile Ufer, wo das Wasser von Roß und Reiter nur so herabströmte. Mein Bad hatte ich bekommen, und zwar gründlich, und vor Aufregung zitterten mir noch eine ganze Weile die Knie.
An und für sich hatte die Taufe wenig zu sagen, denn wir waren schon vom Regen durchnäßt, aber letzteren ziehe ich doch dem direkten Untergetauchtwerden vor. Alle unsere Sachen, Zelt, Kisten, Kleider und Proviant, waren ebenso übel daran. Waren die Lasten an diesem Tage schon von oben herab angefeuchtet worden, so wurden sie durch die Berührung mit dem Flusse auch noch von unten gründlich eingeweicht. Nach dieser Wasserprobe sah unsere kleine Schar am Ufer noch jammervoller aus als je zuvor. Wir waren aber doch froh, den Übergang bewerkstelligt zu haben, denn keiner konnte wissen, wie lange es noch zu regnen fortfahren würde, und vor Beendigung der Regenzeit würde der Fluß sicherlich nicht fallen.
Es hatte uns 26 Minuten gekostet, über das ganze Flußbett hinüberzugelangen, aber es war auch langsam gegangen, und zwischen den Armen war das Bett teilweise wasserfrei. Mein Pferd machte, wenn ich nur die wasserführenden Teile der gigantischen Rinne rechne, 716 Schritte, also ungefähr 500 Meter. An eine Berechnung der Wassermenge ist bei einem so zersplitterten Flusse und unter so schwierigen Verhältnissen nicht zu denken, und ich hatte auch — im Pilgergewande — wenig Ruhe und Lust dazu. Ich taxiere sie jedoch annähernd auf 200–250 Kubikmeter in der Sekunde. Nur während der Regenzeit, und auch dann nur selten, steigt der Satschu-sangpo zu so kolossalen Dimensionen an. Er ist jedenfalls einer der größten Flüsse im inneren Tibet. Ich spreche dabei natürlich nicht von denjenigen, die sich ins Meer ergießen, sondern nur von denen, die von der Quelle bis zur Mündung innerhalb des Landes bleiben und ihr Wasser in abflußlose Salzseen entleeren. Ich sollte später Gelegenheit erhalten, den untersten Teil des Laufes dieses Flusses genauer kennen zu lernen.
Grau, kalt und wüst sah die Landschaft in Westsüdwest aus, wo das Tal im Regennebel verschwand, und triefend ließen wir den Satschu-sangpo mit Freuden hinter uns zurück. Meine Stiefel waren bedenklich mit Wasser[S. 196] gefüllt, und ich fand bald, daß es unnötig sei, ihren Inhalt mitzuschleppen, obgleich es nicht das erstemal war, daß ich in den Stiefeln Wasser trug. Doch als dies 1895 in der Wüste Takla-makan geschah, sollte ich damit einem Menschen das Leben retten, während wir jetzt durchaus keine Veranlassung hatten, über Wassermangel zu klagen. Ich hielt daher, leerte die Stiefel aus, band sie hinten an den Sattel und ritt barfuß weiter. Die Kisten waren weniger dichte Wasserbehälter; als wir lagerten, war die ganze Flüssigkeit aus ihren unteren Ecken herausgetropft.
Es dauerte nicht besonders lange, bis wir lagerten, denn für heute hatten wir genug. Wir blieben an einem kleinen Bache auf einem grasreichen Hügel, wo der Regen ohne Schlammbildung in den Boden eingesickert war. Der Bach schwoll vor Einbruch der Dunkelheit wohl dreimal so hoch an, wie er ursprünglich war, und ich seufzte bei dem Gedanken an das jetzige Aussehen des Flusses erleichtert auf; jetzt wäre es absolut unmöglich gewesen, ihn zu überschreiten. Sampo Singi hatte uns gewiß mit Fleiß nicht gewarnt, weil er vielleicht gefürchtet hatte, daß wir in solchem Falle zu lange auf seinen Weideplätzen bleiben würden, oder er mochte auch keine Lust gehabt haben, uns zu begleiten und uns die beste Furt zu zeigen.
Unser Lager mußte sich diesen Abend mit einer Zahl, Nr. 50, begnügen, denn wir wußten nicht, wie die Gegend hieß. Es war ein recht angenehmes Lager! All unser Gepäck war durch und durch naß und verschiedene Sachen ruiniert. Der Lama war hauptsächlich über seine Apotheke, d. h. seine in Papieren und Beuteln verwahrten Medikamente und heilbringenden Samen, betrübt.
Wie sollte es unter diesen Umständen mit dem Feueranmachen gehen? Yakdung lag zur Genüge umher, aber er war ebenfalls naß. Nach mehreren ebenso energischen wie vergeblichen Versuchen glückte es uns schließlich doch. Der Dung wurde von seiner feuchtesten Oberschicht befreit, und mit Aufopferung einiger Papierstücke brachte ich ihn zum Brennen. Unsere Tiere liefen, solange es hell war, frei auf der Weide umher; wir selbst hatten alle Hände voll damit zu tun, unsere Kleidungsstücke wenigstens von der Hauptmasse des Wassers zu befreien. Ich zog mich aus und kauerte vor der nichts weniger als aromatisch duftenden Argolglut, an der ich meine Kleider trocknete, nachdem ich so viel Wasser wie nur irgend möglich aus ihnen herausgerungen hatte.
Wir wechselten einander als Blasebalg beim Feuer ab, sonst wäre es bald erloschen. Es ist eine wenig dankbare Aufgabe, bei Regenwetter Kleider zu trocknen, aber auf die Gefahr hin, sie anzusengen, gelang es uns doch, die Feuchtigkeit einigermaßen aus ihnen herauszubringen.
[S. 197]
Erbarmungslos und grausam senkte sich die Nacht über die Erde herab, und der Mond fand keine Gelegenheit, auch nur den allerflüchtigsten Blick auf Tibets naß geregnete Gebirge zu werfen. Ich war nach vier Stunden mit der gewissenhaften Verrichtung meines verantwortungsvollen Nachtdienstes fertig. Kalt und düster, windig und dunkel war es, und es regnete immerzu. Das Zelttuch flattert und schlägt wie ein im Winde schwellendes Segel; ich glaube schleichende Schritte oder herangaloppierende Reiter zu hören. Von zwei verschiedenen Seiten schallen Rufe durch die Nacht. Vielleicht nähern sich die Kum-bum-Pilger; aber nein, diese waren gewiß nicht so verrückt wie wir, jetzt über den Satschu-sangpo zu reiten.
Man wird nervös von der Nachtwache und dadurch, daß der Tag ebenso reich an Spannung ist wie die Nacht. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, daß wir unterwegs sind; wir sind bereits mit den ersten Tibetern zusammengetroffen. Unsere Lage wird mit jedem Tage kritischer; unter wechselnden Geschicken und ungewissen Schicksalen entgegen geht unser Weg immer tiefer in dieses geheimnisvolle Land hinein. Wir nähern uns langsam und sicher dem Ziele, aber müde sind wir; ich sehne mich beinahe danach, irgendwie festzusitzen, damit wir ausschlafen können.
Ich glaubte freilich, daß jetzt, nachdem wir zwei schwere Proben, den Räuberüberfall und den Satschu-sangpo, überstanden hatten, das Glück unsere Reise begünstigen und uns Lhasa erreichen lassen müßte. Es war wie in einem Märchen, wo der Held erst durch Feuer und Wasser gehen muß, ehe er den Preis gewinnt und das erträumte Ziel erreicht.
Auch in dieser Nacht rissen sich einige Tiere während meiner Wache los, und es dauerte ziemlich lange, bis sie wieder eingetrieben waren. Meine beiden Reisegefährten lagen in schwerem Schlaf in unserer nassen Höhle. Der Lama ist jedoch guten Mutes und sieht unsere Aussichten in hellem Lichte, was man ihm, der anfangs durchaus nicht mitwollte, wirklich nicht hätte zutrauen können. Schagdur ist ruhig und ernst. Beide sind prächtige Menschen, gerade solche Leute, wie man sie um sich haben muß, um sich sicher zu fühlen, und deren man bedarf, wenn ein derartiges Abenteuer nicht ein Ende mit Schrecken nehmen soll.
In dieser Mitternachtstunde wartete ich keine Minute über 12 Uhr mit dem Wecken, sondern rüttelte Schagdur unbarmherzig wach; er kroch in das Regenwetter hinaus, nachdem er seine Flinte untersucht hatte, während ich in unser klägliches Nest schlüpfte. Er war zu schlaftrunken und ich zu schläfrig, um zu reden; ohne ein Wort auszutauschen, wechselten wir den Platz.
[S. 198]
Der Lama benutzte am 2. August seine Nachtwache, um aus einer Konservendose eine „Lampe“ herzustellen; den Docht drehte er aus einem Seilende, und die Flamme wurde mit Schaffett genährt. Anderes Feuer spendierten wir uns an diesem Morgen nicht. Heute blieben wir merkwürdigerweise während des Marsches vom Regen verschont; der Himmel sah allerdings drohend aus, klärte sich aber gegen Abend auf und ließ die ersehnten Strahlen der Sonne durch.
Unsere armen Tiere sind zu erschöpft, um mehr als 25 Kilometer zurücklegen zu können. Die beiden Pferde sind ganz zu Ende, und zwei Maulesel haben wundgescheuerte Stellen auf dem Rücken.
Die Landschaft war wenig abwechselnd. Wir steigen durch das Tal des Lagerbaches zu einem kleinen Passe hinauf. Rechts von unserem Wege erscheint in einer Entfernung von einigen Kilometern ein schwarzes Zelt, um welches herum etwa 20 Yake und 400 Schafe weiden. Über ein Gewirr von Hügeln gelangen wir wieder auf offenes Terrain, das recht bequem zu überschreiten gewesen wäre, wenn nicht der Regen das Erdreich so aufgeweicht gehabt hätte. Hohe Bergrücken sieht man gar nicht, aber man kann sich darin auch täuschen, weil dunkle Wolken über allen Kämmen schweben.
Vor uns im Südosten unterscheiden wir ganz in der Ferne etwas Schwarzes, dem wir uns langsam nähern. Es stellt sich heraus, daß es eine Yakherde ist, deren Spur wir eine gute Weile gefolgt sind. Als wir näherkamen, fanden wir, daß sie zu einer Karawane gehörte, die auf einem Hügelabhange neben dem Wege lagerte. Um eine unterhalb desselben rieselnde Quelle herum war das Gras gut, und hier hatten sich die 300 Lastyake zerstreut.
Die Männer, 25 an der Zahl, saßen unter freiem Himmel um ihr Feuer herum; Zelte hatten sie nicht. Die Last war in einem Dutzend Haufen aufgestapelt und bestand aus in Sackleinwand eingenähten Ziegelteestücken,[S. 199] die aus der Gegend von Kum-bum nach Taschi-lumpo am Brahmaputra befördert werden sollten. Die Karawane wollte daher bald nach rechts, d. h. nach Süden, von der Straße nach Lhasa, die andauernd die Richtung nach Südosten beibehält, abbiegen. Sie marschiert nur nachts, bei Tag liegt sie still, um die Tiere weiden zu lassen. Das ist gewiß eine ausgezeichnete Art zu reisen, wenn man den Weg kennt und keine Karte zu zeichnen braucht! Eine Schar bissiger Hunde, die uns anfiel, wurde von Jollbars und Malenki auf eine Weise empfangen, die sogar den Besitzern Respekt einflößte. Als wir in größter Ruhe an ihren Teestapeln vorbeiritten, kamen mehrere Leute nach der Straße herunter, um uns genauer zu betrachten, und da hielten wir. Bei allen war der braungebrannte Oberkörper völlig nackt, und der von der Leibbinde festgehaltene Pelz hing vom Rücken herunter. Ihre erste Frage war: „Wie viele seid ihr?“, als wollten sie sich vor allem vergewissern, wer im Falle eines Handgemenges die größte Aussicht hätte, Sieger zu bleiben. Dann fragen sie, ob man Waren zu verkaufen habe, woher man komme, wie lange man unterwegs sei und wohin man wolle, und als sie erfahren, daß wir nach Lhasa gehen, finden sie es ganz natürlich, daß wir nach dem heiligen Orte pilgern. Ich hörte jedoch einen Mann, der seinen nächsten Nachbarn anstieß und dabei auf mich zeigte, das Wort „Peling“ sagen, welches Europäer bedeutet.
Sie sahen wie leibhaftige Strolche aus, und einige von ihnen waren geradezu abschreckende Erscheinungen (Abb. 250, 251, 252). Infolge der schmutzigbraunen Hautfarbe und des üppigen, schwarzen, oft in zwei Flechten herabhängenden Haares erinnern sie an Indianer. Einer von ihnen verstand etwas Mongolisch und fragte gemütlich: „Ämur sän bane?“ (Ist eure Gesundheit gut?). Die meisten blieben bei den Feuern, wo sie, ohne uns die geringste Beachtung zu schenken, als hätten sie schon oft Pilger vorbeiziehen sehen, Tee aus Holzschalen tranken und ihre Pfeife rauchten. Zwei von den anderen forderten uns auf, hierzubleiben und uns zu ihnen zu gesellen. Es war uns aber nicht um solche Nachbarschaft zu tun, und nachdem wir uns einige Minuten mit ihnen unterhalten hatten, ritten wir weiter.
Mein Pferd war jedoch so schlecht, daß es mit den Mauleseln nicht Schritt halten konnte, und nach nur wenigen Kilometern mußten wir daher an einer Quelle auf freiem Feld etwa einen Steinwurf südlich vom Wege Halt machen. Der Weg hatte sich während dieser Tagereise zu einer großen Landstraße entwickelt, deren schlechter Zustand von recht lebhaftem Verkehre zeugte.
Der Abend war herrlich. Die Sonne schien ordentlich heiß, und wir breiteten alle unsere Kleidungsstücke, Pelze und anderen Sachen zum[S. 200] Trocknen aus, wobei eine leichte Süstostbrise half. Das Zelt trocknete am besten in aufgeschlagenem Zustande; die Sattelkissen wurden bald mit der einen, bald mit der anderen Seite in die Sonne gelegt.
Der Lama brachte seine Patentlampe, auf der das Abendessen gekocht werden sollte, in Ordnung. Lange hatten wir jedoch noch nicht gesessen, als wieder ein Gewitter mit betäubenden Donnerschlägen heraufzog, und ein ungeheuer heftiger Hagelschauer das Zelt beinahe zu Boden schlug. Die meisten Donnerschläge riefen einen eigentümlichen, metallischklingenden Ton hervor, der langsam in der Ferne erstarb und dem Klange einer Kirchenglocke glich. Ich habe dergleichen noch nie gehört.
Wir blieben an diesem Abend noch lange auf, plauderten und berieten uns über unsere Lage. Wenn wir nur Gelegenheit hätten, unsere Tiere durch einen ehrlichen Tausch loszuwerden, dann würden wir mit den neuen wieder lange Tagemärsche machen können. Ja, es wäre sogar noch besser, Yake zu haben als unsere erschöpften Maulesel und Pferde, und wir beschlossen, uns bei der nächsten Gelegenheit Yake zu verschaffen.
Während der letzten Tage war in unserer Nähe nichts Verdächtiges vorgefallen, aber der Lama glaubte, daß die Yakjäger den Gouverneur von Nakktschu benachrichtigt hätten, der in diesem Falle sogleich Eilboten in alle Teile seiner Provinz mit dem Befehle schicken würde, daß auf allen nach Lhasa führenden Wegen Ausguck zu halten sei. Kämen wir nur erst in die dichter bewohnten Gegenden, wo die Leute an Pilger gewöhnt seien, so würden wir nicht länger besondere Aufmerksamkeit erregen.
Nachts wurde strenge Wache gehalten, denn die mit mindestens zehn Flinten bewaffnete Eskorte der Teekarawane sah nichts weniger als vertrauenerweckend aus. Hätten sie es gewollt, so hätten sie uns in der Dunkelheit überrumpeln können, und wir wären in verzweifelter Lage gewesen.
Obwohl es im höchsten Grade wünschenswert war, daß wir uns so sehr wie nur irgend möglich beeilten, ehe unser schleichender Zug auffiel, beschlossen wir dennoch, am 3. August in dieser Gegend, welche die Tanguten Amdo-motschu nannten, zu bleiben. Ihrer Meinung nach hatte eine Yakkarawane von hier noch fünf Tagereisen bis Nakktschu und sieben bis Lani-la.
Nach einer ruhigen Nacht wurde ich von meinen Reisegefährten um 9 Uhr geweckt, — es war zu herrlich, einmal wirklich ausschlafen zu dürfen! Sie sagten, die Teekarawane ziehe heran und sei wirklich sehenswert.
Es war auch in der Tat ein höchst origineller, malerischer Anblick. Die Karawane zog in militärischer Ordnung vorbei, und es dauerte eine geraume Zeit, bis die letzten unser Zelt hinter sich hatten. Sie marschierten in verschiedenen Abteilungen von je 30 oder 40 Yaken, und jede solche[S. 201] Gruppe wurde von ein paar Leuten getrieben. Die Yake gingen langsam, mit kleinen, trippelnden Schritten, beobachteten aber eine vorzügliche Ordnung und machten den Leuten, die sie durch scharfe Pfiffe und kurze, abgerissene, gellende Rufe antrieben, nicht allzuviel Mühe. Wenn ein Yak sich von dem Haufen trennte, so brauchte einer der Treiber nur mit dem Arme nach derselben Richtung zu schlagen und einen gellenden Pfiff auszustoßen, um das Tier zu veranlassen, sofort nach seinem Platze im Gliede zurückzukehren.
Im Verhältnis zur Stärke der Tiere waren die Lasten leicht. Alle Männer gingen zu Fuß, und zehn von ihnen trugen Flinten auf der Schulter. Sie waren nicht im geringsten zudringlich. Obwohl sie dicht an unserem Zelte vorbeizogen, guckte doch keiner von ihnen hinein; sie waren ausschließlich damit beschäftigt, die Karawane in Ordnung zu halten.
Der Lama sprach mit einigen von ihnen. Der Abwechslung halber hatten sie auch in der Nacht geruht und sagten, daß nun, da sie Gegenden mit besserem, üppigerem Grase erreicht hätten, die Yake auch nachts weiden könnten, besonders wenn Mondschein herrschte. Sie baten wieder, wir möchten uns doch fertigmachen und mit ihnen nach ihrem nächsten Lagerplatze ziehen.
Es war wirklich interessant, diese wandernde Gesellschaft aus Kum-bum zu sehen, diese Tanguten, die mit den Tibetern eines Stammes sind und auch dieselbe Sprache sprechen. Die ganze Gesellschaft war kohlschwarz, die Yake, die Männer, ihre Kleider, ihre Flinten, ihre Hunde, und sie warfen sogar schwarze Schatten, denn jetzt stand die Sonne am Himmel und beleuchtete den Zug. Ein Schattenspiel, ein Karneval von Dämonen — ihnen stand der Weg offen nach Taschi-lumpos heiligen Tempeln und den Basaren von Schigatse, wo der Tee verkauft werden sollte.
Wir hatten den ganzen Tag vor uns und sollten uns gründlich ausruhen, aber ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte das Bedürfnis, die Sonne zu sehen und mich an der lachenden Landschaft zu erfreuen. Ich saß mehr als leicht gekleidet da und ließ mich vom Sonnenschein trocknen; um 1 Uhr hatten wir +14,6 Grad im Schatten, und die Wärme war fühlbar. Jetzt hatten wir endlich Gelegenheit, alle unsere Habseligkeiten wirklich trocknen zu lassen. Kleinere Sachen wurden auf Pelzen und Mänteln ausgebreitet. Der Lama beschäftigte sich mit seinen Medikamentbeuteln, und es stellte sich heraus, daß er der glückliche Besitzer eines ziemlich großen Beutels mit Rosinen war, den er von Tscharchlik mitgenommen hatte und der erst jetzt zum Vorschein kam. Die Packsättel wurden fleißig umgedreht und trockneten im Laufe des Tages. Die Stiefel wurden mit trockenem, warmem Sand gefüllt, der sie ausspannte und ihnen ihre richtige Form wiedergab.
[S. 202]
Zweimal hatte ich das unbeschreibliche Vergnügen, uns Mittag kochen zu müssen, was con amore geschah; die frischen Fleischstücke wurden in dünne Scheiben geschnitten, die ich in Butter briet, die uns Sampa Singi geliefert hatte, und das mit Käsepulver und Salz gewürzte Gericht schmeckte delikat. Die sauere Milch war leider zu Ende, aber wir hatten zum Nachtisch Tee und Rosinen. Eine Pfeife Virginia schmeckte hinterdrein vorzüglich, und dann streckte man sich wieder in der Sonne aus, den Sattel als Kopfkissen benutzend. Selten bin ich so faul gewesen wie an jenem 3. August 1901.
Schagdur und der Lama schliefen dann und wann. Unsere Tiere grasten so nahe, daß wir sie jeden Augenblick zählen konnten, und wir verloren sie nicht aus den Augen.
Als Kunstkenner bemalte mir der Lama wieder den Kopf vorn und hinten, den ganzen Hals und die Ohren außen und innen. Ich hatte eine kleine Dose mit brauner Farbe, einen Wattebausch und als Spiegel meine Uhrkapsel, so daß ich, wenn es nötig war, den Anstrich selbst auffrischen konnte. Es ist nur ärgerlich, daß, sobald die Haut abblättert, augenblicklich eine rosa Stelle inmitten des orthodoxen Farbentones erscheint, ungefähr als wenn ein Flicken von dem Kleide einer Balldame auf der Nase eines Schornsteinfegers haften geblieben wäre!
Kein Wort Russisch durfte über Schagdurs oder meine Lippen kommen, nur Mongolisch ertönte in unserem Lager, und wir bereiteten uns jetzt auf die Antworten vor, die wir auf eventuelle inquisitorische Fragen geben wollten. Wir waren alle Burjaten aus Sachir und hatten das Land der Chalchamongolen und Zaidam durchreist. Der Lama wollte unter keiner Bedingung für einen Mongolen gelten; er war ein Burjate, und, um nicht von denen, die er früher in Lhasa getroffen hatte, wiedererkannt zu werden, trug er gleich mir eine schwarze Schneebrille und wollte im übrigen allen seinen Bekannten aus dem Wege gehen. Besondere Angst hatte er vor dem Oberlama des Tempels, in welchem er seine Studien betrieben hatte. Würde er erkannt, so glaubte er, daß die Folgen für ihn verhängnisvoll sein würden. Man würde uns umkehren lassen, ihn aber unter dem Vorwand, er sei ein Lama von Lhasa, zurückbehalten und dann als Verräter, der Spione in das verbotene Land geführt habe, bestrafen. Während all der Tage, gleichviel ob wir stillagen oder über unbekannte Berge ritten, plapperte er seine Gebete an die ewigen Götter und unterhandelte mit seinem Gewissen.
Er hegte großes Interesse für das Christentum und bat mich oft, ihm meinen Glauben auseinanderzusetzen; nach seiner Ansicht hatten wir so viele Berührungspunkte, daß ich eigentlich ebenso berechtigt war wie[S. 203] irgendein Buddhist, die Wallfahrt zu machen. Er selbst kannte nichts weiter als die heiligen Bücher Tibets und der Mongolei, und da er mich während unserer Reise mit so vielen Arbeiten, von denen er früher keine Ahnung gehabt hatte, beschäftigt gesehen und beobachtet hatte, wie ich an der Erforschung der Erdrinde arbeitete, die Himmelskörper beobachtete und abends in Büchern las, war er zu dem Schlusse gekommen, daß ich mindestens ebenso gut sei wie ein Lama und daß sie sich in Lhasa freuen könnten, wenn ich sie besuchte. Der Dalai-Lama war allwissend. Er wußte, wer wir waren, mit was für Absichten wir kamen, ja, er wußte, was wir jeden Tag miteinander redeten. Und er würde nicht zulassen, daß mir etwas Böses widerfahre; wie er sich aber zu dem Lama selbst stellen würde, war eine andere Frage. Wenn ich einen allmächtigen Gott hätte, sollte ich ihn doch bitten, daß er, der Lama, Leib und Leben behalten dürfe, da er doch nur meinetwegen mit auf dieses Abenteuer ausgezogen sei. Ich versicherte dem Lama, daß er ganz ruhig sein könne, wir würden zusammenhalten, wohin es auch ginge, und würden ihn nicht im Stiche lassen.
Eine Stunde lang war es finster wie in einem Sacke gewesen, als der Mond aufging und still und freundlich wie ein Engel an dem mit Sternen übersäten Himmelsgewölbe stand. Ich hatte die Wache von 8–11 Uhr, und um 5 Uhr wollten wir aufbrechen. Schweigend und friedlich lag die Gegend da, nah und fern störte kein Laut die Stille. Nur ein paarmal knurrten die Hunde. Der Lama und Schagdur schliefen der Abwechslung halber vor dem Zelte. Je mehr wir uns dem Ziele unserer Reise näherten, desto ruhiger war mir zumute. Es ist leichter, mitten in der Gefahr zu leben, als ihr Eintreten abzuwarten.
Eine Menge kleinerer Bäche in ziemlich offener Gegend überschreitend, zogen wir am 4. August nach Südsüdost weiter. An einem Punkte, wo der Weg sich teilte, blieben wir ratlos stehen, kamen aber bald zu dem Schlusse, daß der linke Weg nach Lhasa, der rechte nach Taschi-lumpo führen müsse. Nachdem wir jedoch eine Strecke auf dem ersteren zurückgelegt hatten, fanden wir, daß er viel zu gerade nach Osten abbog, weshalb wir vermuteten, daß er nach Nakktschu Fuhre und die wahrscheinliche Straße nach Lhasa wieder aufsuchten.
Hier erhielten wir bald die Bestätigung für die Richtigkeit unseres Schlusses. Eine Karawane von 100 Yaken mit leichten Lasten kam, von einem halben Dutzend berittener und bewaffneter Männer getrieben, von Lhasa zurück. Die Männer trugen große, hohe, gelbe Hüte und hatten einige Ziegen und Hunde bei sich. Sie schienen sich vor uns zu fürchten und zogen möglichst schnell an uns vorbei.
[S. 204]
Unsere Maulesel, die sich infolge der guten Weide und des Ruhetages sehr erholt hatten, fanden die Yake entweder so nett oder so komisch, daß sie ihre Gesellschaft der unseren vorzogen; sie machten kehrt und gesellten sich zu der Karawane. Die Yake dagegen waren anderer Meinung. Vermutlich hatten sie noch nie mit Mauleseln Bekanntschaft gemacht; genug, sie galoppierten davon, und ihre Besitzer sowie die Maulesel folgten ihnen auf den Fersen. Auf diese Weise kamen sie vom Wege ab und auf das freie Feld hinaus. Die Tibeter pfiffen, wir schrien und riefen, die Hunde hatten sich in aller Geschwindigkeit in eine heftige Beißerei eingelassen, und die größte Unordnung herrschte auf dem so plötzlich zur Walstatt gewordenen Grasboden. Endlich gelang es uns, die Tiere zu bemeistern und in guter Ordnung zu trennen.
Irgendein böser Geist mußte an diesem Tag in einen unserer Maulesel gefahren sein, der der „Dungane“ hieß, weil er von einem muhammedanischen Chinesen gekauft war. Ohne sich irgendwie von den Yaken stören zu lassen, lief er draußen auf der Ebene im Kreise umher, bis alles, was er trug, am Boden verstreut lag und sein Packsattel hinter ihm her schlenkerte. Die Sachen wurden gesammelt, und er wurde wieder beladen; als sich aber dasselbe Manöver noch zweimal wiederholte, mußte das muntere Tier am Stricke geführt werden. Nach der Ruhe hatte auch mein Reitpferd sich erholt und legte seine 34½ Kilometer gut zurück. Der Lama saß schläfrig im Sattel und machte die komischsten Verbeugungen; ich erwartete jeden Augenblick, ihn auf der Erde liegen zu sehen, aber er verlor das Gleichgewicht nicht.
Das Wetter ist wunderschön, und nach zweitägigem Sonnenbrand ist die Erde wieder trocken und unser Gepäck bedeutend leichter geworden.
Der Weg führt jetzt zu einem niedrigen, bequemen Passe hinauf, der sich durch ein Steinmal (Obo) aus Sandsteinplatten mit der Inschrift „Om mani padme hum“ auszeichnet. Der Boden ist überall unterhöhlt von den Löchern und Gängen kleiner Feldmäuse, wodurch das Reiten erschwert wird und die Pferde leicht stolpern. Man verabscheut diese verwünschten Tierchen, die ihr dreistes Untergraben der Straße manchmal mit dem Leben bezahlen müssen. Die Hunde jagen sie unverdrossen. Malenki frißt sie mit Haut und Haar, während sich Jollbars damit begnügt, sie im Genick zu packen und hoch in die Luft zu schleudern.
Auf beiden Seiten des Passes ritten wir an mehreren, von Yak- und Schafherden umgebenen schwarzen Zelten vorbei. Da sich jedoch keine Menschen zeigten, hielten wir uns nicht weiter auf. Wir erreichten ein offenes, in ziemlich weiter Ferne von Bergen umschlossenes Kesseltal. Aus einem der dort stehenden Zelte kam ein alter Mann heraus; mit ihm[S. 205] verhandelte der Lama eine Weile. Verkaufen oder Vermieten von Pferden kam überhaupt nicht in Frage, der Geizhals wollte uns nicht einmal Milch überlassen. Er habe allerdings sehr viel davon, erklärte er, aber verkäuflich sei sie nicht, er brauche sie selbst.
Der Weg wird immer breiter und kräftiger ausgeprägt. Aber es ist merkwürdig, daß wir nie einzelnen Wanderern oder Reitern begegnen. Man scheint hierzulande nur in großen, hinreichend starken Gesellschaften zu reisen. Das Gras ist vortrefflich, und man sieht jetzt auf allen Seiten Yake, Schafe und Pferde in zerstreuten Herden, die von ihren Hirten bewacht werden.
Die Zelte wurden immer zahlreicher und sahen aus der Ferne wie schwarze Punkte aus; an einer Stelle lagen vierzehn beisammen. Vor jedem Zelte sieht man gewöhnlich einen großen Haufen Yakdung zur Feuerung für den Winter; manchmal ist er auch schichtweise ausgebreitet, um ordentlich zu trocknen.
Links lassen wir einen ganz kleinen See liegen, an dessen Ufer sich die große Teekarawane von gestern niedergelassen hat. Die Männer waren nicht zu sehen; sie hatten sich wahrscheinlich nach den Zelten der Nomaden begeben, um zu plaudern, zu rauchen und Tee zu trinken.
Um nicht zu sehr von Neugierigen überlaufen zu werden, setzten wir unseren Weg noch eine Stunde fort und ließen uns dann in der Nähe eines aus vier Zelten bestehenden Dorfes nieder.
Nach einem der Zelte lenkte der Lama seine Schritte und kam mit einem Stücke Fett und einem „Domba“ (mongolischer Napf) voll sauerer Milch wieder, wofür er eine chinesische Porzellantasse gegeben hatte. Unterdessen hatten wir Besuch von einem jungen Tibeter, der außerordentlich freundlich und mitteilsam war und ununterbrochen schwatzte, obwohl wir kein Wort verstanden.
Der Lama mußte als Dolmetscher dienen. Unser ungebetener Gast gab sich als ein Bewohner von Amdo zu erkennen, und sein Dialekt unterschied sich wesentlich von der Sprache von Lhasa. Er nannte uns die Namen der nächsten Berge, aber ich möchte nicht für die Zuverlässigkeit seiner Angaben einstehen. Einen See, der sich im Südosten zeigte, nannte er Tso-nekk, den „schwarzen See“, was uns wenigstens wahrscheinlich erschien, denn dieser Name kommt in ganz Innerasien häufig vor, z. B. in den Formen Kara-köll, Chara-nur usw. Der Weg, dem wir gefolgt waren, teilte sich gerade hier in die Straßen nach Lhasa und nach Taschi-lumpo. Ein anderer, östlicherer Weg vereinigte sich mit der großen Pilgerstraße nach Lhasa.
Wir sehnten uns danach, den Fremdling loszuwerden, da wir ihn für einen Spion hielten, der beauftragt war, uns in der Nähe zu beobachten.[S. 206] Als uns dies nicht gelang, mußte der Lama ihn unterhalten, während Schagdur und ich das Zelt zumachten und zu Mittag aßen. Erst in der Dämmerung konnte er sich entschließen zu gehen. Er hatte sein Pferd grasen lassen und mußte es jetzt wieder einfangen, aber das wollte ihm durchaus nicht gelingen. Soweit wir mit dem Fernglase sehen konnten, lief das Pferd nach Süden weiter, und der Mann trabte unverdrossen hinterdrein. Auf unsere Frage, ob hier in der Gegend Räuber hausten, antwortete er: „Für uns Tibeter gibt es keine, aber für euch, die ihr so weit her seid, ist keine Sicherheit.“
Die Nachtluft war so still, daß ich während meiner Wache das Licht in der Zelttür brennen lassen konnte. Von den nächsten Zeltdörfern ertönte Hundegebell. Der Himmel war halbklar, und der Mond schien teilweise.
Am Montag, 5. August, ritten wir 34 Kilometer nach dem Lager Nr. 53. Es ging nach Südsüdost, und bald kamen wir an das Westufer des Tso-nekk, wo hier und dort mehrere schwarze Zelte und große Viehherden zu sehen waren. Der Weg ging über drei Pässe.
Auf einer ziemlich ausgedehnten, überall von Bergen, die namentlich im Süden und Südosten ziemlich hoch waren, umgebenen Ebene, auf der wir zwölf schwarze Zelte zählen konnten, machten wir Halt. Bis hierher sollten wir gelangen, aber nicht weiter! Wir waren gerade 270 Kilometer vom Hauptquartier entfernt, wo die Unseren mittlerweile wahrscheinlich in größter Unruhe über unser Schicksal schwebten.
Auf dem Ritte hatten wir uns darüber gewundert, daß unser Vorbeiziehen nirgends Aufmerksamkeit erregt und niemand sich uns genährt und uns angeredet hatte. Vor mehreren Zelten saßen Tibeter am Feuer, und Kinder spielten mit Lämmern und jungen Hunden. Auch hier an dem kleinen Bache, wo das Zelt aufgeschlagen wurde, zeigten sich keine Neugierigen. Wir fühlten uns völlig ungeniert, und es war uns natürlich viel lieber, von prüfenden Blicken und beobachtenden Besuchen verschont zu bleiben. Ich selbst hätte allerdings unsere Nachbarn gern in ihren Zelten besucht, hielt es aber für klüger, dies zu unterlassen.
Nach gründlichem Rasieren, Einfetten und Schminken und nach eingenommenem Mittagsessen legte ich mich schlafen. Bei Einbruch der Dunkelheit kam Schagdur, weckte mich und teilte mir mit, daß sich drei Tibeter im Zwielicht unserem Lager näherten. Der Lama und er gingen ihnen entgegen, während ich zurückblieb. Es war ganz dunkel geworden, ein leichter Sprühregen fiel, und der Himmel war bewölkt, ich konnte beim besten Willen weder unsere Tiere noch die Männer unterscheiden.
Meine Begleiter blieben lange fort, und ich fing beinahe schon an, mich ihretwegen zu beunruhigen, als Schagdur endlich zurückkehrte. Er[S. 207] war ruhig wie immer, aber schon, daß er mich auf russisch anredete, zeigte, daß er der Überbringer ernster Nachrichten war.
„Es sieht schlimm für uns aus!“ sagte er. „Ich verstand kein Wort von dem, was geredet wurde, hörte aber unaufhörlich die Worte Schwed-peling, Tschanto (Muselmann), Burjate und Lhasa durcheinander. Sie sitzen jetzt und reden, der Lama weint beinahe, ist außerordentlich demütig und verbeugt sich unausgesetzt.“
Dann eilte der Lama, aufgeregt und erschüttert, zu uns. Er mußte sich erst eine Weile beruhigen, ehe er sprechen konnte, und dann kam es stoßweise heraus, in zitterndem Ton und in abgebrochenen Sätzen.
Einer der drei Männer war, nach der Kopfbedeckung zu urteilen, ein „Noijin“ (Häuptling, Offizier). Er war höflich aufgetreten und recht liebenswürdig gewesen, hatte aber doch in streng befehlendem, bestimmtem Tone, der keinen Widerspruch duldete, gesprochen. Sein Blick aber war, wie der Lama sagte, tückisch gewesen.
Der Häuptling hatte berichtet, es sei vor drei Tagen bekannt geworden, daß ein „schwedischer Europäer“ (Schwed-peling) nach Lhasa unterwegs sei, und einige Yakjäger, die kürzlich in Nakktschu eingetroffen seien, hätten erzählt, daß eine Menge stark bewaffneter Europäer, Besitzer einer großen Karawane, von Norden über die Gebirge zögen.
Nun waren dem Lama tausend Fragen um die Ohren gehagelt. Ob er etwas von diesen Europäern wisse, ob einer von ihnen unter uns sei, wieviele wir selbst seien, wieviele Tiere wir hätten, ob wir Waffen besäßen; woher wir seien, wohin wir gingen, weshalb wir diesen versteckten Weg gewählt hätten, der von Mongolen sonst nie eingeschlagen werde. „Rede nur die Wahrheit“, hatte es geheißen, und „Wie kannst du, ein Lama, diese unbekannten Fremdlinge begleiten?“
Darauf hatte der Lama erwidert, der Amban von Kara-schahr habe ihm befohlen, der europäischen Karawane bis Ladak als Dolmetscher zu dienen. Die Karawane sei neun Tagereisen von hier im Gebirge liegengeblieben, und wir drei Pilger hätten die Erlaubnis erhalten, während die Tiere sich kräftigten, Lhasa zu besuchen.
Der Häuptling hatte in betreff des Hauptquartiers sehr genaue Fragen gestellt, und der Lama hatte korrekte Auskunft erteilt, da er es für möglich gehalten, daß bereits alles ausspioniert sei. Er hatte erzählt, wieviele Lasttiere wir hatten und daß uns dort drei Europäer und vierzehn Muselmänner erwarteten.
Der Beschluß des Häuptlings hatte gelautet: „Ihr bleibt morgen hier! Ich komme dann in euer Zelt, und wir werden miteinander reden. Ich werde für einen mongolischen Dolmetscher sorgen, der mit den beiden[S. 208] anderen sprechen kann. Braucht ihr Lebensmittel oder Pferde und Yake, so werden wir das morgen besprechen.“
Es war schon spät, und wir saßen, nachdem wir unsere Pferde und Maulesel wie gewöhnlich festgebunden hatten, noch lange in eifrigem Gespräch an dem im Zelte brennenden Feuer. Zunächst bereiteten wir uns auf das uns morgen bevorstehende Verhör vor; Schagdur bestand mit großer Energie darauf, daß der Lama dann nur als Dolmetscher sprechen solle.
Was mich am meisten interessierte, war, zu erfahren, woher sie das Wort „Schwed-peling“ hatten. Es war denkbar, daß durch die englischen Zeitungen in Indien irgendein Gerücht nach Tibet gedrungen sein konnte. Aber „Schwed“ konnte nichts anderes sein als das russische „Schwed“, Schwede. Sollte die große mongolische Pilgerkarawane, die im Herbst 1900 unser Hauptquartier in Temirlik passierte, dieses Wort aufgeschnappt haben? Damals hatte nicht einmal einer der Kosaken eine Ahnung von meinen Plänen gehabt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die Mongolen, die mit Schagdur und Tscherdon in ihrer eigenen Sprache gesprochen, sich erkundigt hatten, ob ich ein Russe oder ein Engländer sei, und die Antwort erhalten hatten, ich sei ein „Schwed“, welches Wort sich nicht ins Mongolische übersetzen ließ. Diese Pilger haben alles, was sie erfahren hatten, in Lhasa gemeldet, wohlwissend, daß ihnen jede Warnung vor ungebetenen Gästen zum Verdienst gereichen würde. Die Yakjäger, die wir beim Lager Nr. 38 getroffen, hatten die Meldung von dem Vorhandensein und Herannahen der europäischen Karawane bestätigt.
Eine dritte Möglichkeit ist, daß der Lama während des abendlichen Gesprächs mit dem Häuptling derjenige gewesen sein kann, der sich zuerst dieser Bezeichnung bedient hat, — es war das erste und sicher auch das letzte Mal in meinem Leben, daß ich nicht stolz darauf gewesen bin, ein Schwede zu heißen! In solchem Falle war der Lama ein Verräter, und Schagdur sagte mir auch, daß er unter keiner Bedingung auf ihn bauen würde. Sein Benehmen während der Unterredung sei ihm zu sonderbar vorgekommen, und seine Reden hätten die ganze Zeit über einen zustimmenden Eindruck gemacht.
Allerdings war das Ganze eine mysteriöse Sache. Gewiß ist, daß ihnen das Wort „Schwed“ auf irgendeine Weise zu Ohren gekommen war, aber ohne daß sie wußten, was es bedeutete. Es wurde jedoch durch das Wort „Peling“ verdeutlicht, welches Europäer heißt und wohl von dem persischen „Fereng“ oder „Ferengi“ ins Tibetische übergegangen sein mag.





Ich konnte mit dem besten Willen nicht die Überzeugung gewinnen, daß der Lama ein Verräter sei. Ich konnte es weder damals noch später. Der kleine Schein von Verdacht, der einen Augenblick auf ihn fiel, verschwand[S. 209] bald, und ich ließ ihn nie auch nur mit einem Worte ahnen, daß von solchem Verdacht überhaupt die Rede gewesen war. Vielleicht bewies er mir dafür während der langen Reise bis Astrachan eine Anhänglichkeit und Treue, die danach strebte, einen Augenblick der Schwäche abzubüßen und die Erinnerung an eine Feigheit auszulöschen, die mich bloßgestellt hatte, ihm aber einen Rückzug sicherte?
Eine Sache sprach durchaus zu seinen Gunsten, und das war, daß es ebensosehr in seinem eigenen wie in unserem Interesse lag, die Kette von Wachtposten und Spähern, die alle von Norden nach Lhasa führenden Wege bewachte, incognito zu durchbrechen. Denn wurden wir entdeckt und festgenommen, so war seine Lage viel schlimmer als die unserige. Hielt ich es für geraten, die Maske zu lüften und mich als Europäer zu erkennen zu geben, so würde keiner es wagen, mich auch nur anzurühren, aber der Lama, der wissentlich einen verkleideten Europäer begleitet hatte, würde hierfür zur Verantwortung gezogen und vielleicht zu Tode gemartert werden. Daher glaube ich nicht, daß er uns den Tibetern preisgegeben hat.
Daß man uns vor dem Abend des 5. August schon erwartete, ist höchst wahrscheinlich. Bei einem Zelte hatte ein Mann gefragt, ob wir unterwegs Europäer gesehen hätten, und einer von den Leuten der Teekarawane hatte mich ja einfach „Peling“ genannt.
Die Stunden vergingen, und meine Nachtwache schrumpfte zu kurzer Zeit zusammen. Ich freute mich wirklich, daß ich einen Ruhetag vor mir hatte und daß unsere unsichere Lage jetzt ein Ende nehmen würde. Daß uns etwas bevorstand, war klar; aber was? Wenn je, so waren wir jetzt mitten in einem Abenteuer, und jetzt sollten wir unser Urteil hören.
Da wir auf allen Seiten so viele Nachbarn hatten, meinten wir, uns einigermaßen gegen einen Überfall gesichert fühlen zu können, aber — keiner konnte wissen, was das für Leute waren, und einstweilen war es noch das Klügste, die Augen offenzuhalten. Die Tiere blieben daher festgebunden, und der Wachtdienst wurde gewissenhaft verrichtet.
Die ganze Nacht bellten die Hunde in den Nomadenlagern ringsumher. Der Lama glaubte, daß die Nomaden von Zelt zu Zelt gingen, von uns und unserer Ankunft sprachen und sich auf etwas vorbereiteten. An mehreren Stellen sah man Feuer durch das nächtliche Dunkel lodern.
[S. 210]
Am 6. August sollte sich unser Schicksal entscheiden. Schon gleich nach Sonnenaufgang besuchten uns drei Tibeter, aber andere als die gestrigen Inquisitoren. In gebührender Entfernung banden sie ihre Pferde, indem sie ihnen mit einem Stricke die Vorderbeine zusammenschnürten, nahmen dann am Feuer Platz und stopften ihre Pfeifen mit hellem, trockenem, feinkörnigem Tabak von wenig aromatischem Duft. Ihr eigentliches Anliegen schien Untersuchung meiner Augen zu sein, denn sobald ich mich zwischen zweien von ihnen niedergelassen hatte, baten sie mich, meine schwarze Brille abzunehmen. Nun hatten sie wohl gedacht, daß alle Europäer blond sein und blaue Augen haben müßten, denn sie konnten ihre Verwunderung darüber, daß meine Augen ebenso rabenschwarz waren wie ihre eigenen, nicht unterdrücken. Sie waren sichtlich „betroffen“, nickten mir freundlich zu und sprachen schnell und eifrig miteinander.
Ihre Bitte, unser Arsenal sehen zu dürfen, wurde mit dem größten Vergnügen bewilligt, da unsere Waffen ihnen ohne Zweifel imponieren würden. Schagdur beschrieb sein Magazingewehr, und ich den Offizierrevolver. Als wir ihnen zeigten, wie die Patronen eingeschoben wurden, schüttelten sie den Kopf und baten uns, unsere Mordwaffen wegzulegen.
Bald darauf hielten sie es für das Sicherste, sich zurückzuziehen. Doch teilten sie uns vorher noch mit, daß es von hier bis Lhasa eine Reise von drei Monaten sei, — um uns gründlich vom Weiterziehen abzuschrecken, möglicherweise aber auch in der Hoffnung, daß wir dadurch bewogen würden, freiwillig umzukehren. Ich bat den Lama, ihnen zu sagen, daß es uns nicht eingefallen sei, uns darüber Auskunft zu erbitten, da wir im Lande reichlich so gut Bescheid wüßten wie nur einer von ihnen (Abb. 253). Sie gingen langsam, vorsichtig und — rückwärts zu ihren Pferden und führten diese, bis sie sich außer Schußweite glaubten; anscheinend waren sie der Meinung, daß wir unsere Flinten an ihnen erproben würden.
Dann wurden wir eine halbe Stunde in Ruhe gelassen. Hierauf erschienen vier Männer, die sich unserem Zelte zu Fuß näherten. Drei[S. 211] von ihnen hatten langes schwarzes Haar, sahen schmutzig aus und waren mit Säbeln und Pfeifen versehen, der vierte aber war ein hochgewachsener, kurzgeschorener, grauhaariger Lama in rotem Gewande mit gelber Mütze. Er machte den Eindruck eines wackeren Mannes; eines solchen bedurften wir gerade unter den jetzigen mißlichen Verhältnissen zur Verhandlung. Er musterte mich durchaus nicht mit indiskreten Blicken und erlaubte sich keine dreisten Fragen. Das einzige, was er wissen wollte, war die Stärke unseres Hauptquartiers, und darüber wurde ohne Umschweif Bericht erstattet.
Der alte Mann, der ein erfahrenes, respektables Aussehen hatte, erklärte mit verblüffender Sicherheit:
„Ihr müßt drei oder höchstens fünf Tage hierbleiben. Heute früh haben wir Kuriere an den Gouverneur von Nakktschu geschickt und angefragt, ob ihr weiterreisen dürft oder nicht. Als Antwort auf unser Schreiben trifft entweder ein Brief mit Verhaltungsbefehlen ein oder Kamba Bombo, der Gouverneur, kommt selbst, und bis dahin seid ihr in jedem Falle unsere Gefangenen. Es würde uns das Leben kosten, wenn wir euch hier durchließen und es sich nachher herausstellte, daß ihr Leute seid, die zu der Reise nach Lhasa nicht berechtigt sind. Der Gouverneur von Nakktschu ist unser nächster Vorgesetzter, dem wir zu gehorchen haben, und wir müssen seine Befehle einholen.“
Mein Vorschlag, durch einen besonderen Kurier in Lhasa anfragen zu lassen, wurde verworfen, da es einen Monat dauern könne, bis die Antwort käme. Ebensowenig Lust hatten sie, auf meinen Vorschlag, daß wir selbst nach Nakktschu reiten könnten, einzugehen. Wahrscheinlich sagten sie sich, daß wir, einmal in Freiheit, Nakktschu vermeiden und nach Lhasa weiterreiten würden. Alle Unterhandlungen waren unnötig; sie wußten, was ihnen zu tun oblag, und wir waren in ihrer Gewalt.
Daß wir zu der großen Karawane, die von Norden gekommen war, gehörten, war ihnen klar, ebenso erkannten wir deutlich, daß sie damit bereits vertraut waren und uns nur auf die Glaubwürdigkeit unserer Aussagen prüfen wollten.
Inzwischen kaufte uns der Alte eine Teetasse ab und teilte uns mit, daß uns alles, dessen wir bedürften, zur Verfügung gestellt werden würde.
Im Laufe des Gesprächs erwähnte der Greis seinen Rang als Lama, was unserem guten Schereb Lama sichtlich außerordentlich imponierte, denn er erhob sich, drückte seine Handflächen gegeneinander und berührte die Stirn des Alten mit der seinen. Von beiden Seiten wurden die gebräuchlichen Höflichkeitsbezeigungen beobachtet und mit Versicherungen von Freundschaft und Achtung nicht gegeizt. Nach einer Weile entfernten sich auch diese Gäste.
[S. 212]
Jetzt glaubten wir, daß man uns für heute in Frieden lassen werde; doch schon nach ein paar Minuten ereignete sich etwas, das uns mit der größten Unruhe erfüllte. Von allen Seiten versammelten sich bei dem kleinen Zeltlager, das einen Kilometer von dem unsrigen aufgeschlagen war, kleine Gruppen von Reitern, die bis an die Zähne mit Spießen, Lanzen, Säbeln und langen, schwarzen Gabelflinten bewaffnet waren (Abb. 254). Einige trugen hohe, weiße Filzhüte mit Krempen, andere dunkle Binden, und alle waren sie in Mäntel gehüllt, die braun, rot, schwarz oder grau waren. Sie sahen wie richtige Banditen aus, waren aber entschieden Soldaten, die mobilgemacht wurden, um das südliche Tibet gegen unseren drohenden Einfall zu verteidigen. Woher kamen sie, wie hatten sie so schnell bereit sein können? Sie schienen wie Pilze aus der Erde zu schießen; es wurde ganz schwarz um die Zelte herum, und wir konnten eine Kavallerietruppe von 53 Mann zählen. Sie berieten sich unter lebhaften Gesten, saßen ab, schlugen ein großes, weißes Zelt auf und ließen sich in einzelnen Gruppen an den Feuern nieder, uns drei arme Pilger schienen sie aber nicht weiter zu beachten.
Mit der größten Spannung beobachteten wir sie durch das Fernglas. Der Lama war sehr niedergeschlagen und glaubte, man habe die Absicht, uns umzubringen. Freilich kamen wir uns einer solchen Übermacht gegenüber begreiflicherweise alle drei recht ohnmächtig vor, aber ich glaubte doch, daß es, falls wirklich die Absicht uns zu töten vorlag, hierzu nicht eines so großen Truppenaufwandes bedürfte und es sich überdies auch viel besser durch einen nächtlichen Überfall bewerkstelligen ließe.
Der Tag war regnerisch und rauh, und manchmal verhüllten Nebel und Regen die Aussicht. Wir wunderten uns und besprachen uns über die Bedeutung der Maßnahmen der Tibeter. Wie als Antwort auf unsere Fragen führten sie jetzt eine Bewegung aus, die nicht geeignet war, uns zu beruhigen. Nachdem sieben Reiter in schnellem Trab nach Osten, wahrscheinlich nach Nakktschu, und zwei nach der Seite von Lhasa fortgeritten waren, sprengten die übrigen in dichtem Haufen über die Ebene des Kesseltales gerade auf unser Zelt los. Einen Augenblick sah ich unsere Lage wirklich für mehr als kritisch an. Wir hielten daher unsere Waffen bereit und saßen oder standen am Eingange unseres Zeltes. Die Tibeter schwangen ihre Lanzen und Speere über dem Kopfe und heulten wie die Wilden (Abb. 255); sie stürmten einher wie zu einem Reiterangriff, die Hufe der Pferde klappten auf dem durchnäßten Boden, und der Schmutz spritzte von der rasenden Bewegung nach allen Seiten. Einige Männer schwangen ihre Säbel und schienen Kommandorufe auszuteilen.
[S. 213]
Die Schar war nicht mehr weit vom Zelt entfernt, als die Reiter ihre Pferde herumwarfen, teils nach rechts, teils nach links, um in zwei Gruppen nach dem Ausgangspunkt zurückzukehren. Dasselbe Manöver wurde ein paarmal wiederholt, und einige kleinere Gruppen umkreisten unseren Lagerplatz. Es lag entschieden die Absicht vor, uns gebührenden Respekt einzujagen, was uns um so klarer wurde, als sie wieder absaßen und mit ihren langen schwarzen Gabelflinten nach der Scheibe zu schießen begannen.
Um 2 Uhr wurde uns noch eine Vorstellung gegeben. Die Tibeter saßen wieder auf, wickelten sich in ihre Mäntel und ritten, während der Regen in dicken Strahlen auf die Erde fiel, nach Nordwesten, d. h. nach der Seite, von der sie gekommen waren. Jetzt wurde ich wirklich unruhig und fürchtete, daß sie beabsichtigten, das Hauptquartier zu überfallen, während wir von ihm abgeschnitten waren, und ich empfand große Sehnsucht, zu den Unsrigen zurückzukehren.
Nachdem das Feld geräumt war und wir wenigstens in unserer unmittelbaren Nähe wieder Ruhe hatten, tauchten zwei Nomaden auf, die uns vom nächsten Zeltdorfe Fett und saure Milch brachten und erklärten, daß ihr Häuptling ihnen verboten habe, sich dafür bezahlen zu lassen. Als wir ihnen eine Porzellantasse schenken wollten, sagten sie, daß sie das Geschenk ohne Erlaubnis des Häuptlings nicht annehmen könnten, kamen aber später mit dem Bescheid wieder, daß ihm der Tausch recht sei.
Auf diese Weise sorgten unsere Nachbarn den ganzen Tag für unsere Unterhaltung. Die letzten und ausdauerndsten waren jedoch vier Männer, die uns gegen 3 Uhr besuchten. Einer von ihnen war ziemlich frech und untersuchte alle umherliegenden Sachen. Dabei kam ein Kompaß zum Vorschein, der bei ihm großes Interesse erregte. Er fragte, was das sei, und erhielt eine genaue Beschreibung, wobei er sagte:
„Freilich, freilich, solche haben die Chinesen auch.“
Ein paarmal zeigte er auf mich und erklärte:
„Der da ist kein Burjate.“
Er war außergewöhnlich zudringlich und fragte, wie es komme, daß wir diese kleine Seitenstraße eingeschlagen hätten, statt dem großen Pilgerwege zu folgen.
„Wißt ihr nicht, daß es euch den Kopf kosten kann, daß ihr diesen Weg gegangen seid? Alle, die auf diesem Wege nach Lhasa gehen, werden hingerichtet.“
Der Lama versuchte die Situation zu retten, indem er erklärte, daß wir die große Karawane vom Lop-nor an begleitet hätten und es[S. 214] unsere Absicht sei, von hier nach Lhasa zu gehen. Der Mann erwiderte darauf, daß nur der Gouverneur von Nakktschu die Erlaubnis dazu erteilen könne.
Im übrigen waren sie freundlich und ungezwungen und versprachen uns morgen allerlei Lebensmittel zu schenken. Als wir diese lästigen Spione gar nicht loswerden konnten, gingen wir ins Zelt und legten uns schlafen. Aber nicht einmal das half. Der Himmel war wieder dunkel und die Wolkendecke dichter geworden, und als wieder ein Platzregen herabströmte, krochen sie alle vier in das Zelt, wo wir es selbst unter gewöhnlichen Verhältnissen ziemlich eng hatten. Erst in der Dämmerung gingen sie ihrer Wege.
Der Regen stürzte hernieder, mit Hagel und Schnee untermischt. Der Boden war da, wo das Zelt stand, ein wenig abschüssig, und ein kleiner Bach bildete sich zwischen den Zeltstangen längs der Filzdecke, auf der ich lag. Wir mußten in die Nässe hinaus und Kanäle graben, um nicht ganz überschwemmt zu werden.
Wir saßen dann noch bis 10 Uhr plaudernd und rauchend bei unseren Holznäpfen mit saurer Milch. Ein kleines Talgflämmchen verbreitete ein schwaches Licht in unserer ungemütlichen Wohnung. Eintönig schlug der Regen auf das Zelttuch. Draußen war es so finster wie in einem Sack, und die Hunde waren verdrießlich über das schlechte Regenwetter. Infolge der Versicherungen des alten Lamas ließen wir unsere Tiere diese Nacht ohne Aufsicht draußen umherlaufen. Ich sagte mir, daß keiner Lust haben würde, uns der Möglichkeit zu berauben, das Land zu verlassen; es lag ja in ihrem eigenen Interesse, uns möglichst schnell loszuwerden. Doch als er uns angeboten hatte, vier Wächter vor unser Zelt zu stellen, hatten wir uns für solche Auskundschafterei bedankt. In weiterer Entfernung wurden wir jedoch von — wie wir später hörten — 37 Wachtposten bewacht! Nachts sah man, besonders auf dem Wege nach Lhasa, die Lagerfeuer derselben schwach durch den Regennebel leuchten.
Jetzt schliefen wir alle drei gleichzeitig, ohne uns um die Tiere oder den Regen zu kümmern. Die Müdigkeit infolge des forcierten Rittes machte sich geltend. Ich wurde bei Tagesanbruch durch das Stimmengewirr der ersten heute zu Besuch kommenden Tibeter geweckt. Im Laufe des Tages (7. August) kamen sie gruppenweise, so daß wir kaum eine halbe Stunde allein sein konnten. Beständig tauchen neue Gesichter auf, und selten kommt derselbe Mann zweimal. Es ist, als würde die Wache beständig abgelöst. Nur der Dreiste von gestern machte uns auch heute einen Besuch und schenkte uns einen Napf voll saurer Milch, einen Sack voll trocknen, vortrefflichen Argols und einen Blasebalg, der uns besonders nötig war.
[S. 215]
Ein anderer Tibeter blieb volle drei Stunden bei uns, trank Tee und aß Tsamba mit uns, rauchte und tat, als sei er hier zu Hause. Sein Gesicht war von einem förmlichen Urwalde schwarzer, zottiger Haarsträhnen ohne eine Spur von Ordnung umgeben. Die „Locken“, die die Augen verdecken, sind gestutzt und tragen keineswegs zur Verschönerung des Ganzen bei; ein Teil des Nackenhaares ist jedoch in einen Zopf geflochten. Dieser ist unten mit einem mit Perlen oder gefärbten Steinen besetzten Bande zusammengebunden und mit einem oder mehreren „Gavo“ oder Götzenbilderfutteralen geschmückt. Beim Reiten wird der Zopf um den Kopf oder Hut gewunden.
Dieser Mann, der nicht wieder gehen wollte, verriet uns zu deutlich, daß er ein Spion war, der den Auftrag erhalten hatte, uns in der Nähe zu beobachten. Er war aufrichtig genug, uns zu bitten, über Nacht nicht durchzubrennen, da es ihm sonst das Leben kosten würde. Nach Lhasa seien es noch fünf Tagereisen, sagte er. Doch gibt es dorthin entschieden auch eine organisierte reitende Post mit Pferdewechsel, denn wir machten später ausfindig, daß ein dorthin gesandter Eilbote in zwei Tagen Antwort brachte, also einen Tag bis Lhasa und einen Tag von Lhasa gebraucht hatte. Das Tal, in dem wir uns befanden, hieß Dschallokk und der uns im Westen zunächstliegende Berg Bontsa.
Als der lästige Gast uns endlich verlassen hatte, um nach seinem Zeltdorfe zurückzukehren, begegnete er drei Reitern, die sich wohl eine halbe Stunde mit ihm unterhielten. Sie fragten ihn sicher darüber aus, was für Beobachtungen er habe machen können und was für Fragen wir an ihn gerichtet hätten. Sie machten sich daher nicht mehr die Mühe, uns ebenfalls zu besuchen, sondern kehrten wieder um, nachdem sie unsere Maulesel und Pferde nach einem anderen Weideplatze getrieben hatten. Frühmorgens konnten wir unsere Tiere nicht finden, aber vormittags kamen sie wieder ins Lager, wahrscheinlich von irgendeinem entfernteren Platze, wohin man sie für die Nacht gebracht hatte. Vermutlich sollte uns dadurch, daß man die Tiere nachts von uns entfernt hielt, jegliche Möglichkeit zum Entfliehen genommen werden.
Unter den heutigen Gästen war ein langhaariger Greis, dem die anderen mit einer gewissen Achtung begegneten. Er redete viel und gern und wurde mit der größten Aufmerksamkeit angehört. Der Lama fing einiges von seinen zur Hälfte geflüsterten Reden auf.
„Diese drei Männer“, sagte er, „sind nicht von der allerbesten Sorte; nach Lhasa dürfen sie natürlich nicht. Kamba Bombo kommt in zwei, drei Tagen, und dann wird man ja sehen. Inzwischen müssen wir dafür sorgen, daß es ihnen an nichts fehlt; alles, was sie brauchen, soll ihnen geschenkt[S. 216] werden, und keiner darf Bezahlung annehmen. Wenn sie zu entfliehen suchen, sei es bei Tag oder bei Nacht, sollen die Wächter es mir sofort melden. Amgon Lama hat die heiligen Bücher befragt und gefunden, daß diese Männer zweideutige Persönlichkeiten sind, die nicht nach Lhasa dürfen. Der Jäger Ondschi hat sie vor langer Zeit im Gebirge in der Gegend von Merik-dschandsem gesehen und gesagt, die Karawane sei bedenklich groß. Nachricht hiervon wurde sogleich nach Lhasa geschickt.“
„Glaubte Amgon Lama, daß der da ein Burjate ist?“ fragte einer, auf mich zeigend.
„Er sagte, daß er dies nicht feststellen könne“, antwortete der Alte.
Jede Auskunft von seinen Lippen beantworteten die anderen mit „Lakso, lakso“, welches Wort Ehrfurcht, Gehorsam und Folgsamkeit ausdrückt. Unser armer Lama Schereb gebraucht es unausgesetzt, wenn er mit den Tibetern redet, vor denen er fast zittert und mit denen er in einem weinerlichen, unterwürfigen Tone spricht. Er sieht unser Schicksal in den allerschwärzesten Farben und befürchtet das Schlimmste.
Auch heute streiften Reiter in der Gegend umher. Bald kamen sie an, bald ritten sie fort. Die größte Schar zählte 10 Mann. Es hatte entschieden eine vollständige Mobilmachung stattgefunden. Einer unserer Gäste gestand aufrichtig ein, daß sie gegen unser großes Lager im Gebirge gerichtet sei. Ein anderer sagte, es seien nur Patrouillen und Kundschafter, die das Land zu bewachen und aufzupassen hätten, daß sich keine Feinde einschlichen. Um uns selbst war ich nicht im geringsten in Sorge, wohl aber des Hauptquartieres wegen. Wären wir nicht die Gefangenen der Tibeter gewesen, so hätte ich dorthin zurückkehren mögen, um eventuell zu seiner Verteidigung beizutragen.
8. August. Die ganze Nacht regnete es in Strömen. Ich erwachte halb erstickt von dem gräßlichen Rauche, der das Zelt füllte, durch dessen Tuch die Regentropfen wie feiner Sprühregen drangen. Der Morgen war naßkalt und die Luft wie in einem Keller. Und dabei sollte noch Brot gebacken werden! Fort mit dem Zelttuch und frische Luft hereingelassen, wenn es auch noch so sehr regnet! Recht bequem ist es, daß man sich bloß aufzurichten braucht, um gleich fertig zu sein; ein weiteres Toilettemachen kommt überhaupt nicht in Frage. Eine dicke Rußschicht hat sich auf dem Fette, mit dem mein Gesicht zuletzt eingerieben worden ist, abgelagert.

Die Visiten wurden in gewohnter Weise fortgesetzt und stellten unsere Geduld auf die Probe. Zuerst erschienen fünf Leute mit einem Schafe und fragten, ob wir sonst noch etwas wünschten. Wir bestellten Fett, Butter, süße und sauere Milch und erhielten sofort alles in viel größeren Mengen, als wir bewältigen konnten, selbst wenn wir uns von den Hunden helfen[S. 217] ließen. Sie fragten uns, ob unser großes Lager auch nahe genug bei einem Nomadenlager liege, so daß die Unseren alles, was sie an Proviant brauchten, erhalten könnten. Dies klang wenigstens beruhigend, und ich begann wieder daran zu zweifeln, daß die Mobilmachung unserem Hauptquartier gelte. Ferner war die Nachricht gekommen, daß Kamba Bombo von Nakktschu und Nanso Lama unterwegs seien und morgen hier eintreffen würden.
Darauf begann das Kreuzverhör von neuem, aber jetzt erklärte ich rund heraus, daß sie sich gefälligst gedulden möchten, bis Kamba Bombo angelangt sei; er solle alles erfahren, was er zu wissen brauche, sie jedoch gehe es gar nichts an, wer wir seien. Wenn sie nicht aufhörten, uns tagtäglich mit denselben dummen, zudringlichen Fragen zu überhäufen, würden wir sie künftig nicht mehr ins Zelt hineinlassen. Da verbeugten sie sich ganz verdutzt, murmelten ihr höfliches „Lakso“ und schwiegen. Der Lama erklärte, daß sie fürchterlichen Respekt vor mir hätten. Ich kam mir ungefähr vor wie Karl XII. in der Türkei. Wir waren in ein fremdes Land eingedrungen, ein lächerlich kleiner Haufe gegen eine erdrückende Übermacht. Die Tibeter verhinderten uns, dorthin zu gehen, wohin wir wollten, zugleich aber war es ihnen darum zu tun, uns möglichst schnell wieder loszuwerden. Wir waren gleichzeitig ihre Gäste und ihre Gefangenen, und sichtlich war höheren Ortes Befehl erteilt worden, daß wir mit größter Rücksicht behandelt werden sollten und uns kein Leid zugefügt werden dürfe. Nur der Lama war düster und schwermütig. Er erinnerte sich ganz genau Kamba Bombos von Nakktschu, der die mongolische Pilgerkarawane, mit welcher der Lama nach Lhasa gereist war, so gründlich untersucht hatte. Wenn Kamba Bombo ihn wiedererkennen sollte, sei er verloren, und auch im entgegengesetzten Falle sei sein Schicksal mehr als ungewiß. Er erzählte von einem mongolischen Lama, der durch irgendein Vergehen sein Recht, die heilige Stadt zu besuchen, verwirkt habe und der, um sein Vergehen abzubüßen, von Da-kuren (Urga) nach Lhasa — in Gebetstellung, d. h. auf den Knien, gerutscht sei. Er habe sich mit den Händen auf die Erde gestützt, die Knie nachgezogen, die Hände weiter gesetzt, und so habe er die ganze lange Reise gemacht, zu der er sechs Jahre gebraucht habe! Und als er nur noch eine Tagereise vom Stadttore entfernt gewesen sei, habe ihm der Dalai-Lama das Betreten der Stadt untersagt, und unverrichteter Dinge habe er wieder umkehren müssen. Der Lama sagte noch, daß der Mann seinen Bußgang auf den Knien, die schließlich hart und hornig wie die Liegeschwielen der Kamele geworden seien, noch zweimal wiederholt habe, aber das Herz des Dalai-Lama doch nicht erweicht worden sei.
„Und wie“, fügte er hinzu, „wird es mir jetzt ergehen, da ich mich versündigt habe, indem ich mit euch hierhergekommen bin? Wenn sie mich[S. 218] auch am Leben lassen, so ist doch meine Laufbahn zu Ende, und ich darf Lhasa nie wiedersehen.“
Ein paar hundert Meter südlich von uns wurde heute ein Zelt aufgeschlagen, in welchem der Spion von gestern, Ben Nursu, wie er uns selbst offenherzig mitgeteilt hatte, künftig residieren sollte, um uns unter Augen zu haben.
Um die Mittagszeit sahen wir 15 Reiter nach Süden sprengen; wir nahmen an, daß sie dem Kamba Bombo, der wahrscheinlich nicht mehr sehr weit entfernt sein konnte, entgegenritten.
Nach Tisch schliefen wir ein paar Stunden und wurden wenigstens da in Ruhe gelassen. Schlafen, Essenkochen, Speisen und Milchtrinken sind eigentlich das einzige, womit wir während unserer unfreiwilligen, die Geduld auf die Probe stellenden Gefangenschaft die Zeit totschlagen können. Wir liegen, dehnen uns und schlummern, wir entfernen uns keine 50 Schritt vom Zelte, wir sitzen stundenlang vor der Zeltöffnung und beobachten die Tibeter, ihr Tun und Lassen, ihre schwarzen Zeltdörfer und ihre Herden. Wir sehnen uns danach, daß die Zeit vergehe und Kamba Bombo komme, aber eigentlich ist es ein Trost, daß wir nicht in diesem ewigen Regen zu reiten brauchen, wo es überall kalt, rauh, grau, naß und dunkel ist.
Beständig tauchen neue, unbekannte, neugierige Gesichter um uns herum auf. Der einzige wirkliche Stammgast in unserem Zelte ist Ben Nursu, der beinahe bei uns wohnt und mit uns ißt. Dafür muß er sich aber auch nützlich machen; er muß Leben ins Feuer blasen, wenn es regnet. Es kommt beinahe nie vor, daß uns jemand besucht, ohne etwas Eßbares mitzubringen. Sie nehmen sich unserer mit rührender Fürsorge an. Wie man sagt, geschieht dies auf besonderen Befehl des Dalai-Lama. Die Behörden in Lhasa erhalten ganz gewiß täglich Bericht aus unserem Lager. Die Reiter, die aus jener Richtung kommen und dorthin reiten, sind Kuriere und Eilboten. Wir erfuhren auch, daß die Lebensmittel, die wir von den Nomaden erhalten, ihnen später aus Lhasa ersetzt werden. Auf dieselbe Weise wird bei einer Mobilmachung verfahren. Die Soldaten sind berechtigt, sich alles, was sie wollen, von den Nomaden zu nehmen, und diese erhalten dafür Entschädigung aus der Hauptstadt. Wir hatten also durch unseren friedlichen Zug den Tibetern entsetzlich viel Mühe gemacht, und Dschallokk war gewissermaßen ein militärischer Knotenpunkt geworden. Es wimmelte hier von Stafetten, Spionen, Kundschaftern und Kurieren. Das Land erhob sich wie zur Verteidigung gegen einen feindlichen Einfall. Man würde uns nicht geglaubt haben, wenn man erfahren hätte, wie unschädlich wir selbst und wie wenig böse unsere Absichten waren.
[S. 219]
Gegen 2 Uhr guckte die Sonne eine Weile hervor und warf ihren grauen Schleier ab, der übrigens zu der Situation gut paßte. Sieben Tibeter leisteten uns am Feuer im Freien Gesellschaft. Während wir in eifrigster Unterhaltung waren, erschien im Südosten eine Reiterschar. Sie ritt schnell gerade auf das Zelt los.
„Ha“, riefen die Männer, „da haben wir den Bombo von Nakktschu!“
Wir erhoben uns und erwarteten die Fremden; als sie jedoch näherkamen, sahen unsere Gäste, daß es nicht der Gouverneur selbst war, sondern nur sein mongolischer Dolmetscher in Begleitung von vier Häuptlingen aus der Nachbarschaft mit ihrem Gefolge.
Der Dolmetscher war ein geborener Tibeter, und sein Mongolisch war bedeutend schlechter als meines, aber er war ein angenehmer, heiterer Mensch und nicht im geringsten zudringlich. Er erzählte, daß, sobald die Nachricht von unserer Ankunft nach Nakktschu gelangt sei, Kamba Bombo ihm befohlen habe, hierher vorauszureiten, der Gouverneur selbst werde aber so schnell wie möglich nachkommen. Im Nu saß der arme Dolmetscher im Sattel und ritt mit seinen Begleitern Tag und Nacht in strömendem Regen nach Dschallokk. Hier rasteten sie nicht einmal bei den Zelten der Tibeter, sondern begaben sich direkt zu uns.
Jetzt begann das Verhör wieder, und zum zwanzigsten Male mußten wir das Hauptquartier und seine Besatzung ausführlich beschreiben. Trotzdem sie ohne Zweifel durch Spione über die Karawane unterrichtet waren, war es schwer, die Neuangekommenen dahin zu bringen, daß sie unseren Worten glaubten. Sie bildeten sich ein, daß unser Hauptquartier nicht unsere ganze Stärke ausmache, sondern nur der Vortrab sei, dem Tausende von Soldaten folgen würden. Diese Furcht verdrängte alle kritischen Spekulationen in betreff meiner wirklichen Nationalität. Der Dolmetscher sagte, es spiele gar keine Rolle, woher und von welchem Stamme wir seien; nach Lhasa dürften wir unter keinen Umständen reisen, sondern müßten von hier nach unserem Hauptquartiere im Gebirge zurückkehren. Zuleide werde uns jedoch nichts getan werden, denn in dieser Beziehung habe der Dalai-Lama seine Befehle gegeben.
Jetzt begannen Schagdur und ich auf Mongolisch derart zu predigen, daß dem armen Dolmetscher die Ohren gellten. Wir sagten, der Dalai-Lama habe Burjaten, die auf russischem Gebiete wohnen, nie verboten, die Wallfahrt nach Lhasa zu machen. Es könne Kamba Bombo den Kopf kosten, wenn er sich unterstehe, uns an der Weiterreise zu verhindern. Ihn holen zu lassen, sei ganz unnötig, da wir auf jeden Fall nur mit einem hohen Beamten aus Lhasa verhandeln würden.
Alles, was wir sagten, übersetzte der Dolmetscher seinen Kameraden,[S. 220] die mit ernster Miene zuhörten. Von Rußland und Indien hatten sie sehr dunkle Begriffe, und was von der Macht und Größe dieser Reiche gesagt wurde, imponierte ihnen nicht im geringsten.
Schließlich gingen wir darauf ein, daß ein Kurier an Kamba Bombo geschickt werde, um ihn zu ersuchen, sich zu beeilen, — aber nur unter der Bedingung, daß gleichzeitig ein Eilbote nach Lhasa abgehe. Der Dolmetscher war in jeder Beziehung ein Gentleman, nur darin nicht, daß er unaufhörlich um Branntwein bat, eine Ware, die unsere Kisten nicht enthielten. Wir sagten ihm, wir seien hier in ein merkwürdiges Land geraten, wo friedliche Reisende nicht einmal vor Räuberüberfällen sicher seien. Er schien von dem Pferdediebstahl zu wissen und versicherte, der Wert der Tiere werde uns zu unserer völligen Zufriedenheit ersetzt werden und wir hätten nur zu befehlen, falls wir etwas wünschten. Wir hätten gesagt, daß zwei Europäerhäuptlinge in unserem Hauptquartier seien, und er bitte um ihre Namen. „Sirkin und Tschernoff“, antworteten wir; die Namen wurden aufgeschrieben. Als er aber nach unseren Namen fragte, wurde ihm der Bescheid, daß ihn dies gar nichts angehe und wir nur mit vornehmeren Herren verhandeln würden.
Nachdem sie uns endlich verlassen hatten, blieben wir wie gewöhnlich noch lange sitzen und sprachen über die Tageserlebnisse und die Aussichten für die nächste Zukunft, die für den Lama nicht besonders gut waren. Um unsere Tiere bekümmerten wir uns nicht mehr. Sie waren bei den Tibetern gewissermaßen in Pension, und wir sahen sie gar nicht.
Am 9. August herrschte wieder Leben und Bewegung in unserem offenen Kesseltale. Eine Menge Reiter und Patrouillen zogen nach Südwesten die nächsten Berghöhen hinauf und trieben die Herden dorthin. Von allen Seiten ertönte Geschrei und Pferdegetrappel, das Blöken der Schafe und das verdrießliche Grunzen der Yake. Von den Zelten unserer Nachbarn ritten kleine Reiterscharen nach Nakktschu und nach Lhasa. Es gelang uns nicht zu ergründen, was alles dieses bedeutete; es hatte den Anschein, als beabsichtigten die Nomaden, ihre Wohnsitze nach anderen Weidegründen zu verlegen, aber Schereb Lama, der hier alles in schwarzem Lichte sah, glaubte, daß sie das Feld räumten, um freien Spielraum zu haben, wenn der große, vernichtende Reitersturm gegen unser Zelt gerichtet würde.
Um 10 Uhr erschien unser Freund, der Dolmetscher, von drei anderen Männern begleitet. Wir baten ihn, diese fortzuschicken, um mit ihm über verschiedene wichtige Angelegenheiten verhandeln zu können. Hiergegen protestierte er aber auf das Bestimmteste; es war ihm wohl unheimlich, mit so zweideutigen Personen allein zu sein. Er hatte übrigens, wie er sagte, einen besonderen Auftrag auszurichten und würde uns, sobald dies geschehen,[S. 221] verlassen. Er teilte uns mit, daß Kamba Bombo von Nakktschu mit großem Gefolge angekommen sei und uns zu sehen wünsche.
Ein ganzes Zeltdorf erhob sich ein paar Kilometer von uns entfernt auf der Straße nach Lhasa (Abb. 256). Eines der Zelte hatte bedeutende Dimensionen; es war glänzend weiß und oben blaugestreift; die anderen, die es umgaben, waren kleiner, und von mehreren von ihnen stiegen Rauchsäulen auf. Um das „Dorf“ herum schwärmten Massen von Reitern. Der Lama konnte das Fernglas nicht von seinen Augen nehmen und sich nicht von diesem großartigen Anblicke losreißen; unablässig starrte er dorthin und war augenscheinlich eine Beute immer größer werdender Unruhe.
Der Auftrag des Dolmetschers bestand darin, uns in Kamba Bombos Namen einzuladen, uns mit Sack und Pack in seiner unmittelbaren Nachbarschaft anzusiedeln und heute bei dem mächtigen Gouverneur ein Gastmahl einzunehmen. In einem der Zelte tische man bereits die Gerichte auf. In der Mitte stehe ein ganzes gebratenes Schaf, umgeben von Schalen für Tee und Tsamba, und bei unserer Ankunft würden wir jeder mit einer „Haddik“ beehrt werden, mit einer dünnen, hellen Binde, welche Mongolen und Tibeter vornehmen Gästen als Ehrfurchtsbezeugung überreichen.
Auf diese Einladung antwortete ich, ohne mich einen Augenblick zu bedenken, daß wenn Kamba Bombo eine Spur von Manier besitze, es seine Pflicht sei, uns erst einen Besuch zu machen, bevor er uns zum Gastmahl einlade; überdies hätten wir noch nie von ihm gehört und wüßten gar nicht, ob er überhaupt das Recht habe, uns gegenüber als zuständige Behörde aufzutreten. Er werde sich wohl nicht einbilden, daß wir seiner Aufforderung, unseren Lagerplatz zu wechseln, gehorchten; wenn ihm daran liege, uns als Nachbarn zu haben, so stehe es ihm frei, seine Zelte in unserer Nachbarschaft aufzuschlagen. Wir wollten nichts von ihm und hätten nicht nach ihm geschickt; wünsche er uns zu sehen und mit uns zu sprechen, so sei es ihm unbenommen, jederzeit unser Zelt zu besuchen. Während der Tage, die wir in Dschallokk zugebracht, hätten wir hinsichtlich der Dreistigkeit der Tibeter viel zu gründliche Erfahrungen gemacht, um uns freiwillig zu Nachbarn von Kamba Bombo und seinem Gefolge zu machen. Wir seien friedliche Fremdlinge aus dem Norden, die das Recht hätten, die Wallfahrt zu machen, und jetzt wünschten wir nur zu erfahren, ob uns der Weg nach Lhasa offenstehe oder nicht; wenn nicht, würden wir sofort nach unserem Hauptquartier zurückkehren, und Kamba Bombo selbst habe die Verantwortung für die Folgen zu tragen.
Mit allem diesen und noch mehrerem wurde der arme Dolmetscher traktiert, der in seiner unangenehmen Unterhändlerstellung, die er bekleidete, sich wie ein Wurm wand. Er bat und flehte und bediente sich seiner[S. 222] ganzen Überredungskunst, aber wir blieben unbeweglich. „Das Gastmahl ist bereitet, und man erwartet euch; wenn ihr nicht kommt, trage ich die Schuld, falle in Ungnade und werde verabschiedet.“ Er bestürmte uns über zwei Stunden; als ich jedoch meinen Entschluß nicht änderte, erhob er sich, um aufs Pferd zu steigen. Noch im Sattel bat er, wir möchten uns doch besinnen, und versicherte, daß uns kein Leid widerfahren werde. Ich antwortete ihm nur, es sei uns vollkommen gleichgültig, welchen Bescheid er dem Bombo zu bringen gedenke, aber zum Gastmahl kämen wir nicht, und beliebe es dem Gouverneur nicht, uns eine Visite zu machen, so werde er keinen Schimmer von uns zu sehen bekommen. Da grüßte der Dolmetscher zum Abschied und ritt zu den Zelten zurück.
Es mag den Anschein haben, als sei diese Antwort auf eine freundliche Einladung ebenso arrogant wie unhöflich und als hätten drei arme Pilger sich einem so mächtigen, vornehmen Gouverneur gegenüber einen solchen Ton nicht erlauben dürfen. Denn er war es, der in Nakktschu (auch Nagtschu; der Ort liegt am Flusse gleichen Namens, der mit dem oberen Saluen gleichbedeutend ist) residierte und dessen Pflicht es war, alle Karawanen zu untersuchen und alle Reisenden, Pilger und Wanderer, die sich Lhasa auf der großen Straße von Zaidam und über Tang-la nähern, zu visitieren. Jetzt, da wirklich Gefahr im Anzug zu sein schien und eine große europäische Karawane sich näherte, mußte er, um nicht sein Amt und vielleicht auch das Leben zu verlieren, seine Autorität nachdrücklich wahren. Ganz gewiß hatte er auch durch besondere Kuriere von Lhasa Befehl erhalten, seinen Posten auf einige Tage zu verlassen und sich nach Dschallokk zu begeben, um dort die Sachlage genau zu untersuchen.
Tatsächlich war es auch nicht reiner Oppositionsgeist, der unsere Antwort so unfreundlich ausfallen ließ. Aber ringsumher hatte die ganze Zeit über Kriegsstimmung geherrscht, die Tibeter waren mobil gemacht und hatten ihre Streitkräfte gesammelt, und ich meinerseits würde ihnen verziehen haben, wenn sie über unser Unterfangen, das ja darauf ausging, sie zu überlisten, böse geworden wären. Keiner hätte es ihnen verdenken können, wenn sie erklärt hätten: „Hier ist ein Europäer, der sich als Burjate verkleidet hat, um nach Lhasa zu gelangen, und hier ist ein Lama, der seine Studien in Lhasa gemacht hat und jetzt als Führer des ersteren auftritt; laßt uns ein für allemal ein Exempel statuieren und den beiden zeigen, daß solche Versuche übel ablaufen!“ Noch am 9. August ahnten wir nichts von unserem Schicksal; das einzige, was man uns mit absoluter Sicherheit gesagt hatte, war, daß man uns unter keinen Umständen erlauben würde, uns nach der Hauptstadt zu begeben. Jetzt grübelten wir auch darüber nach, ob die heutigen Vorbereitungen und die Unruhe, die unter den Tibetern geherrscht[S. 223] hatte, etwas Besonderes zu bedeuten hätten. War die Einladung ein Versuch, uns in eine Falle zu locken? Zu einem Gastmahl geht man unbewaffnet; sollten die Tibeter nur einen Vorwand suchen, um uns von unseren Waffen, vor denen sie gehörigen Respekt hatten, zu trennen? Wenn es wirklich ihre Absicht war, uns nicht lebendig aus der Gefangenschaft kommen zu lassen, so wollten wir wenigstens erst die fünfzig scharfen Patronen, die wir bei uns hatten, benutzen. Es waren schon Europäer in Tibet verschwunden — zuletzt Dutreuil de Rhins und Rijnhard — wenn auch nicht so nahe bei Lhasa, wie wir uns jetzt befanden. Ein verkleideter Europäer mußte noch viel größeren Gefahren ausgesetzt sein; denn sollten die Tibeter hinterher je zur Rechenschaft gezogen werden, so konnten sie mit vollem Recht sagen. „Wir haben nicht gewußt, daß er ein Europäer war; er sagte selbst, er sei ein Burjate.“
Von diesem Gesichtspunkte aus hielt ich unsere Lage für ziemlich unsicher, obgleich mehrere unserer neuen Freunde uns versichert hatten, daß wir für Leib und Leben nichts zu fürchten hätten. Da ich mich aber keinen Augenblick bedacht hatte, mein Leben einer so großen Gefahr inmitten eines den Europäern feindlich gesinnten Volkes auszusetzen, da ich das Abenteuer bis auf die Spitze getrieben hatte und so weit gegangen war, wie es überhaupt möglich war, wollte ich das Spiel auch auf ehrenvolle Weise beenden!
Unseren eigenen Betrachtungen überlassen, saßen wir ein paar Stunden am Feuer und tauschten unsere Ansichten über die kritische Lage aus. Keine Menschen zeigten sich in unserer Nähe, nur in dem Zeltdorfe des Gouverneurs herrschte Leben und Bewegung; dort wurde augenscheinlich über uns Rat gehalten. Aber was sagte man, in welcher Richtung gingen die Beschlüsse? Wir ahnten, daß eine Entscheidung nahe bevorstand. Vielleicht hatte unsere unhöfliche Antwort Kamba Bombo beleidigt, und er schickte sich jetzt an, uns eine ordentliche Lektion zu geben. Es war ein entsetzlich unbehagliches Warten; ich erinnere mich dieser langen Stunden, als wäre es gestern gewesen.
Zwei volle Stunden waren vergangen, als es um die weißen Zelte wieder lebendiger wurde; es gab ein Laufen und Hinundherreiten, die Tibeter bewaffneten sich und stiegen zu Pferd. Ein ganzer Wald von Reitern sprengte in einer schwarzen Linie auf uns los (Abb. 257). Es regnete nicht, und wir konnten dieses in Wahrheit prächtige Schauspiel ungestört genießen. Sie näherten sich in schnellem Tempo, die Pferde liefen in starkem Galopp. Ein undeutliches Sausen ertönt, bald unterscheidet man das schnelle Aufschlagen der Pferdehufe. Wir hatten das Gefühl, als stürze eine Lawine auf uns herab, um uns im nächsten Augenblick zu[S. 224] begraben. Die Gewehre und der Revolver lagen geladen bereit, wir aber standen vor dem Zelt, und keiner sollte die Unruhe ahnen, die sich unserer bemächtigt hatte.
Die Tibeter ritten in einer Linie heran. In der Mitte ritt der Gouverneur auf einem großen, schönen Maulesel; sonst ritten alle Pferde. Er war von seinem Stabe begleitet, der aus Militär-, Zivil- und geistlichen Beamten in prachtvollen Festgewändern bestand. Die Flügel bildeten Soldaten, die bis an die Zähne mit Gewehren, Säbeln und Lanzen bewaffnet waren, als handle es sich um einen Feldzug gegen einen feindlichen Stamm. Wir konnten 67 Mann zählen.
Jetzt trennten sich einige Reiter von der Schar, erhöhten die Geschwindigkeit und gewannen einen Vorsprung von einigen Minuten, dann saßen sie ab und grüßten. Einer von ihnen war unser Freund, der Dolmetscher, der nur anmeldete, daß Kamba Bombo uns in höchsteigener Person mit einem Besuche beehre. Als dieser in der Nähe des Zeltes anhielt, sprangen einige des Gefolges aus dem Sattel und breiteten auf der Erde einen Teppich aus, auf dem der Gouverneur abstieg. Dann nahm er auf gleichfalls bereitgehaltenen Kissen und Decken Platz, und Nanso Lama, ein vornehmer Priester aus Nakktschu, setzte sich neben ihn.
Jetzt ging ich ruhig zu ihm heran und bat ihn, ins Zelt zu treten, wohin er sich sofort begab und wo er nach einigem Zieren den Ehrenplatz — auf einem nassen Maissack — unter unseren übelriechenden, beinahe schimmeligen Effekten annahm. Er sah listig und schelmisch aus, blinzelte mit den Augen und lächelte oft. Er mochte 40 Jahre alt sein, war klein und bleich, sah abgezehrt und müde, aber doch entzückt aus, daß er uns jetzt endlich in der Falle hatte; er wußte ganz genau, daß er in Lhasa großen Ruhm ernten würde, wenn er seinen geschickten Schachzug dorthin berichtete.
Sein Anzug war geschmackvoll und elegant; er hatte ihn entschieden eigens für die Visite angelegt, denn er war ganz neu und fleckenlos. Die Überkleider, einen großen roten Radmantel und ein rotes Baschlik, nahmen ihm die Diener ab. Nachdem dies geschehen war, präsentierte er sich in einem kleinen blauen chinesischen Käppchen und in einem weitärmeligen Gewande von schwerer gelber Seide; er trug grüne mongolische Samtstiefel und war mit einem Wort wie zu einem Feste geschmückt.
Nun wurde dem Kamba Bombo ein Tintenfaß, Feder und Papier gebracht, worauf das Verhör begann. Für uns interessierte er sich weniger als für das Hauptquartier und die Stärke der Karawane. Alle Antworten notierte er selbst, denn er sollte einen ausführlichen Bericht nach Lhasa schicken. Dann wurden unsere Habseligkeiten untersucht, aber merkwürdigerweise[S. 225] sprach er nicht einmal den Wunsch aus, unsere Kisten besichtigen zu dürfen. Die Mitteilung, daß sie Proviant enthielten, genügte ihm vollständig. Über mich schien er ganz im reinen zu sein und er hielt es sogar für überflüssig, mir persönliche Fragen vorzulegen. Schagdur gebärdete sich, als er gefragt wurde, wie ein Feldmarschall; er sei russischer Untertan, aber auch Burjate und berechtigt, nach Lhasa zu reisen. Die russischen Behörden würden es als eine Beleidigung betrachten, wenn man uns friedliche Pilger hindere, die Wallfahrt zu machen; niemand, wer es auch sei, dürfe uns antasten. Doch Kamba Bombo erwiderte lachend:
„Du glaubst, mir Furcht einjagen zu können; ich tue meine Pflicht, gerade hinsichtlich eurer habe ich meine Befehle vom Dalai-Lama erhalten und weiß selbst am besten, was ich zu tun habe. Nach Lhasa dürft ihr nicht reisen, nicht einen Tag mehr in dieser Richtung, nein! Einen Schritt weiter, — und es kostet euch den Kopf!“ (Titelbild zum 2. Band.) Und dabei fuhr er mit der flachen Hand, die er wie eine Klinge hielt, um den Hals herum. Und er fügte hinzu, daß es ihm selbst ebenfalls ans Leben gehen würde, wenn er uns durchließe:
„Es ist ganz einerlei, wer ihr seid und woher ihr kommt, aber ihr seid im höchsten Grade verdächtig; ihr seid auf einem Schleichweg hierhergekommen und ihr sollt nach eurem Hauptlager zurückkehren.“
Wir sahen ein, daß hiergegen nichts zu machen war. Schagdur erzählte nun von dem Pferdediebstahl. Anfangs machte Kamba Bombo Ausflüchte und sagte, er sei für das, was außerhalb der Grenzen seiner Provinz passiere, nicht verantwortlich. Schagdur erwiderte:
„So, dies ist also nicht euer Land; ist es denn vielleicht russisches Gebiet?“ Da wurde aber Kamba Bombo ärgerlich und erklärte, daß das ganze Land dem Dalai-Lama gehöre. Schagdur war nachher sehr stolz auf seine Erwiderung. Nun erhob sich der Gouverneur, nahm Schagdur mit und setzte sich draußen auf den Kissen nieder; nach einer Weile wurde ich zu ihm gerufen. Er sei bereit, sagte er, uns zwei neue Pferde zu besorgen, eines davon müsse ich aber bezahlen. Ich lachte ihm gerade ins Gesicht und ging wieder ins Zelt hinein, nachdem ich ihm geantwortet hatte, daß wir derartige Geschenke nicht annähmen: entweder zwei Pferde oder gar keins. Da versprach der Bombo, daß er uns am folgenden Morgen zwei Pferde für die gestohlenen schenken würde.
Schließlich erklärte Kamba Bombo, daß wir aufbrechen könnten, wann wir wollten, daß er jedoch Dschallokk nicht eher zu verlassen gedenke, als bis wir fort seien. Um keine Zeit zu verlieren, beschlossen wir, den Rückweg schon am folgenden Morgen anzutreten. Eine besondere Eskorte sollte uns bis zur Grenze am Satschu-sangpo begleiten, und als wir, um nicht[S. 226] der Tiere wegen nachts Wache halten zu müssen, darum baten, von der Eskorte bis ins Hauptquartier gebracht zu werden, versprach er uns dies. Während der Reise sollte uns alles, was wir an Proviant brauchten, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auch jetzt schenkte uns Kamba Bombo eine ganze Menge nützliche Eßwaren.
Im großen ganzen war er sehr freundlich und artig und gar nicht ärgerlich darüber, daß er durch uns Arbeit und Mühe gehabt und selbst hatte hierherreiten müssen. Er war ein rechtlich denkender und handelnder Mensch und wußte genau, was er wollte. Wer ich war, ist ihm wohl nie völlig klar geworden; doch muß er wohl geglaubt haben, daß hinter meiner abgetragenen mongolischen Tracht etwas Außergewöhnliches verborgen sei, sonst wäre er schwerlich mit solchem Pompe und Hofstaate angezogen gekommen. Mit China stehen die Tibeter beständig in Berührung; ihr Land ist nominell ein Vasallenstaat jener Macht, die in Lhasa einen Vertreter und ein „Yamen“ hat, welches in der Nähe von Potala, dem Tempelpalaste des Dalai-Lama, liegt. Ohne Zweifel hatten die Behörden in Lhasa Kenntnis von allem, was kürzlich in China geschehen war, und wußten, wie schwer der Mord des deutschen Gesandten von Ketteler in Peking bestraft worden war. Sie mochten sich daher sagen, daß es klüger sei, sich nicht an einem Europäer zu vergreifen.
Während der Unterhaltung drängten sich die anderen Tibeter um uns und machten ihre Bemerkungen und Beobachtungen. Sie trugen Säbel in reich mit Silber beschlagenen Scheiden, die mit Korallen und Türkisen besetzt waren, Gavo (Amulettfutterale) von Silber, Armbänder, Rosenkränze, bunte Schmucksachen in ihren langen Zöpfen und waren entschieden mit dem Feinsten, was sie anzuziehen hatten, ausstaffiert. Die Vornehmeren trugen große, weiße Hüte mit Federn, andere Binden um den Kopf, die gemeinen Soldaten gingen barhäuptig.
Schereb Lama war von all dieser Pracht ganz überwältigt. Er lag vornübergebeugt auf den Knien, starrte auf die Erde und konnte sich nicht entschließen, dem Blicke Kamba Bombos zu begegnen, als dieser ihn scharf verhörte. Er gab kurze, hastige Antworten, als ob er kein Geheimnis mehr zu wahren hätte. Was er sagte, verstanden wir nicht, denn sie sprachen tibetisch. Nachher sagte er uns, daß der Bombo ihm schwere Vorwürfe darüber gemacht habe, daß er uns begleitet habe, da er doch habe wissen müssen, daß Europäer in Lhasa nicht geduldet würden. Sein Name sei in die Tempelbücher eingetragen, und er werde nie wieder die Erlaubnis erhalten, das Gebiet der heiligen Stadt zu betreten! Versuche er, sich dort mit einer Pilgerkarawane einzuschleichen, so werde es ihm schlimm ergehen. Er sei seiner Priesterwürde untreu geworden und sei ein Verräter!
[S. 227]
Zuletzt schlug ich Kamba Bombo noch vor, ich wolle selbst mit Hilfe des Lamas und des Dolmetschers einen Brief an den Dalai-Lama aufsetzen, der uns, wenn er erfahre, wer wir seien, gewiß mit Vergnügen empfangen würde; der Bombo aber antwortete, dies sei ganz unnötig, da er ja seine Befehle über unsere Behandlung täglich direkt von Lhasa erhalte; auch könne er sich in seiner Stellung nicht erlauben, dem Dalai-Lama Ratschläge zu geben; dies würde ihm im besten Falle sein Amt kosten.
Darauf sagte er artig Lebewohl, schwang sich in seinen reichgeschmückten Sattel und ritt, von seinem großen Stabe gefolgt, schnell davon. Die Dämmerung hatte sich schon auf die Gegend herabgesenkt, die Reiterschar entschwand bald unseren Blicken und mit ihr meine Hoffnung, das Mekka des Lamaismus zu schauen! Hell glänzten die Sterne über Lhasa, kein Lüftchen regte sich an diesem stillen Abend, nur dann und wann hörte man in der Ferne einen Hund bellen.
[S. 228]
An diesem Abend saßen wir noch lange plaudernd in unserem Zelt. Der Lama war wortkarg und niedergeschlagen, aber Schagdur und ich waren vergnügt. Allerdings war uns unser Versuch, Lhasa zu erreichen, mißlungen, aber wir hatten doch immerhin die Befriedigung, das Abenteuer bis auf seine äußerste Spitze getrieben zu haben. Wenn man auf unüberwindliche Hindernisse stößt, ist es Zeit, umzukehren, und man kann dies mit gutem Gewissen tun. Seltsam war es aber, daß uns die Tibeter ohne ein unfreundliches Wort aus der Gefangenschaft freigaben.
Am Morgen des 10. August befahlen wir unseren nächsten Wächtern, unsere zwei Pferde und fünf Maulesel nach dem Zelte zu treiben, denn wir hatten beschlossen, den Rückzug diesen Morgen anzutreten. Ohne Abschied konnten wir uns nicht auf den Weg machen, aber von Kamba Bombos Zelten kamen keine Boten. So beschloß ich denn, allein dorthin zu reiten, obwohl Schagdur und der Lama mich warnten und meinten, wir müßten wie bisher beisammenbleiben.
Ich ritt also in langsamem Trab zwischen den Sümpfen hindurch nach Kamba Bombos weißblauem Zeltdorfe. Als ich den halben Weg zurückgelegt hatte, wurde ich von einer aus etwa zwanzig Mann bestehenden Schar bis an die Zähne bewaffneter Reiter umringt. Sie sagten kein Wort, sondern ritten schweigend vor und hinter mir. Ungefähr einen Kilometer vor den Zelten machten sie Halt und bildeten einen Ring um mich, dann saßen sie ab und gaben mir zu verstehen, daß ich dasselbe tun solle.
Kaum eine Viertelstunde brauchten wir zu warten, bis sich dieselbe große Reiterschar wie gestern vom Zeltplatze aus in Bewegung setzte und sich uns im Galopp näherte. In der Mitte ritt wieder Kamba Bombo in seinem gelben Gewande. Ein Teppich und Kissen wurden auf der Erde ausgebreitet, und er lud mich ein, neben ihm Platz zu nehmen. Der Dolmetscher war zugegen, und nun unterhielten wir uns eine gute Weile.
[S. 229]
Diese Art, mich nicht in seinem Zelte, sondern auf neutralem Gebiete zu empfangen, war ein Zug von Etikette, der vollkommen berechtigt und taktvoll war. Ich hatte mich ja gestern geweigert, seiner Einladung zu folgen, und nun dachte er wohl: „Ich will ihm zeigen, daß er sich mit Visitenmachen nicht anzustrengen braucht.“ Er hatte auch gesagt: „Keinen Schritt weiter in der Richtung nach Lhasa“ und wollte mich daher auch jetzt zurückhalten.
Alle Überredungskunst von meiner Seite war gerade so vergeblich wie das erstemal.
„Ich habe keine Lust, euretwegen den Kopf zu verlieren“, sagte er. „Mir persönlich ist es einerlei, ob ihr nach Lhasa reiset oder nicht, aber den Befehlen, die ich von dort erhalten habe, muß ich gehorchen.“
Zum Scherz sagte ich ihm, wir beide könnten ja auf ein paar Tage allein dorthin reiten, niemand werde eine Ahnung davon haben; doch er lachte nur darüber und schüttelte den Kopf.
„Zurück, zurück, nach Norden!“
Auf einmal blinzelte er mit den Augen, zeigte auf mich, sagte das eine Wort „Sahib“ (so werden in Indien die Engländer und die Europäer im allgemeinen genannt) und zeigte dann nach Süden in der Richtung des Himalajagebirges.
Auch ohne Hilfe des Dolmetschers verstand ich, daß er sagen wollte: „Ihr seid ein Engländer aus Indien“. Trotz allen Hinundherredens war ihm diese Überzeugung nicht aus dem Kopfe zu bringen. Ich nahm die Maske ganz und gar ab und sagte ihm, daß ich allerdings ein Europäer, aber kein Engländer sei und aus einem Lande im Norden weit hinter Rußland komme; er lächelte jedoch und wiederholte sein „Sahib, Sahib“. Nun erzählte ich ihm, daß ich zwei burjatische und zwei russische Kosaken bei mir habe, die mir vom russischen Kaiser zur Verfügung gestellt worden seien, und fragte ihn, ob er denn glaube, daß Engländer mit russischen Kosaken reisten, und ob er es für wahrscheinlich halte, daß Engländer von Norden kämen, da ihr indisches Reich ja südlich von Tibet liege. Diese Einwendung begegnete demselben Zweifel; er sagte nur: „Ihr seid alle Sahibs; ist es euch gelungen, einen mongolischen Lama mit euch zu bekommen, so könnt ihr auch einen Burjaten dazu bewegen.“
Jetzt wurden zwei Pferde, ein Falbe und ein Schimmel, vorgeführt, die mir Kamba Bombo, wie er sagte, schenken wolle.
„Laßt zwei eurer Leute aufsitzen und im Galopp vor uns im Kreise reiten“, sagte ich. Dies geschah; aber die Pferde, die recht mager waren, stolperten und sahen wenig nach Vollblut aus. Ich wandte mich an Kamba Bombo und fragte ihn, wie er, ein so reicher und vornehmer Mann, mir,[S. 230] der ich mindestens ebenso vornehm sei, zwei so elende Gäule schenken könne; ich wolle sie nicht haben, sondern sie ihm für seine eigene Kavallerie lassen.
Anstatt diese offenherzige Kritik übelzunehmen, ließ er sofort zwei andere Pferde holen, die gut und wohlgenährt waren und nach abgehaltener Prüfung angenommen wurden.
Darauf ritten wir alle nach meinem Zelte, und hier blieb Kamba Bombo wieder eine gute Weile sitzen. Er aß Rosinen, wie ein Pferd Hafer frißt, und wurde mit Tee, Tsamba und Tabak bewirtet. Der ganze Stab umgab uns. Die Sonne beleuchtete dieses farbenreiche Bild. Die Tibeter sahen vorzüglich aus in ihren phantastischen Trachten mit Kopfbedeckungen wie Damenhüte mit Federn, mit kriegerischen Lanzen und Schwertern in brüderlichem Vereine. Alle lachten pflichtschuldigst über die Witze des Gouverneurs.
Nun wechselten wir uns tibetisches Silbergeld gegen chinesische Jamben ein, die der Bombo sorgfältig auf seiner mitgebrachten Wage wog; dann zeigten wir ihm unsere Waffen, die sichtlich tiefen Eindruck auf ihn machten. Ich sagte ihm, daß das Zusammentrommeln so vieler Soldaten, wie es hier geschehen sei, gar nichts nütze; mit ihren erbärmlichen Vorderladegewehren schreckten sie uns nicht ein bißchen. Wollten sie Krieg anfangen, so möchten sie erst bedenken, daß wir 36 von ihnen niederschießen könnten, ehe sie überhaupt mit dem Laden fertig würden. Er versicherte, es sei durchaus nicht seine Absicht, Krieg anzufangen, sondern nur, die Grenzen gegen unzulässige Fremdlinge zu bewachen.
Nun fragte ich ihn geradezu, weshalb er nicht wage, in mein Zelt zu kommen, ohne sich von einer 67 Mann starken Eskorte begleiten zu lassen; ob er wirklich so entsetzliche Angst vor mir habe.
„Nein“, antwortete er, „aber ich weiß, daß ihr ein vornehmer Sahib seid, und ich habe Befehl von Lhasa erhalten, euch dieselbe Ehrerbietung zu bezeigen, die die höchsten Beamten unseres eigenen Landes beanspruchen können!“
Nachdem ich lange genug vergeblich auf den Engel gewartet hatte, der vom Himmel herabsteigen und uns mit einem feurigen Schwerte den Weg bahnen würde, erhob ich mich und gab Befehl zum Beladen der Tiere. Mit Hilfe der Tibeter war dies im Handumdrehen getan. Kamba Bombo stellte mir eine Eskorte von drei Offizieren und zwanzig Mann vor, die uns nordwärts bis über die Grenze der Provinz Nakktschu bringen sollte. Er versicherte, daß wir uns so lange, wie wir uns in Begleitung dieser Eskorte befänden, um gar nichts zu kümmern brauchten; sie würde für unsere Tiere einstehen und uns mit allem nötigen Proviant versehen,[S. 231] wofür wir nichts zu bezahlen hätten. Er schenkte mir 6 Schafe und eine Menge Lebensmittel in Näpfen und Schüsseln.
So nahmen wir denn Abschied von diesem hochgestellten Beamten, der so freundlich und so ungastfreundlich gewesen war und uns so unerschütterlich den Weg versperrt hatte, und ritten in der Richtung zurück, aus der wir gekommen waren.
„Ja, lieber Schagdur“, sagte ich zu meinem prächtigen Kosaken, dessen Mut und Treue nicht einen Augenblick gewankt hatte, „Lhasa zu sehen, war uns nicht beschieden, aber am Leben sind wir noch, und wir haben allen Grund, dafür dankbar zu sein!“
In einiger Entfernung wandte ich mich im Sattel um und sah Kamba Bombo und seine Leute wie Mäuse auf dem Platze, wo unser Zelt gestanden hatte, umherschnuppern. Einige Stearinlichtstücke und Zigarettenstummel werden sie gewiß in der Überzeugung, daß sie es mit Europäern zu tun gehabt, noch bestärkt haben. Erst nachdem wir eine gute Stunde geritten waren, konnten wir die Lage überblicken und sehen, wie viele zu unserer Eskorte gehörten, denn bis dahin war bald der eine, bald der andere wieder umgekehrt, zuletzt unser Freund, der Dolmetscher, der die ganze Zeit über um Branntwein gebettelt hatte.
Unser Gefolge bestand aus zwei Offizieren, Solang Undü und Anna Tsering, einem Unteroffizier und 14 Soldaten mit Säbeln, Piken und Flinten (Abb. 258). Außerdem waren sechs Männer dabei, die keine Soldaten waren; sie hatten die Aufgabe, die Proviantpferde der Truppe zu führen und eine Herde von 10 Schafen zu treiben. Wir ritten ziemlich schnell und es war lustig, die Marschordnung der Tibeter zu beobachten. Sie ritten vor, hinter und neben uns und ließen uns keinen Augenblick aus den Augen; hätten sie es gekonnt, so wären sie auch wohl über und unter uns geritten, um uns zu verhindern, in den Himmel zu steigen oder in die Unterwelt zu fliehen!
Es war schon spät geworden, denn wir waren erst um 2 Uhr aufgebrochen. Wiederholt hielten die Tibeter an und schlugen vor, daß wir lagern sollten; sie beabsichtigten wahrscheinlich nicht, sich sehr zu beeilen. Doch jetzt war ich derjenige, welcher zu befehlen hatte, und ich ritt, ohne mich um unsere Lasttiere zu bekümmern, mit dem Lama und Schagdur bis in die Nähe des Sees Tso-nekk. Für unsere Habe hatten ja die Tibeter einzustehen versprochen, und sie ritten auch artig mit, ohne zu murren. In der Dämmerung lagerten wir. Sie hatten zwei schwarze Zelte, die sie auf jeder Seite des unserigen und ganz dicht neben diesem aufschlugen. Sobald das Lager in Ordnung war, wurden alle Tiere auf die Weide getrieben und dort von einigen Tibetern bewacht. Ich ging zu Solang Undü[S. 232] und Anna Tsering und aß mit ihnen zu Abend. Letzterer war ein außergewöhnlich liebenswürdiger, sympathisch aussehender junger Mann. Beide waren wie die meisten Tibeter bartlos, und Anna Tsering glich einem jungen Mädchen mit langherabhängenden schwarzen Haaren.
Abends ertönte eine Weile ein summendes, murmelndes Geräusch aus ihren Zelten; sie sprachen ihr Abendgebet. Der Lama erinnerte sich melancholisch desselben, wenn auch unendlich viel kräftigeren Summens von Lhasa her, wo in allen Tempeln stetig Gebete gesprochen werden und wo es wie in einem riesenhaften Bienenkorbe summt. Er würde es wohl nie wieder hören!
Die ganze Nacht goß es, wir aber schliefen ruhig und ungestört. Am Morgen standen alle Tiere, von ihren Wächtern dorthin gebracht, festgebunden an ihrem Platze. Doch alles war schwer und durchnäßt, und der Erdboden schlüpfrig und glatt. Während des Tages (11. August) regnete es jedoch nicht, obwohl der Himmel drohend aussah. Wenn die Sonne scheint, ist es beinahe drückend heiß, so daß es durch meine dünne Chinesenmütze brennt. Die meisten unserer Wächter tragen nur ein grobes Hemd, einen Schaffellpelz und Stiefel. Wenn die Sonne scheint, lassen sie Pelz und Hemd von dem rechten Arme und dem Oberkörper, die dann nackt bleiben, herabgleiten, sobald es aber kalt wird, schlüpfen sie wieder hinein. Das ist sehr bequem und praktisch.
Ihre kleinen, langhaarigen, feisten Pferde laufen ziemlich schnell und machen kleine, trippelnde Schritte. Sie sind jedoch oft ungeberdig, werfen ihre Lasten ab und gehen damit durch, bis diese an der Erde schleppen. Die Männer bringen jedoch bald alles wieder ins rechte Geleise, sind aufgeweckt und achtsam und, wie man sich denken kann, an Karawanenreisen gewöhnt.
Einer der Offiziere hatte einen gelben, langhaarigen, mit blauen Bändern und Schellen geschmückten Windhund mitgenommen. Ich riet ihm schon beim Aufbruch, das Tier lieber zu Hause zu lassen; er wollte aber den Hund durchaus mithaben. Wir waren auch noch nicht weit gekommen, als Jollbars sich über den Ärmsten hermachte und ihn schrecklich zurichtete. Blutend, hinkend und heulend, mußte der Hund von einem Reiter zurückgebracht werden. Vor unseren beiden Hunden hatten unsere Reisegefährten ganz gewaltigen Respekt. Sogar, wenn sie zu Pferde saßen, ritten sie sofort beiseite, wenn Jollbars in ihre Nähe kam, und auf den Lagerplätzen wagten sie nicht eher abzusteigen, als bis die Hunde angebunden waren.
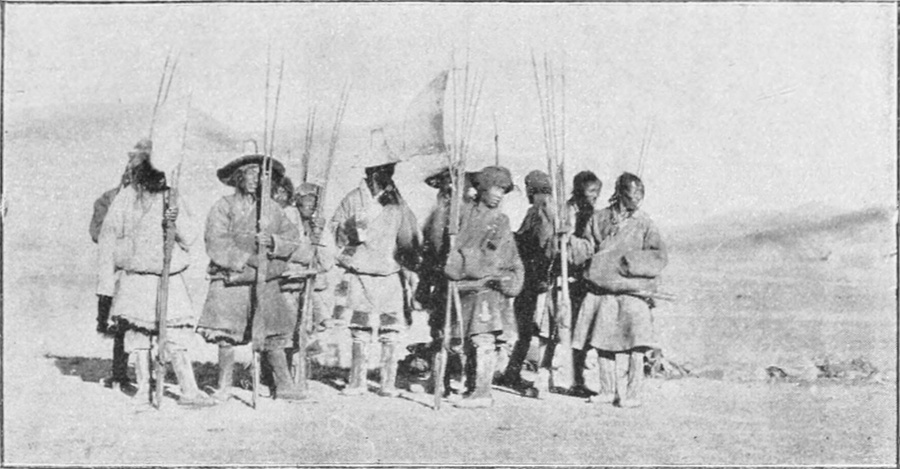


Es war zum Sterben langweilig, denselben Weg wieder zurückzureiten, aber ich sehnte mich doch nach dem Hauptquartier zurück, um mit der ganzen Karawanenmannschaft neuen Erfahrungen entgegenzugehen. Ich[S. 233] zählte die Stunden und bezeichnete auf meinen schon fertigen Kartenblättern die Strecken, die wir an jedem Tage zurücklegten. Die tibetische Eskorte sorgte inzwischen für unsere Zerstreuung. Man kann sich nicht satt sehen an diesen Wilden, ihren malerischen Trachten und ihrer Art zu reisen, zu reiten, mit den Pferden umzugehen, zu rasten, zu lagern, Feuer anzumachen und Essen zu kochen. Abgesehen von den Offizieren sehen die anderen wie Straßenräuber aus (Abb. 259). Unterwegs haben mehrere ihre Zöpfe zusammengerollt unter die hohen, breitrandigen Hüte gesteckt. Ein paar Greise, Lamas, tragen das Haar kurzgeschoren; diese drehen während des Reitens unausgesetzt ihre Korle (Gebetmühlen) und murmeln unermüdlich in anschwellenden und abnehmenden, monoton singenden, einschläfernden Tönen ihr „Om mani padme hum“. Wir sind schon ganz intim mit ihnen, und die Bewachung ist weniger streng. Alle plaudern und lärmen und freuen sich sichtlich über die kleine Vergnügungsreise, die ihnen zuteil geworden ist. Schagdur ist von einer Gruppe Soldaten umgeben, mit denen er lustig scherzt. Sie lachen bis zum Ersticken über seine Versuche, die fremden Ausdrücke zu lernen und anzuwenden.
Solang Undü trägt über der Achsel ein rotes Zeugband, auf dessen Rückseite vier große silberne Gavo festgenäht sind, und am Gürtel Säbel, Messer, Feuerzeug, Tabaksbeutel, Pfeife und verschiedene andere Kleinigkeiten, die um ihn herumbaumeln und klappern. Unter diesen Utensilien befindet sich eine kleine Zange, mit der er sich wiederholt Barthaare, die sich zeigen, ausreißt; er ist auch völlig bartlos und sieht infolge der Runzeln, die sein Gesicht durchfurchen, wie ein altes Weib aus. Seinen Zopf hat er sorgfältig in ein rotes Tuch gewickelt und um den Kopf gewunden. Obendrauf thront der Filzhut mit einer großen Feder.
Nach dreieinhalbstündigem Ritt hielten die Tibeter an und fragten, ob wir etwas gegen eine Rast zum Teetrinken hätten. Meine beiden Reisegefährten stimmten für Weiterreiten, ich zog es aber vor, den Tibetern den Willen zu lassen, um ihre Reisegewohnheiten zu studieren. Sie sagten, sie hätten am Morgen noch kein Frühstück essen können, und der Appetit, mit dem sie die Speisen vertilgten, bestätigte ihre Worte.
Mit ihren Säbeln schnitten sie gruppenweise drei Erdschollen aus dem weichen Rasen; zwischen diese wurden die Töpfe gestellt, in denen das Teewasser gekocht wird. Trockenen Argol hatten sie bei sich, und bald brannten die Feuer. Aus Zeugstücken wurden Brocken von gekochtem Schaffleische ausgewickelt, und die Tsamba mit diesen, Fett, Butter und Tee bereitet. Wir begnügten uns mit sauerer Milch.
Während des Frühstücks wurde uns mitgeteilt, daß die Eskorte uns nur bis an die Grenze des Bombo von Nakktschu am Flusse Gartschu-sängi[S. 234] begleiten werde; wo wir dann blieben, schien sie nicht das geringste zu kümmern. Wir baten sie, bis ans Hauptquartier mitzukommen, dazu hatten sie aber durchaus keine Lust; sie hatten nur ihren Befehlen zu gehorchen und hegten überdies sichtlich einen gewissen Respekt vor unserer Karawane und der uns dort erwartenden Mannschaft. Gerade auf der Strecke des Weges, die ich die Räuberzone nennen möchte, sollten wir also für uns selbst sorgen. Wir sehnten uns nicht danach, da uns jetzt nachts undurchdringliches Dunkel umgab, während wir auf der Hinreise Hilfe vom Monde gehabt hatten.
Der Boden ist hier von all dem Regen womöglich noch nasser, als er es schon war, wie wir zuerst über ihn hinwegritten. Die Pferde sinken und stolpern bei jedem Schritt. Bei den Zeltdörfern zeigen sich selten Menschen, und unsere Begleiter scheinen ihnen beinahe auszuweichen. Wir lagern nicht in ihrer unmittelbaren Nähe, sondern immer in einiger Entfernung. Der nötige Proviant wird im Vorbeireiten von dem einen oder anderen Reiter geholt.
Auf dem heutigen Lagerplatze hatten sie sich noch zwei Zelte besorgt, und die Eskorte war durch sechs Mann verstärkt worden. Der Abend war schön und windstill, die Sterne glänzten wie durch einen leichten Wolkenschleier. Die Dungfeuer flammen unter dem abgemessenen, schweren Hauche der Blasebälge auf wie das Drehfeuer eines Leuchtturmes. Auch in den Zelten sind Feuer, deren Rauch durch eine längliche Ritze in der Zeltdecke entweicht. Das Lager ist selbst am Abend malerisch und lebhaft, und auf allen Seiten hört man die Tibeter scherzen und plaudern. Der lebende Proviant besteht aus 14 Schafen, die nachts zwischen zwei Zelten angebunden werden, weil die Gegend reich an Wölfen sein soll.
Kamba Bombo sollte jetzt Wasser auf seine Mühle bekommen, denn die Tibeter sahen mich Uhr und Kompaß studieren. Sie konnten das Ticken der Uhr gar nicht begreifen und baten unausgesetzt, horchen zu dürfen. Ich sagte, es sei ein Gavo mit einem lebendigen kleinen Burchan (Götzenbild). Die kleine Veraskopkamera konnte ich ungeniert benutzen, nachdem ihnen klar geworden war, daß in ihr kein Revolver oder sonst eine unbegreifliche Höllenmaschine stecke. Der Lagerplatz hieß Säri-kari.
12. August. Sie wecken uns früh, machen aber kurze Tagereisen, um die Annehmlichkeiten des Lagerlebens so lange wie möglich genießen zu können. Unsere Wächter lassen uns immer mehr Freiheit, je mehr wir uns der Grenze der Provinz nähern. Wir dürfen jetzt oft eine ganze Strecke hinter der Haupttruppe allein reiten und glauben uns unbewacht, merken aber bald, daß sich hinter uns stets noch einige Reiter befinden.
[S. 235]
Heute ging es über das große, offene Tal, in dem wir die Teekarawane zuerst gesehen hatten. Es regnete nicht, und der Boden trug unsere Pferde. Als wir ganz in der Nähe unseres ehemaligen Lagerplatzes Nr. 51 waren, bogen die Tibeter rechts in eine kleine Talmündung namens Digo ein und machten dort Halt in hohem, üppigem, duftendem Grase, das für unsere mageren Tiere ein leckeres Fressen war.
Wir waren nur 4½ Stunden geritten, und ich glaubte, daß es sich nur um eine Teerast handle. Es wurden aber die Zelte aufgeschlagen und, an die Karawanentiere denkend, machte ich keine Einwendungen. Es ist ein eigentümliches ruhiges Gefühl, nicht seine Freiheit zu haben und nicht über seinen Weg und seine Zeit bestimmen zu können; man muß ruhen, und für müde Pilger ist es schön, ausschlafen zu dürfen. Solange wir die Eskorte hatten, konnten wir die Sache ruhig mit ansehen, nachher aber, wenn wir wieder unserer eigenen Wachsamkeit überlassen waren, würden wir wieder lange Tagemärsche machen müssen.
Man wird während des Rittes fast schläfrig, wenn man von allen diesen Soldaten umgeben ist, deren Pferde Schellenringe um den Hals tragen. Es ist ein ewiges, eintöniges Glockengeläute, das in den Ohren widerhallt und an eine große Schlittenpartie an einem nordischen Wintertage erinnert. Malerisch ist diese Gesellschaft, die so schnell in unserem friedlichen Gebirge aufgetaucht ist und uns umringt hat, wir mochten es wollen oder nicht. Heute waren keine Zelte zu sehen, so daß wir unseren Milchvorrat nicht verstärken konnten.
Der Tag war, wie der Lagerplatz, herrlich. Wir ließen unser Zelt nach Norden offen, um die leichten Winde hineinzulassen, die von dorther kamen. Im Süden brannte die Sonne gar zu fühlbar; auf dieser Seite war das Zelt geschlossen, aber durch die Ritzen des Zelttuches stahlen sich Sonnenstrahlen herein und ließen meinen Rosenkranz funkeln, als ich mit den heiligen Gebetkugeln, die in so heidnische Hände geraten waren, spielte. Die Temperatur stieg auf +19,1 Grad. Sehr leicht gekleidet, schlummerte ich ins süßeste Vergessen hinüber und verschlief Schagdurs Teefrühstück. Es war friedvoll und sommerlich, der letzte Sommertag, den wir genießen konnten. Ein kleiner Bach begleitete mit seinem munteren Rauschen das Lachen und Plaudern der Tibeter.
Sie verstehen es, sich es auch auf Reisen angenehm und gemütlich zu machen. Wenn wir lagern, haben die Offiziere eine Schar Diener, die ihnen im Handumdrehen die Zelte aufschlagen. Rings um diese werden Sattel, Riemenzeug, Beutel und Gepäck hingeworfen und die Flinten auf ihre Gabeln gestellt, um nicht mit dem feuchten Boden in Berührung zu kommen. Bei so schönem Wetter sitzen alle im Freien und widmen sich[S. 236] mit Kennermiene dem Essenkochen, der liebsten Beschäftigung des Asiaten. Sie sind Meister im Feueranmachen und richten mit Hilfe des Blasebalges einen lodernden Feuerstrahl gegen die Seite des Teekessels, so daß das Wasser in erstaunlich kurzer Zeit ins Kochen gerät. Die Tsamba wurde in kleinen Holzschalen, die unseren mongolischen glichen, angerührt. Einige von ihnen kneten das Gericht mit der rechten Hand und vermischen es mit Käse. Wenn sie Fleisch essen, halten sie das Stück in der Linken und schneiden mit einem Messer kleine Bissen davon ab. Anna Tsering benutzte hierzu ein englisches Taschenmesser („Made in Germany“), das aus Ladak stammen sollte.
Unter ihren Habseligkeiten waren viele verlockende Dinge, die jedoch nicht in unseren Besitz übergehen konnten, weil dafür unerhörte Preise gefordert wurden. Für einen Säbel, dessen Scheide mit Silber beschlagen und mit Korallen und Türkisen besetzt war, forderten sie 50 Liang (etwa 170 Mark), obwohl er nicht mehr als 11 Liang wert war. Eine Gebetmühle sollte 100 Liang kosten. Die Gewehre und ein großer Teil der Lanzen gehörten, wie sie sagten, dem Staate und durften überhaupt nicht verkauft werden. Wir saßen stundenlang bei ihnen in ihrem Zelte, sie aber kamen nie zu uns; wahrscheinlich hatte Kamba Bombo es ihnen verboten, weil ich gesagt hatte, ich wollte gern möglichst ungestört bleiben.
Noch um 9 Uhr abends betrug die Temperatur +9,1 Grad, und um 7 Uhr am folgenden Morgen hatten wir +7,8 Grad.
Am 13. August sahen wir weiter keine Menschen als acht Soldaten, die zu Pferd von Norden, wahrscheinlich von einer Rekognoszierung, kamen. Sie hatten eine lange Beratung mit unseren Offizieren, ehe sie weiterritten. Nun ritten wir über den Satschu-sangpo, der auf den vierten Teil seiner Größe zusammengeschrumpft war. Das Überschreiten lief ohne das geringste Mißgeschick ab, da die Tibeter die Furtschwelle kannten. Jedoch ging in den tiefen Armen das Wasser den kleinen Pferden noch bis über den Bauch. Ehe die Reiter sich in den Fluß begaben, entledigten sie sich ihrer Stiefel; am anderen Ufer wurde eine kurze Rast gemacht, um sie wieder anzuziehen.
Eine Strecke vom rechten Ufer entfernt wurde in einer Gegend mit frischen Quellen und gutem Grase, die auf der Hinreise unseren Blicken entgangen war, für die Nacht Halt gemacht. Bis hierher hatten wir drei von unseren neun Tagereisen zurückgelegt, obwohl hierzu jetzt vier Tage erforderlich gewesen waren. Morgen würden die Tibeter uns also unserem Schicksale überlassen. Uns aber wurde es wirklich schwer, von ihnen zu scheiden; wir waren auf so freundschaftlichen Fuß mit ihnen gekommen, daß wir uns mit dem Gedanken, ihre Gesellschaft entbehren zu müssen, nicht recht aussöhnen konnten. Sie ließen sich jedoch nicht überreden, uns noch[S. 237] weiter zu begleiten; sie hatten ihre Pflicht getan und konnten gehen. Ich drohte ihnen damit, daß ich, nachdem sie abgezogen, noch eine Zeitlang am Satschu-sangpo bleiben und dann doch nach Lhasa gehen würde.
„Bitte sehr“, antworteten sie, „wir sollten euch nur an die Grenze bringen, und das haben wir getan.“
Abends besuchte uns Solang Undü, Anna Tsering und Dakksche zum erstenmal in unserem Zelte; sie wurden mit Tee und Rosinen bewirtet. Da sie sich jetzt jenseits der Grenze befanden, glaubten sie wohl, sich gewisse Freiheiten nehmen zu können. Dakksche war der Greis, der einmal während unserer Gefangenschaft so gebieterisch in unserem Zelte gepredigt hatte. Er ist eine gottvolle Erscheinung mit seinem runzeligen, bronzebraunen, schmutzigen, bartlosen Gesichte und seinem langen, dichten unbedeckten Haare. Er könnte gut für einen heruntergekommenen Schauspieler aus Europa gelten. Sobald er mich erblickt, streckt er die Zunge so weit heraus, wie er nur kann, und hält die Daumen in die Luft, eine Höflichkeit, die ich auf dieselbe Weise und mit solchem Nachdruck beantworte, daß Schagdur sich beinahe totlacht.
Jetzt erst glückte es uns, auch einige Kleinigkeiten erstehen zu können, wie einen Dolch, zwei kupferne Armbänder, einen Ring, einen Löffel, eine Pulvertasche und eine Flöte, alles für ein paar Meter Zeug, das neben chinesischen Porzellantassen und Messern das beste Tauschmittel ist.
Die folgende Nacht schliefen wir fest, um uns ordentlich auszuruhen, ehe die Nachtwachen wieder anfingen. Ich schlief dreizehn Stunden! Als ich aufstand, fragten sie, ob wir hierbleiben würden oder nicht, und da ich mit Bleiben drohte, erboten sie sich, uns zu begleiten, bis wir Menschen träfen und uns mit neuen Vorräten für die Rückreise versehen könnten. Wir ritten also bis in die Nachbarschaft von Sampo Singis Lager, wo die Gegend Gong-gakk und ihr Häuptling Dschangdang heißt.
Hinsichtlich der politischen und der administrativen Verhältnisse erhielten wir recht unsichere Aufklärungen; es ist wohl wahrscheinlich, daß die Sache tatsächlich auch nicht ganz klar liegt. Es wurde behauptet, daß der Satschu-sangpo die Grenze zwischen dem Lande des Dalai-Lama im Süden und dem im Norden liegenden Reiche des chinesischen Kaisers sei, der Häuptling Dschangdang aber von beiden Staaten unabhängig sei. Daß der Satschu-sangpo als Grenze von Bedeutung ist, ging schon daraus hervor, daß die Tibeter uns nur bis dorthin brachten und sich nicht darum bekümmerten, wohin wir uns von dort begaben, sowie auch daraus, daß Kamba Bombo gesagt hatte, für nördlich von diesem Flusse begangene Diebstähle sei er nicht verantwortlich. Im übrigen wußten sie von Tibets Grenzen, daß diese im Westen mit denen von Ladak zusammenfielen, im[S. 238] Osten seien es acht Tagereisen bis an die chinesische Grenze, und nach Süden sollte eine Reise von drei Monaten (!) erforderlich sein, um nach Indien oder, wie sie sich ausdrückten, Hindi zu gelangen. Tsamur und Amdo sind dichtbevölkerte Gebiete im Osten, im Westen heißt das Land Namru.
Sobald wir gelagert hatten, wurden einige Reiter nach Westen geschickt, wie es hieß, nach den ersten Dörfern in Namru, und am Abend kamen sie mit zwei großen Schüsseln voll süßer und saurer Milch wieder, die für den größten Teil der noch übrigen Reisetage reichte. Dagegen nahmen wir nur zwei Schafe mit, obschon uns alle noch lebenden angeboten wurden — sie wären uns während der forcierten Märsche, die uns bevorstanden, nur hinderlich gewesen. Auf jedem Lagerplatz werden Kundschafter in die Gegend ausgeschickt. Sie statten bei ihrer Rückkehr Solang Undü Bericht ab. Wahrscheinlich hat man befürchtet, daß unsere ganze Karawane nach Süden vorgerückt sei, und man will nun vorsichtig sein und aufpassen, daß wir uns nicht mit den Unsrigen zu einem gemeinschaftlichen Angriffe auf die Eskorte vereinigen, um uns dann nach Lhasa durchzuschlagen.
Eine große Yakkarawane lagerte in der Nachbarschaft. Sie war aus Nakktschu, hatte Salz geholt und befand sich jetzt auf dem Heimweg.
Der 15. August war der Tag der Trennung. Unsere Freunde versuchten uns zu überreden, noch einen Tag zu bleiben, und gaben uns die sehr verlockende Versicherung, daß am Abend einige Leute aus Namru anlangen würden. Diese würden uns gewiß gern nach dem Hauptquartier begleiten und uns nachts unsere Tiere hüten. Wir zogen es jedoch vor, aufzubrechen. Solang Undü und Anna Tsering rieten uns, Räuber, die sich nachts unserem Zelte näherten, einfach niederzuschießen. Sie steckten augenscheinlich nicht mit Pferdedieben unter einer Decke, denn sie hatten unheimlichen Respekt vor der Wirkung unserer Schußwaffen.
Als wir Abschied nahmen, erbot sich Solang Undü, uns mit vier Mann nach Sampo Singis Zelt zu begleiten; mit ihnen zogen wir das Tal hinauf, dessen Fluß jetzt bedeutend zusammengeschrumpft war. Einige Reiter, denen wir begegneten, kehrten um und kamen mit. Auch diese waren entschieden Spione, welche die Unseren beobachtet hatten und jetzt mit den lebhaftesten Gesten berichteten, was sie gesehen hatten.
Sampo Singi war nicht zu Hause, aber sein Zelt stand noch da. Hier machten unsere Begleiter Halt, ließen sich an einem Hügel häuslich nieder und baten uns, die Nacht über noch hierzubleiben; wir wollten aber jetzt Zeit gewinnen. Sie sahen uns über den ersten Paß im Nordwesten unseres alten Lagers verschwinden und sind dann wohl, wie ich vermute, zu Kamba Bombo zurückgekehrt.
[S. 239]
Einsam und schweigend ritten wir nach Nordwesten weiter; wir sahen keine anderen Geschöpfe als einige Schafherden und Yake auf den nächsten Hügeln. Unsere Tiere waren kraftlos, aber gemächlich ritten wir drauf los. Bevor es dämmerig wurde, mußten wir Halt machen, damit sie noch eine Weile weiden konnten. Dies geschah an einer kleinen Süßwasserquelle auf einer Wiese, wo Argol in genügender Menge umherlag.
Auf einmal veränderte der Himmel, der uns bisher hold gewesen war, sein Aussehen. Es wurde im Südosten dunkel. Eigentümliche, unheimliche Wolken stiegen über den Bergen auf; sie waren brandgelb und dick, wie beim Ausbruche eines Sandsturmes in der Wüste. Das wird ein nettes Wetter werden, dachten wir. Der Wind kam immer näher, sauste und pfiff, und dann prasselte der erste Hagelschauer auf uns herab, und es wurde pechfinster wie in einem Sacke.
Mittlerweile waren die Tiere vor dem Zelte fest angebunden worden. Hier mußte strenge Wache gehalten werden. Durch dieses Wetter wurde die Nacht ein paar Stunden länger als gewöhnlich, und vielleicht betrachteten uns die Tibeter nun, da sie uns über die Grenze gebracht hatten, nicht länger als Gäste, sondern als vogelfreie Eindringlinge, die man ungestraft plündern durfte. Ein unangenehmeres Wetter ließ sich nicht denken; um 8 Uhr ging der Hagel in Regen über, der wie aus Mulden herabgoß. Man hört nichts weiter als den Regen, der, vom Winde getrieben, gegen das Zelt und auf die Erde schlägt und das Stampfen der Tiere und die einschläfernden Schritte der Nachtwache übertönt. Man sieht die Hand vor den Augen nicht, kein dunkler Umriß gibt den Platz an, wo unsere Tiere zwei Meter vor der Zeltöffnung stehen. Es ist unmöglich, eine Kerze zum Brennen zu bringen; es regnet ins Zelt, es weht, heult und pfeift, und die Zündhölzer sind feucht. Man sitzt zusammengekauert in seinem Pelze, der Oberkörper schwankt hin und her, und vergeblich sehnt man sich nach dem Tageslichte, das jedoch auf sich warten läßt. Alle Waffen sind[S. 240] geladen und liegen zum Gebrauch bereit, und die Hunde sind bei den Pferden angebunden. Von hier war es ein fünfstündiger Ritt nach unserem früheren Lager Nr. 48, von dort sieben Stunden nach dem Lager Nr. 47. Erst im Lager Nr. 44 waren wir zu Hause! Der Weg dorthin erschien uns sowieso unendlich lang, und nun mußte der Regen den Boden noch mehr verderben. Wir entbehrten die Tibeter sehr; es war so ruhig und friedlich, solange wir sie bei uns hatten.
Gegen 11 Uhr ließ der Regen ein wenig nach, und ich ging hinaus, um mich nach Schagdur umzusehen, der mitten zwischen den Pferden und den Mauleseln unter seiner Filzdecke kauerte und bis auf die Haut durchnäßt war. Er war jetzt gerade sehr aufgeregt und bat mich, zu horchen, denn unten am Quellbache klinge es wie menschliche Schritte. Ich hörte auch wirklich schleichende Fußtritte; Schagdur nahm an, daß es ein Kulan sein könne, ich aber glaubte nicht, daß solche sich so nahe bei den Herden der Tibeter aufhielten. Als die leisen, schleichenden Schritte näherkamen und Schagdur das Gewehr bereithielt, stellte sich heraus, daß es unser Hund Malenki war, der unten an der Quelle getrunken hatte. Ich hielt die Lage für ungefährlich, ging wieder ins Zelt, legte mich hin und schlief wie ein Stock bis 5 Uhr, dann wurde ich geweckt und half bei herrlichem Wetter beim Beladen.
Anfangs zogen wir östlich von unserer alten Route, und die Kartenarbeit wurde wieder aufgenommen. Das Terrain war hier viel bequemer, und wir konnten einen deutlichen Weg links vom Gartschu-sängi einschlagen. Lange folgten wir hier der Spur eines Reiters, der mit zwei Hunden erst kürzlich diese Straße gezogen sein mußte, weil die Spur noch nicht verregnet war. Wer mochte er sein, und wohin hatte er seine Schritte gelenkt? War er Mitglied einer Räuberbande, die ihren Sammelplatz droben im Gebirge hatte? Wurden wir vielleicht schon verfolgt, und warteten sie am Ende nur eine günstige Gelegenheit ab?
Wir verloren jedoch die Spur und schlugen einen westlicheren Kurs ein, weil in der bisher eingehaltenen Richtung drohende Berge den Weg zu versperren schienen. Die Richtung wird nordwestlich, das Terrain hebt sich, Kulane und Orongoantilopen, die wenig scheu sind, treten wieder auf, wir ziehen sie dem Anblick bis an die Zähne bewaffneter tibetischer Reiter vor.
Als das Gras immer spärlicher wurde, machten wir nach einem Marsche von 34,5 Kilometer an einem Flusse Halt. Es war weniger, als wir hätten zurücklegen müssen, wenn wir das Hauptquartier in vier Tagen erreichen wollten, aber unsere Tiere waren erschöpft und auch zu müde, um umzukehren und die üppigen Weiden, die wir hinter uns zurückgelassen[S. 241] hatten, wieder aufzusuchen. Nur die beiden neuen tibetischen Pferde sind munter und müssen besonders festgebunden werden, damit sie nicht wieder zu ihren Kameraden zurücklaufen.

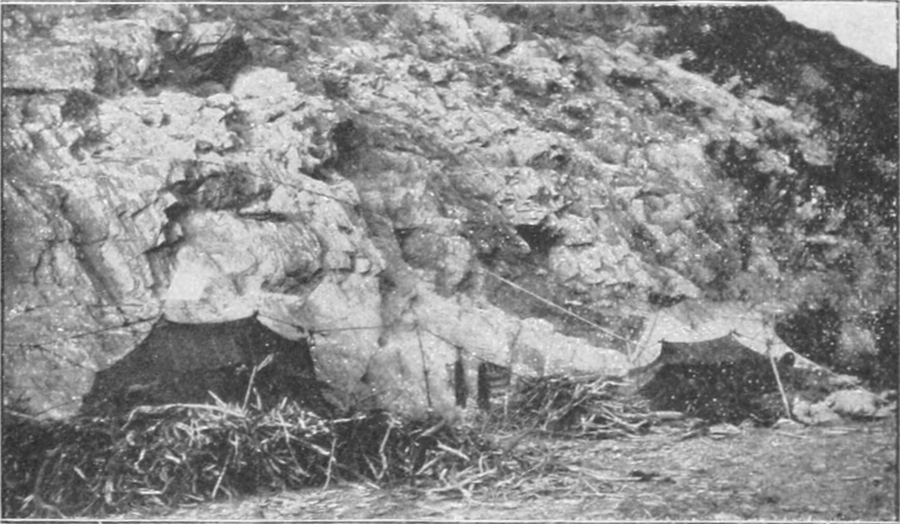

Der Tag war schön gewesen, nur mittags und während der nächstfolgenden Stunden zogen dicke Wolkenmassen von Süden herauf. Die Gegenden, denen wir uns nahten, werden immer kälter und karger; hier sind keine anderen Menschen als höchstens Yakjäger und Straßenräuber zu erwarten.
Die dem Aufschlagen des Lagers folgenden Stunden sind die angenehmsten des ganzen Tages; man ist ruhig, kann sich bequem ausstrecken, Mittag essen, plaudern und rauchen. Aber die Dämmerung kommt nur zu schnell, und je dunkler es wird, desto schärfer heißt es aufpassen.
Die Nacht war ganz klar und windstill. Fern im Westen zuckte über dem Horizonte unausgesetzt ein Wetterleuchten, Donner war aber nicht zu hören. Die Nacht ist so still, daß man sich vor dieser Grabesstille fast fürchten möchte. Selbst aus ziemlich weiter Ferne würde man auch das geringste Geräusch hören können. In einiger Entfernung ertönt das dumpfe Gemurmel eines Bächleins, sonst vernehme ich nur die Atemzüge der Tiere und meiner beiden Reisegefährten. Der Lama spricht oft im Schlafe und ruft bisweilen mit klagender Stimme Sirkins Namen, als brauche und erwarte er Hilfe.
17. August. Alle Hügel und Berge der Gegend sind ziegelrot, denn die vorherrschende Gesteinsart ist roter Sandstein.
Sobald der Tag graut, dürfen die Tiere frei umherlaufen, können sich aber auf unseren Lagerplätzen in der kurzen Zeit durchaus nicht sattfressen. Sie grasen nur abends ein paar Stunden, nachdem wir gelagert haben, und in aller Morgenfrühe. Wir lassen sie daher noch draußen, bis es stockfinster ist, bleiben dann aber bei ihnen. Sie sind den ganzen Tag hungrig und versuchen unterwegs Grashalme abzurupfen; leicht ist es nicht, sie beisammenzuhalten, und ihre kleinen Seitenabstecher verursachen uns Zeitverlust.
Heute ritten wir 9 Stunden und legten 40 Kilometer zurück, — es geht nicht schnell. Etwas westlich von dem alten Wege kamen wir durch ein Tal langsam nach einem Passe hinauf. Vom Passe geht es langsam durch ein anderes Tal hinunter, das sich nach Westen zieht und von senkrechten Wänden eingefaßt wird. Es zwingt uns, viel zu weit westwärts zu gehen, aber wir können nicht aus ihm herauskommen. Hier und dort zeigen sich Yake; es sind entschieden wilde, obwohl es merkwürdig ist, daß sie sich in eine solche Mausefalle hineinwagen. Wir stellten diesen Abend das Zelt auf einen von Schluchten umgebenen Bergvorsprung, wo ein[S. 242] Überfall für den Angreifer sehr gefährlich hätte werden können. Jetzt konnten wir nicht viel mehr als 70 Kilometer von den Unsrigen entfernt sein, und jeder Tag, der verging, vergrößerte unsere Sicherheit; nur der Lama war der Meinung, es würde vielleicht noch schlimmer werden, denn das Hauptlager sei möglicherweise von den Tibetern umzingelt.
Der 18. August war für uns ein schwerer, anstrengender Tag. Es kostete uns verzweifelte Mühe, über eine Bergkette hinüberzukommen, die wir auf der Hinreise ohne Schwierigkeit überschritten hatten.
Wir gehen über einen neuen Paß und haben linker Hand einen See, der in einer Bodensenke liegt. Unsere Tiere sinken tief in den aus rotem Material bestehenden Boden ein; man zieht sozusagen über lauernde Fallgruben und Fallen hin, seit Jahrtausenden scheint Schmutz und Schlamm von den angrenzenden Höhen in dieses heimtückische Loch hinuntergeschwemmt worden zu sein. Anstehendes Gestein ist nirgends zu sehen, alles ist weiches Verwitterungsmaterial. Glücklicherweise war das Wetter jetzt gut; bei Regen wäre hier nicht durchzukommen gewesen.
Unser Räubersee lag jetzt eine ziemliche Strecke rechts von unserem Wege. Einige Maulesel waren vollständig erschöpft, und zwischen 2 und 4 Uhr mußten wir auf einer dünn mit Gras bewachsenen Halde rasten, um sie ausruhen zu lassen. Unterdessen schlummerten und rauchten wir im Sonnenbrande. Die Luft war ruhig, und das Thermometer zeigte +19,6 Grad im Schatten; bei dieser Temperatur ist es hier oben so heiß, daß man fürchtet, einen Sonnenstich zu bekommen. Bald darauf kam eine Hagelbö, und wir waren wieder mitten im Winter. Es ging langsamer und schwerer als je, nach dieser Rast wieder in Gang zu kommen. Man ist ganz erschöpft von den verwünschten Nachtwachen und den beständigen Märschen.
Einmal, als wir langsam nach dem Gipfel eines Hügels hinaufritten, stürmte Malenki seitwärts nach einer anderen Anhöhe und erhob ein wütendes Gebell. Wir glaubten, er habe Menschen gesehen, und ich ritt ihm schleunigst nach und geriet dabei einem Bären, der eifrig an einer Murmeltierhöhle kratzte, beinahe auf den Leib. Als der Petz mich erblickte, sprang er auf und lief, von den Hunden verfolgt, im Galopp davon. Die Hunde holten ihn bald ein, doch jetzt machte der Bär Front und schickte sich an, Malenki eins auf die Schnauze zu geben. Der Hund kehrte nun ebenfalls um und kam zu uns zurück, aber Jollbars hatte noch einen langen Tanz mit dem Petz, der auf so unverschämte Weise in seiner erwarteten Abendmahlzeit gestört worden war.
Jetzt ging es verwünscht langsam vorwärts; es war nutzlos, den Weg fortzusetzen, wir rasteten auf der ersten besten Weide. Der Himmel sah[S. 243] noch immer unheildrohend aus, und die Wolken hatten dieselbe rote oder brandgelbe Farbe wie das Erdreich.
Wieder folgte eine finstere, endlose Nacht, denn vor Tibetern und Bären mußten wir auf der Hut sein. Die Sprache der Nacht ist erhaben, nur nicht in Tibet, wenn man Pferde hüten muß. Von nun an werde ich ein gewisses Mitleid mit unseren Pferdewärtern haben. Wir sehnten uns nach dem Hauptlager wie zu einem großen Feste, schon allein deshalb, weil wir dort nachts würden ausschlafen können. Jeder von uns hat beim Wachehalten seine besonderen Gewohnheiten. Ich schreibe, sitze in der Zelttür und mache von Zeit zu Zeit eine Runde um das Lager. Schagdur sitzt in seinen Pelz gehüllt mitten unter den Tieren und raucht seine Pfeife. Der Lama wieder streift umher und murmelt mit singender Stimme Gebete. Jetzt fehlten uns zwar nur noch 35 Kilometer, aber unsere Tiere hatten, vom Hauptlager an gerechnet, bereits 500 Kilometer zurückgelegt, und es war wenig Aussicht vorhanden, daß wir dieses in einem Tage erreichen würden. Nun wohl, jedenfalls mußten wir so nahe an den Umkreis, innerhalb dessen die Unsrigen die Gegend bewachten, herankommen, daß wir uns für ziemlich sicher halten konnten.
Wir schliefen am Morgen gründlich aus, um die Tiere möglichst lange weiden zu lassen. Sodann ging es zu einem Passe hinauf, von dem wir das weite, offene Tal, in welchem wir die erste Nacht geruht hatten, zu sehen hofften. Doch jenseits des Passes war nur ein Gewirr von Hügeln zu erblicken. Es war wunderbar, daß unsere Tiere mit dem Nordabhange fertig wurden, der da, wo die Sonne nicht eingewirkt hatte, aus lauter Schlamm bestand. Wir müssen zu Fuß gehen und auf flachen Sandsteinplatten und Moosrasen balancieren, sonst sinken wir knietief ein. Die Karawane sieht höchst sonderbar aus, denn die Tiere waten so tief im Morast, daß sie mit dem Bauche den Boden berühren; es ist, als durchwateten sie einen Fluß. Wir steuern nach allen Flecken, die trocken scheinen, mühsam und sehnsüchtig hin, um uns dort eine Weile zu verschnaufen und die Lasten wieder zurechtzurücken. Die Hoffnung täuschte uns; noch zwei ebenso greuliche Pässe waren uns beschieden. Hätte ich hiervon eine Ahnung gehabt, so würde ich natürlich unseren alten Weg gegangen sein, der wie eine Brücke durch ein Moor, in dessen böse Sümpfe wir hilflos hineingeraten waren, zu führen schien.
Endlich erreichten wir mit erschöpften Kräften ein kleines Tal, das nach unserem offenen Tale führte, dessen wohlbekanntes Panorama ein erfreulicher, belebender Anblick war. Jetzt merkten wir, daß wir beim Waten im Moraste den Spaten verloren hatten. Der Lama ging zurück, ohne ihn zu finden, stieß dafür aber auf eine alte tibetische Zeltstange, die uns[S. 244] abends beim Feueranzünden gut zustatten kam. Rebhühner, Hasen und Kulane zeigen sich überall, und, wie gewöhnlich, sind die Raben in diesem unwirtlichen Gebirge heimisch.
Es war herrlich, wieder auf tragfähigem Boden zu reiten. Neun Kulane leisteten uns eine Zeitlang Gesellschaft. Auf einer Anhöhe rasteten wir einige Minuten, um die Gegend zu überschauen. Keine Spur, keine schwarzen Punkte, die unsere weidenden Tiere sein konnten, kein Rauch war zu sehen! Die Gegend lag ebenso still und öde da, wie wir sie zuletzt gesehen hatten, und absolut nichts deutete darauf hin, daß sich Menschen in der Nachbarschaft befanden.
Obwohl die Sonne schon tief stand, schienen meine Kameraden doch zu glauben, daß wir noch zu den Unsrigen gelangen würden, denn sie ritten immer schneller. Die Tiere, die sonst gewöhnlich in einem Haufen getrieben wurden, mußten hier in einer Reihe hintereinander und mit Stricken verbunden marschieren, da das Gras sie zu sehr in Versuchung führte. Schagdur leitete drei, ebenso der Lama, und ich ritt als Treiber hinterdrein. Schagdur hatte einen bedeutenden Vorsprung. Mein Reitschimmel, der mir den gestohlenen ersetzt hatte und der, nachdem er kraftlos geworden, durch eines der tibetischen Pferde ersetzt worden war, brach plötzlich zusammen und blieb auf der Erde liegen. Man mußte glauben, daß seine letzte Stunde gekommen sei; wie es schien, fing er schon an zu erkalten. Der Lama schmierte ihm die Nüstern innen mit Butter ein und zwang ihn, Lauch zu kauen. Große Tränen rollten aus den Augen des Pferdes, und Schagdur sagte, es weine darüber, daß es jetzt, nachdem es so ehrenvoll alle unsere Anstrengungen geteilt, nicht zu seinen alten Kameraden zurückkehren könne. Inzwischen schlugen wir Lager, und die Tiere wurden auf die nächste Weide geführt.
Die Nacht verlief ruhig unter frischem, nördlichem Winde. Die Hunde knurrten nicht einmal, und keine Feuer waren sichtbar.
Als wir am 20. August aufbrachen, strömte der Regen nieder, was uns jedoch wenig störte, weil der Boden jetzt beinahe überall fest und tragfähig war. Sogar der Schimmel hinkte mit. Als wir die roten Hügel in der Nähe unseres ersten Lagerplatzes, auf dem Hinwege, passiert hatten, ertönten zwei Flintenschüsse und eine Weile darauf ein dritter. Ein Yak stürmte nach den Hügeln hinauf. Wir richteten unseren Kurs sofort dorthin und bemerkten bald zwei Punkte, die sich im Fernglase nach und nach zu zwei Reitern entwickelten. Waren es tibetische Yakjäger? Nein, denn es zeigte sich bald, daß sie gerade auf uns zu ritten. Als sie nähergekommen waren, erkannten wir in ihnen Sirkin und Turdu Bai. Wir saßen ab und warteten, bis sie vor Freude weinend heransprengten, ganz[S. 245] entzückt von der heutigen Jagd, — eine solche Beute hatten sie sich nicht träumen lassen, als sie am Morgen ausgeritten waren, um sich Fleisch zu verschaffen! Sie hatten nämlich nur noch drei Schafe. Für uns war es ein besonderes Glück, so unerwartet in der Einöde mit ihnen zusammenzutreffen; es wäre uns jetzt, da der Regen alle Spuren ausgelöscht hatte, wohl recht schwer geworden, das Lager zu finden.
Das Lager war vor einiger Zeit nach einem Seitentale südlich von der Flußmündung verlegt worden und war dort so im Terrain versteckt, daß wir es ohne Hilfe kaum hätten entdecken können. Wir ritten sämtlich dorthin. Kutschuk, Ördek und Chodai Kullu kamen uns entgegengelaufen; auch sie weinten und riefen:
„Chodai sakkladi, Chodai schukkur (Gott hat euch beschützt, Gott sei gelobt), wir sind wie vaterlos gewesen, während ihr fort waret!“
Es war wirklich rührend, ihre Freude zu sehen. —
Bald darauf saß ich wieder in meiner bequemen Jurte und hatte meine Kisten um mich, und mein schönes, warmes Bett war in Ordnung. Wenn man es einen ganzen Monat recht schlecht gehabt hat, weiß man es erst zu schätzen, wenn man sich wieder in „zivilisierten Verhältnissen“ befindet. Sirkin berichtete, daß ein Pferd verendet sei und die anderen sich noch nicht erholt hätten, daß die Kamele aber bedeutend kräftiger geworden seien. Die Chronometer waren stehengeblieben, weil Sirkin es aus Furcht, daß die Federn springen könnten, nicht gewagt hatte, sie ganz aufzuziehen. Die Folge dieser übertriebenen Vorsicht war, daß wir nun nach dem naheliegenden Lager Nr. 44, unserem Hauptquartiere, von dem die Reise nach Lhasa ausgegangen war und in welchem ich damals eine astronomische Ortsbestimmung gemacht hatte, zurückkehren mußten. Ein Zeitverlust von mehreren Tagen würde dadurch allerdings entstehen, aber die Tiere, die wir mitgehabt hatten, bedurften nur zu sehr aller Ruhe, die sie haben konnten. Es hatte in der Gegend unaufhörlich geregnet; bisweilen waren jedoch kleine Ausflüge gemacht und dabei einige Kulane erlegt worden.
Tschernoff hatte die Nachhut so gut geführt, daß er bei seiner Ankunft am 2. August noch neun Kamele mitgebracht hatte; nur zwei Kamele und zwei Pferde waren verendet; unter den ersteren war mein Veteran von der Kerijareise im Jahre 1896.
Alle Leute waren gesund, und helle Freude herrschte an diesem Abend. Sie gestanden, daß sie nach Ördeks Rückkehr für uns das Schlimmste befürchtet hätten und kaum von uns hätten sprechen mögen, sondern gewartet und gewartet hätten. Jolldasch heulte vor Freude und nahm sofort seinen bequemen Platz neben meinem Bette wieder ein.
Nachdem ich das Lager inspiziert und alles in bester Ordnung[S. 246] vorgefunden hatte, mußte Tscherdon mir ein Bad zurechtmachen. Der größte Kübel, den wir hatten, wurde mit heißem Wasser gefüllt und in meine Jurte gebracht. Nie ist ein gründliches Abseifen notwendiger gewesen als jetzt, und das Wasser mußte mehreremal erneuert werden, hatte ich mich doch 25 Tage lang nicht gewaschen! Und wie schön war es, nachher vom Scheitel bis zur Sohle wieder in reinen europäischen Kleidungsstücken zu stecken und den mongolischen Lumpen auf ewig Lebewohl sagen zu können!
Nach einem wohlschmeckenden Mittagsessen und Aufzeichnung der heutigen Erlebnisse ging ich mit gutem Gewissen zu Bett und genoß in vollen Zügen die Ruhe und den Komfort, die mich umgaben. Das Bewußtsein, daß ich den forcierten Ritt nach Lhasa ohne Zögern gewagt hatte, war mir eine große Befriedigung. Daß wir diese Stadt nicht hatten sehen können, betrachtete ich weder jetzt noch später als eine Enttäuschung; gibt es doch unüberwindliche Hindernisse, die alle menschlichen Pläne kreuzen. Aber es freute mich, daß ich nicht einen Augenblick gezaudert hatte, einen Plan auszuführen, der kritischer und gefährlicher war als eine Wüstenwanderung, und es ist ein Vergnügen, gelegentlich den eigenen Mut auf die Feuerprobe zu stellen und die Ausdauer bei Strapazen zu erproben. Mein Leben während der nächstfolgenden Zeit erschien mir im Vergleich mit dem eben Erlebten wie eine Ruhezeit. Was uns auch beschieden sein mochte, — solche Strapazen wie auf der Lhasareise würden wir schwerlich wieder erleben. Mir war zumute, als sei ich schon halb wieder zu Hause, und ich ahnte nichts von den ungeheuren Mühsalen, die uns noch von Ladak trennten.
Alles erschien mir jetzt leicht und lustig, sogar der Regen schmetterte freundlich auf die Kuppel der Jurte, und der eintönige Sang der Nachtwache lullte mich bald in den Schlaf. Ich war froh, daß ich nicht mehr hinauszugehen und die Pferde zu bewachen brauchte, und ich freute mich, Schagdur und den Lama, halbtot vor Müdigkeit, in ihren Zelten schnarchen zu hören.
Am folgenden Morgen konnte es keiner übers Herz bringen, mich zu wecken; wir kamen daher erst mittags fort. Wir ritten auf den Hügeln am rechten Ufer des Flusses. Die Wassermenge war jetzt ziemlich ansehnlich. Auf dominierenden Höhen hatten meine Leute Steinpyramiden errichtet, die von fern Tibetern glichen. Der Zweck der Steinmale war, uns bei der Rückkehr den Weg vom Lager Nr. 44 nach dem neuen zu zeigen. Wenn die Tibeter die Pyramiden erblickten, würden sie gewiß glauben, daß wir eine Heerstraße für einen Einfall bezeichnet hätten und daß bald eine ganze Armee unserer Spur folgen würde. In einem Nebentale verriet ein großer Obo, daß die Gegend nicht selten besucht wurde; wie[S. 247] gewöhnlich, war er aus einer Menge Sandsteinplatten errichtet, in die die Formel „Om mani padme hum“ eingemeißelt war.
Wir ließen uns jetzt an derselben Stelle wie damals häuslich nieder. Das Gerippe des hier gefallenen Pferdes war von Wölfen vollständig reingefressen. Hasen und Raben kommen in der Gegend besonders häufig vor. Eines der letzten Schafe wurde geschlachtet. —
Die Reise nach Lhasa erscheint mir jetzt wie ein Traum; hier sitze ich unter denselben Verhältnissen wie vor einem Monat, die Jurte steht auf demselben Erdringe, die Beine des Theodolitenstativs in denselben Löchern, der Fluß rauscht wie damals; es ist, als könnten nur ein, zwei Tage vergangen sein. Alle jene langen, unter Wachen und Sorge zugebrachten Nächte sind vergessen; es war nur eine flüchtige Episode, eine Parenthese im Verlaufe der Reise! —
Jetzt folgten einige Tage der Ruhe, in denen meine Geduld jedoch sehr auf die Probe gestellt wurde. Es regnete und schneite unaufhörlich, und ich hatte keine Gelegenheit, alle die astronomischen Beobachtungen, die ich gern machen wollte, vorzunehmen. Und dann sehnte ich mich auch danach, wieder nach Süden aufzubrechen und bewohnte Gegenden aufzusuchen, wo wir die uns nötige Hilfe erhalten konnten, denn es war schon jetzt ersichtlich, daß unsere Tiere nicht mehr weit kommen würden.
In der Nähe des Lagers wurde mir ein Platz gezeigt, wo Turdu Bai und Tscherdon am Tage unserer Abreise eine Gesellschaft tibetischer Jäger überrascht hatten. Diese Helden waren so fassungslos gewesen, daß sie Hals über Kopf Reißaus genommen und siebzehn Packsättel, ein Zelt und den ganzen Fleischvorrat, aus dem ihre Jagdbeute bestand, im Stiche gelassen hatten. Alles lag noch da, bis auf das Fleisch, das sich Wölfe und Raben zu Gemüte geführt hatten. Man kann sich die tollen Gerüchte denken, die in Umlauf gesetzt werden, wenn solche Flüchtlinge wieder bewohnte Gegenden im Süden erreichen. Sie übertreiben natürlich ihre Beschreibungen und behaupten, daß eine ganze Armee von Europäern ins Land gedrungen sei. Das hatten wir in Dschallokk ja selbst gehört.
Während meiner Abwesenheit war gute Disziplin gehalten worden, aber nach meiner Rückkehr wurde sie noch mehr verschärft. Alle unsere Tiere hatten ihre Weideplätze in einem Tale, das einige Kilometer vom Lager entfernt war. Tschernoff ritt einmal nachts dorthin und fand die Wächter schlafend. Er gab einen Flintenschuß ab, durch den alle aufs fürchterlichste erschreckt wurden. Die Schläfer wurden gebührend heruntergemacht und beklagten sich am folgenden Morgen bei mir, doch statt daß ich mich auf ihre Seite stellte, bekamen sie ein neues Gesetz zu hören, das ich im Handumdrehen erließ: „Wer künftig auf seinem Posten schlafend[S. 248] angetroffen wird, wird mit einem Eimer kalten Wassers aufgeweckt!“ Jede Nacht sollten sechs Muselmänner, je zwei gleichzeitig, abwechselnd Wache halten, und die Ablösung sollte unter Kontrolle des diensthabenden Kosaken vor sich gehen. Die vier Kosaken waren also der Reihe nach für den Nachtdienst verantwortlich. Die Muselmänner hatten über die Tiere zu wachen und die Kosaken dafür zu sorgen, daß die Muselmänner ihre Pflicht taten. Infolge der letzten Abkanzelung wollten Mollah Schah und Hamra Kul wieder einmal nach Tscharchlik zurückkehren, beruhigten sich aber, nachdem sie den Wahnsinn eines solchen Unternehmens eingesehen hatten. Derartige Reibereien sind in einer großen Karawane, in der Geschmack und Meinung nach den christlichen, muselmännischen oder mongolischen Anschauungen und Lebensgewohnheiten der Betreffenden wechseln, nicht zu vermeiden.
Tscherdon wurde zu meinem Leibkoch ernannt, Schagdur sollte sich eine Zeitlang ausruhen; der Lama war niedergeschlagen und nachdenklich und wurde von jeder Dienstleistung dispensiert, bis wir wieder auf Menschen stießen. Dem alten Muhammed Tokta, der schon lange kränklich gewesen war, ging es seit einer Woche schlechter; er klagte über Herzschmerzen. Es wurde ihm geraten, sich ganz ruhig zu halten. Im übrigen herrscht im Lager die beste Stimmung, und die Kosaken sind besonders zufrieden. Sie haben eine Balalaika, eine dreisaitige Zither, gemacht, und mit dieser, einer tibetischen Flöte, einer Tempelglocke, improvisierten Trommeln, der Spieldose und Gesang wurde am letzten Abend unter strömendem Regen ein wenig harmonisches Konzert aufgeführt, das jedoch großen Beifall fand.



[S. 249]
Am 25. August sollten wir endlich das Lager Nr. 44 endgültig verlassen und neuen Schicksalen und Erfahrungen entgegengehen. Ladak war jetzt unser Ziel; aber ich hatte mir fest vorgenommen, nicht eher die Richtung nach Westen einzuschlagen, als bis wir weiter südlich wieder auf unüberwindliche Hindernisse stießen. Die Tibeter waren jetzt wachsam, das ganze Land war wie im Belagerungszustand, eine Mobilmachung hatte bereits stattgefunden, das wußten wir, und wir konnten uns sehr leicht ausrechnen, daß wir früher oder später wieder tibetischen Truppen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden. Für den Anfang zogen wir jetzt also nach Süden.
Merkwürdigerweise erkrankten über Nacht drei von unseren Pferden, aber nicht von denen, die die Reise nach Lhasa mitgemacht hatten. Das eine taumelte und fiel unaufhörlich, das andere verendete schon im Lager, und das dritte kam nur noch über den ersten Paß des Tagemarsches, ehe es stürzte, um sich nie wieder zu erheben. Es war ein trauriger Anfang und zeigte deutlich, daß wir früher oder später auf die Hilfe der Tibeter angewiesen sein würden.
Als ich geweckt wurde, schneite es stark, und als wir aufbrachen, goß es wie mit Scheffeln. Die ganze Gegend sieht aus wie mit Straßenkot begossen, in den man einsinkt, ohne festen Fuß fassen zu können. Zuerst wurde der Fluß überschritten, dann zogen wir durch den Schlamm nach einem kleinen Passe hinauf. Mehrere Reiter mußten nach verschiedenen Richtungen ausgesandt werden, um zu untersuchen, ob der Boden trug. Über einen neuen Fluß schreiten wir unglaublich langsam nach einem höheren Passe hinauf. Hier müssen alle zu Fuß gehen, auf die Gefahr hin, daß ihre Stiefeln im Morast steckenbleiben. Die armen Kamele zerreißen, da sie fest einsinken und der Karawane nicht folgen können, unaufhörlich ihre Nasenstricke. Wären unserer nicht soviele gewesen, so hätten wir diejenigen Kamele, die bis zur Hälfte in dem losen nassen Tonschlamme,[S. 250] der sie zäh festhielt, eingesunken waren, ganz einfach im Stiche lassen müssen. Die Last muß ihnen sofort abgenommen und auf einigermaßen festen Boden gestellt werden, damit nicht auch sie verschwindet. Der Tonschlamm wird mit Spaten abgegraben, das Kamel auf die Seite gelegt, seine Beine mit Seilen herausgewunden und eine mehrfach übereinandergelegte Filzdecke unter das Tier gebreitet, damit seine Füße festen Halt finden, wenn es sich endlich selbst aufzustehen bemüht. Sonst sind die Kamele verloren, denn sie bleiben ruhig liegen, bis man sie herauszieht. Währenddessen gießt es, daß es auf der Erde klatscht. Alles wird aufgeweicht und durch und durch naß, als sollten diese Höhen fortgespült werden.
Jenseits des Passes wurde das Terrain ein wenig besser; die Südabhänge sind infolge der Einwirkung der hier jedoch äußerst selten auftretenden Sonne gewöhnlich vorteilhafter für uns. Am rechten Ufer eines Flusses hatte die Karawane während unserer Abwesenheit einige Tage zugebracht, und da dort noch ein großer Argolhaufen lag, machten wir an dieser Stelle Halt.
Am folgenden Tag waren sowohl das Wetter wie auch die Wegverhältnisse günstiger, aber das Land ist fast unfruchtbar und arm an Wild. Nur ein einsamer Kulan zeigte sich und wurde von Sirkin erlegt. Gewöhnlich schreibt die Gestalt des Bodens uns die Richtung unseres Weges vor, und da jener nach Südsüdwesten hin am ebensten aussah, zogen wir nach dieser Seite. Ungefähr 40 Kilometer westlich von unserer Route erhob sich ein kleines Schneemassiv mit rudimentären Gletschern; es setzte sich im Süden in einer merkwürdigerweise meridionalen Bergkette mit vereinzelten Schneegipfeln fort.
Tschernoff hatte vor einiger Zeit die Gegend rekognosziert und teilte mir jetzt mit, daß er an einer etwas weiter südlich gelegenen Quelle deutliche Kamelspuren gesehen habe. Als wir am 27. August dort vorbeizogen, zeigte er mir den Platz, und richtig hatten dort Kamele in großer Zahl geweidet. Woher sie gekommen waren und was für Menschen sie gehört hatten, war und blieb uns ein Rätsel. Sollten sie am Ende einer mongolischen Pilgerkarawane, die sich von Nordosten hierher verirrt hatte, gehört haben?
Denselben Tag mußten wir auch Bowers Route gekreuzt haben, obwohl es nicht möglich war, die Stelle, wo dies geschah, zu identifizieren. Im Süden erhob sich vor uns eine neue Bergkette, aber wir waren nur imstande, bis an ihren Fuß zu gelangen, wo das Lager Nr. 67 aufgeschlagen wurde. Der Herbst hatte seinen Einzug gehalten, das Minimumthermometer zeigte −5,1 Grad, und am Tage hatten wir nicht mehr als +7,9 Grad.
[S. 251]
Als ich am 28. aufstand und mit dem Beladen der Tiere schon angefangen war, wurde mir gemeldet, daß Kalpet, ein Mann aus Kerija, fehle. Ich verhörte die Leute, die aussagten, daß er gestern über Brustschmerzen geklagt habe und auf dem Marsche zurückgeblieben sei. Sie seien jedoch der Meinung gewesen, daß er langsam unseren Spuren folge und in der Dunkelheit, ohne daß jemand darauf geachtet habe, im Lager angekommen sein werde. Nun fehle er aber noch immer. Ich ließ die Tiere weitergrasen und schickte Tschernoff und Turdu Bai zu Pferd mit einem Maulesel ab, um den Mann lebendig oder tot herbeizuschaffen, — er konnte ja unterwegs plötzlich erkrankt sein und mußte sich jedenfalls in einer schlimmen Lage befinden, da er uns nicht nachgekommen war und einen ganzen Tag nichts zu essen bekommen hatte. Nach einigen Stunden kamen sie mit dem armen Menschen an, der aufs beste verpflegt wurde und auf einem Maulesel reiten durfte, als wir endlich, bedeutend verspätet, aufbrachen.
Obgleich der Boden tragfähig war, wurde der Tagemarsch doch ziemlich anstrengend, denn wir mußten über eine ganze Reihe von Pässen und Kämmen.
Mit zwei Kamelen geht es jetzt zu Ende; sie können nicht mehr mitkommen; sie müssen später geholt werden und sind natürlich stets unbeladen. Große Ordnung herrscht in der Karawane. Der diensttuende Kosak bringt die Nacht auf dem Platze zu, wo die Tiere unter Aufsicht ihrer Wächter, die man aus der Ferne singen hört, grasen. Heute abend begab sich Schagdur dorthin, nachdem er in der Jurte der Kosaken zu Abend gegessen hatte, und die Töne der Balalaika verhallten am Fuße der Hügel. Die drei übrigen Kosaken, die den Erzählungen Schagdurs und des Lamas mit gespanntem Interesse gelauscht hatten, sehnten sich jetzt danach, mit den Tibetern in Berührung zu treten. Sie sahen mich verwundert und fragend an, als ich ihnen sagte, daß unsere Karawane früher oder später in ihrem Marsche von einer unüberwindlichen Heerschar aufgehalten werden würde.
Dieser Lagerplatz, Nr. 68, befand sich in einer Höhe von 5068 Meter. Schon um 9 Uhr abends war die Temperatur auf −1,9 Grad gesunken und hielt sich während der Nacht auf −6,2 Grad. Auch diese Tagereise führte über drei kleine, aber recht beschwerliche Pässe; die Bergketten erstrecken sich jetzt wieder von Westen nach Osten, und alle Täler fallen nach Süden ab. Eine vierte Kette brauchten wir nicht zu übersteigen, da sie von einem Flusse durchbrochen wurde, dem wir folgten.
Alte Lagerplätze sind jetzt ziemlich häufig und lassen sich teils an den gewöhnlichen drei Steinen, auf die der Kochtopf gestellt wird, teils an[S. 252] Schädeln von erlegten Yaken und Archaris erkennen. Bei einem solchen Platze lud die Weide zu einem Extrarasttage ein. Eine Herde von 50 Kulanen zog sich bei unserem Herannahen zurück. Yake und Wildschafe sind gleichfalls zahlreich vertreten, ebenso Hasen. Ein Lampe wurde eifrig von allen sieben Hunden verfolgt und von Jolldasch gefangen. Jollbars strengt sich nicht weiter an, bevor die Beute nicht eingefangen ist; dann erst tritt er auf und hält einen gehörigen Schmaus.
Der Rasttag war in jeder Beziehung herrlich, das Wetter gut; der Rauch stieg manchmal senkrecht von den Lagerfeuern auf, und unsere erschöpften Tiere schwelgten in dem guten Grase. In der Nähe fanden wir noch mehrere alte Lagerplätze, und aus dem Schafmiste ließ sich schließen, daß die Gegend nicht nur von Jägern, sondern auch von Nomaden aufgesucht wird. Wir konnten also jeden Augenblick auf Menschen stoßen, und bei denen, die noch keine Tibeter gesehen hatten, wurde die Neugier immer größer.
Schagdur und Turdu Bai rekognoszierten in östlicher Richtung und fanden dort eine ganze Reihe „Iles“ oder Male, die aus Steinen, oder wo Gestein fehlte, aus Erdschollen errichtet waren. Die Reihe erstreckte sich weit nach Süden, und die Male standen so dicht, daß sie, nach Schagdurs Annahme, wahrscheinlich die Grenzlinie einer Provinz bezeichneten, um so mehr, als von einem Wege dort keine Spur zu entdecken war. Sirkin schoß einen „Kökkmek“-Bock, der photographiert wurde (Abb. 260). Schagdur ebenfalls einen. Letzterer und eine hübsche kleine „Jure“ (Antilope Cuvieri) wurden von den Kosaken abends vermittelst einiger Pflöcke und Schnüre in der natürlichen Stellung, die sie während des Laufens einnehmen, aufgestellt. Am Morgen waren sie steif gefroren und konnten allein stehen wie Turnpferde. Es geschah, damit ich die Tiere photographieren konnte (Abb. 261).
31. August. Es ist nicht angenehm, aus seinem süßesten Morgenschlafe aufgeweckt zu werden; doch ist man erst angekleidet und in Ordnung, so geht alles seinen ruhigen Gang, und der Tag verläuft ebenso wie seine Vorgänger. Wir hatten jetzt ein viel gastfreundlicheres Land als bisher erreicht; der Boden ist fest, das Terrain senkt sich, und wir brauchten keine Pässe zu forcieren. Auch der Himmel war uns hold, die Temperatur stieg auf +18,2 Grad. Südwestlich von unserem Wege zeigte sich ein kleiner Salzsee, der der Sammelplatz aller Wasserläufe der Gegend war. Am Ufer saßen einige gewaltige Adler. Ihre Jungen, die eben flügge waren, wurden von den Hunden angegriffen, verteidigten sich aber so tapfer mit Schnabel und Krallen, daß die Angreifer sich zurückziehen mußten.
[S. 253]
Am 1. September überschritten wir in einem 4855 Meter hohen Passe die nächste Kette, die ganz und gar aus weichem Material bestand und abgerundete Formen hatte. Vom Passe hatte man nach Süden eine außerordentlich weite Aussicht. In der Ferne ließ allerdings ein schwaches Dunkel einen Kamm ahnen, sonst aber schienen wir ein paar gute Tagereisen ebenen Terrains vor uns zu haben. Der Boden schimmerte stärker grün als bisher, dessenungeachtet waren aber keine Nomaden zu sehen; die Lagerstellen, an denen wir vorbeikamen, waren alle ziemlich alt. Obgleich wir nur 20 Kilometer zurückgelegt hatten, blieben wir daher bei dem ersten Bette, welches Wasser führte.
Gegen 4 Uhr gab es im Lager eine Aufregung. Ein Haufe schwarzer Punkte, die für weiter südlich weidende wilde Yake gehalten worden waren, wurden durch das Fernglas als Pferde erkannt. Der Lama und die Kosaken, außer dem diensthabenden, ritten dorthin. Ersterer kam jedoch bald wieder und führte sein Pferd, das krank geworden war, am Zügel. Die Pferde waren fett und kräftig, aber scheu gewesen. Wächter hatten sich nicht gezeigt, und nichts deutete an, daß solche beim Herannahen der Reiter entflohen sein könnten. Für die Besitzer selbst schien die Gegend sicher zu sein, während es für uns nicht angegangen wäre, die Tiere ohne Aufsicht zu lassen. Der Ausflug hatte das Gute, daß noch besseres Weideland entdeckt wurde, wohin wir unsere Tiere trieben und wo wir ihnen um so eher einen Ruhetag gönnen konnten, als Almas mit den beiden kranken Kamelen noch nichts von sich hatte hören lassen.
Frühmorgens machten sich der Lama, Schagdur und Sirkin auf die Suche nach Tibetern, und wir konnten voraussehen, daß sie Erfolg haben würden, denn auf den Hügeln im Süden zeigten sich wohl 1000 Schafe und eine Yakherde.
Gegen Abend kam der Lama mit einer Domba Milch zurück, und in der Ferne erschienen die Kosaken, drei Tibeter, die ihre Pferde und ein Schaf führten, buchstäblich vor sich hintreibend. Sie hatten ein Zelt mit 13 Bewohnern gefunden. Beim Herannahen der Reiter war die ganze Gesellschaft nach verschiedenen Seiten hin entflohen; da ihre Pferde jedoch nicht bei der Hand gewesen waren, hatten unsere Leute sie leicht einholen und nach dem Zelte zurücktreiben können. Erschreckt wie sie waren, waren sie wenig mitteilsam, und die Auskünfte, die sie erteilten, waren nicht viel wert.
Sie sagten, daß die Gegend Dschansung heiße und ihr „Bombo“, der an dem großen See Selling-tso wohne, ihnen den Hals abschneiden würde, wenn sie uns Lebensmittel verkauften. Sie weigerten sich auch ganz bestimmt, dies zu tun. Nachdem aber Schagdur, der die Tibeter[S. 254] haßte, seitdem sie uns den Weg nach Lhasa versperrt hatten, einen der Männer mit seiner Reitpeitsche traktiert hatte, ließen sie mit sich reden und gaben eine Schüssel Milch und ein Schaf her. Sie hatten sich erst ganz kürzlich in der Gegend niedergelassen, so daß sie noch keine Zeit zur Bereitung saurer Milch gehabt hatten; das noch frische, unberührte Gras um ihr Zelt herum sprach für die Wahrheit dieser Aussage.
„Wohin reist ihr denn?“ fragte einer von ihnen.
„Nach Ladak“, antwortete der Lama.
„Dann seid ihr auf ganz verkehrtem Wege; nach Süden hin könnt ihr nur noch eine Tagereise weit kommen, denn dort wird der Weg vom Selling-tso, wo die Bevölkerung zahlreich ist, versperrt.“
Sie selbst waren Bantsching Bogdo in Taschi-lumpo untertan, wußten aber nicht, wie viele Tagereisen es bis zu ihrem Tempel sei. Im Südosten regiere der Dalai-Lama über das Gebiet von Lhasa, im Osten Kamba Bombo über das von Nakktschu.
Mit sichtbarer Furcht näherten sie sich unserem Lager und wurden aufgefordert, sich vor der einen Jurte auf einen Teppich zu setzen (Abb. 262). Tee und Brot wurden ihnen vorgesetzt; nach einigem Zögern langten sie tüchtig zu. Für das Schaf, das sofort unter muselmännischen Zeremonien geschlachtet wurde, bezahlten wir sie mit Lhasageld, für die Milch erhielten sie eine Porzellantasse. Pferde konnten sie nicht verkaufen, weil die Herde ihnen nicht gehörte. Sie saßen die ganze Zeit wie auf Kohlen, obwohl der Lama sie zu beruhigen suchte und versicherte, daß ihnen kein Leid geschehen solle.
Als wir genug von ihnen hatten, ließen wir sie gehen, und sie schwangen sich sofort in den Sattel. Inzwischen war der photographische Apparat aufgestellt worden, und der Lama hielt sie, den Zügel des einen Pferdes ergreifend, diplomatisch mit einer letzten Frage fest, so daß ich diese drei halbwilden, barhäuptigen, mit Säbeln bewaffneten Reiter noch abknipsen konnte, die nun auf der Abbildung 263 verewigt sind.
Sobald er aber den Zügel losgelassen hatte, schwenkten sie herum und jagten spornstreichs davon, wobei sie sich umsahen, als glaubten sie, daß ihnen eine Flintenkugel folgen würde. Als sie außer Schußweite waren, ritten sie langsamer und sprachen eifrig miteinander; gewiß fragten sie sich, was wir wohl für seltsame Menschen sein könnten, da wir ihnen gegenüber so anständig gewesen seien.
Am 3. September legten wir 29 Kilometer in südsüdwestlicher Richtung zurück, auf flachem, offenem, gleichmäßig ebenem Lande, das reich an Tümpeln und kleinen Seen war und oft ganz vorzügliches Gras aufzuweisen hatte. Keine Hindernisse stellten sich uns in den Weg, und ich[S. 255] nahm als selbstverständlich an, daß der Selling-tso jetzt zwischen uns und den niedrigen Bergen, die sich im Süden nur undeutlich erkennen ließen, liegen müsse. Wir blieben beisammen, und die kranken Kamele folgten standhaft der Karawane. Hier und dort sahen wir große Schafherden mit ihren Wächtern, aber ohne Hunde. Letztere gab es nur bei den Zelten. Aus einem Zelte holten der Lama und Schagdur eine Domba sauere Milch. Nach und nach werden die schwarzen Nomadenzelte immer zahlreicher (Abb. 265) und bilden bisweilen sogar Dörfer. In einem solchen Dorfe machten die Kosaken einen Besuch, und als sie es verließen, folgte ihnen ein Pferd, das besonders munter erschien. Sein Besitzer, ein anderer Mann, ein altes Weib, zwei junge Mädchen und ein Junge liefen mit einem Stricke hinterdrein, um es einzufangen. Doch der Gaul zog es vor, sich ganz zu uns zu gesellen, und wir mußten den Tibetern schließlich wieder zu ihrem Eigentum verhelfen.
Die jungen Mädchen hatten ihr Haar in zahllose kleine Zöpfe geflochten, die vom Scheitel wie Radien auf den Rücken und nach den Seiten herunterhingen und unten der Reihe nach an einen Streifen roten, mit allerlei Zierraten besetzten Zeuges befestigt waren (Abb. 264). Von der Mitte dieses Streifens hing ein breites, buntes, gesticktes Band den Rücken herab. Im übrigen waren sie barhäuptig und trugen gleich den Männern Pelze und Stiefeln. Wo die natürlichen Rosen der Wangen ihren Platz hätten haben müssen, hatten sie die Haut mit irgendeiner rotbraunen Farbe eingeschmiert und hierdurch ein Paar glänzender, dicker Firniskrusten zustande gebracht. Einigen von ihren schwarzen Yaken wurde von unseren Hunden sehr zugesetzt. Die Tiere waren jedoch so klug, sich in die Mitte eines Tümpels zu flüchten, und blieben erst stehen, als ihnen das Wasser bis an den Unterkiefer ging, während die Hunde sie schwimmend umschwärmten. Nun hatten die Yake nur den Kopf zu verteidigen, und an diesem saßen die achtunggebietenden Hörner. Diese improvisierte Wasserpantomime rief in der Karawane große Heiterkeit hervor.
Schon frühmorgens waren sechs Soldaten mit weißen Hüten und Gewehren wie aus dem Erdboden aufgetaucht und uns auf unserer linken Seite, aber in gebührender Entfernung gefolgt. Jetzt zeigte sich rechts von uns eine neue Schar von sieben Mann. Die erste Truppe ritt auf einem großen Umwege weit hinter uns zu der letzteren hinüber, und nun umkreisten sie die Karawane, bald vorn, bald hinten, bald rechts, bald links, zuweilen langsam, zuweilen im Galopp, und führten eine Art Kampfübungen auf, die, wie ich vermute, uns Schrecken einjagen sollten. Da es ihnen nicht gelang, uns zu imponieren, und wir ruhig unseren Weg nach Süden fortsetzten, näherten sie sich von hinten bis auf ein paar[S. 256] hundert Meter Entfernung und redeten unter lebhaftem Gestikulieren mit dem Lama und Schagdur, die zurückgeblieben waren. Bei einem der Zelte saßen sie ab und gingen hinein.
Inzwischen gelangten wir an das Ufer eines gewaltigen Flusses, der von Osten kommt und in dem ich bald den Satschu-sangpo wiedererkannte. Jetzt war die Frage, ob es uns gelingen würde, dieses gewaltige Bett zu passieren. Die Kosaken sollten, während wir am Ufer warteten, eine Furt suchen. Da, wo wir Halt gemacht hatten, teilte eine Schlamminsel den Fluß in zwei Arme; hier probierte es Ördek nackt mit dem Durchwaten. In dem ersten Arme stieg ihm das Wasser bis an den Hals, in dem zweiten nur bis an die Achselhöhlen. Als er umkehrte, versuchte er es an einer anderen Stelle, wo er aber schwimmen mußte. Hier war das Überführen der Kamele also unmöglich, um so mehr, als der Boden aus tückischem Schlamme bestand.
Unterdessen waren die Tibeter auch angelangt und auf einen Hügel am Ufer geritten, wo sie mit lautem Geschrei einen Obo begrüßten und von wo aus sie unsere verzweifelten Versuche, hinüberzukommen, mit größtem Interesse beobachteten. Es lag natürlich nicht in ihrem Interesse, uns Auskunft zu erteilen, und wir fragten sie auch nicht um Rat.
Nach einem kurzen Marsche flußabwärts kommandierte ich Halt und ließ das Lager aufschlagen. Das Boot wurde zusammengesetzt, und mit Ördek als Ruderer maß ich die Tiefen. An einer geeigneten Stelle wollten wir am folgenden Morgen hinübergehen. Die Kamele sollten unbeladen und ohne Packsättel hinüberwaten und sämtliches Gepäck mit dem Boote befördert werden. Ein mehrfaches Seil wurde quer über den Fluß gespannt. Die Tibeter saßen jetzt unterhalb des Lagers, waren mäuschenstill und augenscheinlich über das Rätsel betroffen, wie wir ein ganzes Boot hatten hervorzaubern können. Wir beabsichtigten anfangs, den Übergang in stiller, dunkler Nacht zu bewerkstelligen und am nächsten Morgen verschwunden zu sein, doch daraus wurde nichts, weil wir fürchteten, daß die Kamele sich erkälten könnten. Am Abend beschloß ich, überhaupt nicht über den Fluß zu gehen, sondern seinem rechten Ufer bis zu seiner Mündung in den Selling-tso zu folgen und darauf am Westufer des Sees entlang zu ziehen, weil Littledale schon längs des östlichen gegangen war.
Der Abend war still und klar, und die Stille wurde nur durch das Rauschen des Flusses, die Töne der Balalaika und das Bellen der Hunde in den Zelthöfen der Tibeter unterbrochen.
Die ganze Nacht blieben die Tibeter auf einem Hügel nordöstlich vom Lager liegen, wo auch ihr Wachtfeuer brannte.

Während wir am Morgen darauf mit einer Flußmessung beschäftigt waren,[S. 257] die 68 Kubikmeter in der Sekunde ergab, langte der Häuptling der Gegend mit einigen Soldaten an, ließ sich bei dem Lama nieder und betrachtete unser Tun mit grenzenloser Verwunderung. Er bat um genaue Auskunft über unsere Absichten und erklärte, falls wir geraden Weges nach Ladak ziehen wollten, werde er uns Führer für zehn Tagereisen besorgen und uns Pferde, Schafe und alles, was wir sonst noch brauchten, verkaufen; sei es aber unsere Absicht, nach Lhasa zu gehen, so müsse er erst einen Kurier dorthin senden und wir hätten die Antwort abzuwarten, die vielleicht erst in einem Monat käme. Gingen wir ohne weiteres nach Lhasa, so werde er den Nomaden in der Gegend verbieten, uns überhaupt etwas zu verkaufen, und er werde mit seinen Soldaten alles tun, um unser Vordringen zu hindern. Täte er dies nicht, so würden sowohl er wie seine Leute den Kopf verlieren. Als ich sagte, da würde ihnen recht geschehen, bemerkte er lachend, für uns wäre das freilich vorteilhaft, für sie selbst aber sehr unangenehm. Schließlich teilte ich ihm mit, daß wir weder ihn noch seinen Führer brauchten, da wir selbst wüßten, wohin wir zu ziehen gedächten.
„Ja“, antwortete er unerschrocken, „ihr könnt uns das Leben nehmen, aber solange wir es noch besitzen, werden wir versuchen, euer Vordringen nach Süden zu verhindern.“
Die Kamele wurden eingetrieben, und die Karawane hatte Befehl, so nahe wie möglich längs des rechten Flußufers zu marschieren, während ich und Ördek das Boot bestiegen, um uns von der Strömung nach Westen treiben zu lassen. Mein Sitzplatz war außerordentlich bequem von Kissen und Decken hergestellt, und der Sicherheit halber hatten wir Proviant mitgenommen. Es wurde eine jener unvergeßlichen, herrlichen Fahrten wie vor zwei Jahren auf der Fähre; ich saß in schönster Ruhe und ließ die Landschaft an mir vorüberziehen.
Gerade unterhalb des Lagers machte der Fluß eine scharfe Biegung, so daß wir eine Weile sogar nach Ostnordost trieben. Der Wachthügel der Tibeter bestand aus Konglomerat und rotem und grünem Sandstein und fiel gerade in der Biegung, wo der Fluß schmal war, steil ins Wasser hinunter. Die Strömung war dort ziemlich stark, und als das Boot unmittelbar unter der steilen Wand hinstrich, stimmten die Tibeter ein wildes Geheul an; man konnte befürchten, daß sie uns mit einem Regen von Sandsteinblöcken bombardieren würden. Wir atmeten daher erleichtert auf, als wir unverletzt an ihnen vorbeigekommen waren.
Nachher geht der Fluß nirgends durch anstehendes Gestein und wird ziemlich gerade. Er wird von 4–5 Meter hohen Uferterrassen von Lehm eingefaßt, und das Land wird immer flacher und öder. Das Bett[S. 258] verbreitert sich immer mehr und wird immer reicher an Schlamminseln, die die Wassermasse in mehrere Arme teilen. Ördek half mit dem Ruder, und wir trieben in schwindelnder Fahrt den Satschu-sangpo hinunter; es war herrlich, aber wie selten kommt es vor, daß ein großer Fluß so liebenswürdig ist, gerade in der Richtung unseres Weges zu strömen!
Seine trübe Flut schwenkt dann nach Südwesten ab. Rechts haben wir eine kleinere Bergkette, in deren Tälern mehrere von Schaf- und Yakherden umgebene Zelte liegen. Der hohe Uferwall entzog die Karawane unseren Blicken, aber Tschernoff, der uns zu Pferde begleitete, hielt die Verbindung zwischen uns und ihr aufrecht. Am Nachmittag wurde das Wetter ungünstig, denn es erhob sich ein so starker Südwestwind, daß der Fluß Wellen schlug und die Fahrt gehindert wurde. Ganze Wolken von Sand und Staub wehten uns entgegen. Wir hatten jedoch einen so großen Vorsprung, daß wir ein paarmal auf die Karawane, die noch immer von den Tibetern verfolgt wurde, warten mußten. An dem letzten Punkte, wo Gras zu sehen war, machten wir am rechten Ufer Halt, und hier ließen sich auch die Tibeter nieder.
Jetzt, da sie nicht über Pässe zu gehen brauchten, hielten sich die kranken Kamele noch immer aufrecht. Muhammed Tokta war erschöpft und schien ein Herzleiden zu haben. Mit Kalpet war es noch ebenso, er war still und wortkarg und hatte keine Freunde unter den anderen, die auch behaupteten, daß er gar nicht krank sei, sondern sich nur verstelle, damit er immer reiten dürfe und nicht zu arbeiten brauche. Einer der Kameraden schlug ihn sogar deshalb, weil die anderen nun die Arbeit übernehmen sollten, die er bisher getan hatte. Ich wußte nicht, was ich glauben sollte, aber merkwürdig kam mir die Sache vor, denn der Mann hatte einen riesigen Appetit. Glücklicherweise machte ich ihm keine Vorwürfe, sondern bat nur Tschernoff, ihn zu beobachten. Ich würde es später sehr bereut haben, wenn ich unfreundlich gegen ihn gewesen wäre, denn er war wirklich krank, und unter den anderen war keiner, der seine Partei nahm.
Am Morgen des 5. September sah es drohend aus, aber der Tag wurde klar; leider hatten wir schon von Mittag an starken Gegenwind, doch die Luft wurde immer reiner, und man konnte merken, daß der Wind über einen gewaltigen See hingestrichen war und nicht aus der Steppe stammte. Über mehreren Sandsteinschwellen bildeten sich Stromschnellen, die wir jedoch mit Leichtigkeit passieren konnten. Der Satschu-sangpo ist hier eng und eingeklemmt. Zahllose Schluchten münden wie enge Korridore und Gänge auf beiden Seiten des Flusses. Man merkt deutlich, daß der See einst viel größer gewesen sein muß und daß der Fluß jetzt die[S. 259] alten Sedimente des Sees durchfließt. Die Höhe der Uferterrassen beträgt 6,7 Meter, und sie sind oft senkrecht.
Nach einer scharfen, zeitraubenden Biegung nach Nordosten strömt der Fluß beinahe schnurgerade nach Süden. Nur ein paar Schlammhalbinseln sind vorhanden. Die Terrassen sind bis 8 Meter hoch, werden aber in demselben Verhältnisse niedriger, wie sich die Breite des Bettes von 100 Meter auf 400 Meter vergrößert. Der Wind weht gerade in diesen eigentümlichen Abflußkanal hinein. Die Jolle stampft fühlbar, und die Fahrgeschwindigkeit ist unbedeutend, obgleich Ördek mit dem Ruder unverdrossen arbeitet. Fern im Süden verschwinden die markierten Linien der Terrassen, eine grenzenlose Perspektive öffnet sich großartig und bezaubernd. Die Breite beträgt jetzt wohl 500 Meter und die Tiefe ziemlich gleichmäßig etwa 1 Meter; die Terrassen werden noch niedriger und sind schließlich nur 1 Meter und noch weniger hoch. Weit konnte es nach dem Selling-tso nicht mehr sein, wie weit aber, war unmöglich zu bestimmen, denn die Luftspiegelung über den Wasserflächen erlaubte uns kein Urteil. Nur die am Ostufer des Sees liegende Bergkette zeichnete sich deutlich ab, aber sie schien über dem Boden zu schweben und auf einer Luftschicht zu ruhen, die auf verwirrende Art spielte und zitterte. Ebenso ist es mit den Kamelen, die zwei Kilometer westlich von uns marschieren; sie scheinen auf langen, schmalen Stelzen zu gehen, und die ganze Karawane schwebt gleichsam in der Luft.
Nun aber öffnet sich der Fluß trompetenförmig zu einem großartigen Ästuarium; die Breite vergrößert sich auf 1 und 2 Kilometer, schließlich verschwinden auf beiden Seiten die Ufer, und vor uns dehnt sich die gewaltige, blaugrüne Fläche des Selling-tso aus. Die Flußterrasse hatte ebenfalls von 1 Meter bis 10 Zentimeter an Höhe abgenommen, und schließlich lag der Schlamm mit dem Wasserspiegel in gleicher Höhe. Noch fuhren wir jedoch auf Flußwasser, das im Gegensatz zu dem herrlichen, frischen und sicherlich salzigen Wasser dort draußen grau und trübe aussah. Zunächst war der See so flach, daß wir einen weiten Umweg machen mußten, um an das nordwestliche Ufer gelangen zu können, wo einige der Unseren mit Pferden warteten, um uns und das Boot nach dem Lager zu befördern. Der Südwind war jetzt so frisch, daß der See sich mit Schaumköpfen bedeckte, und wir hielten es für geraten, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und das Boot in eine Bucht hineinzuschleppen. Eine Stunde später waren wir wohlbehalten in dem neuen Lager, in dessen Nähe drei tibetische Zelte aufgeschlagen waren.
Die Karawane hatte ebenfalls einen guten Tag gehabt, obwohl die Tibeter sich mausig gemacht hatten. Bei zwei Gelegenheiten waren die[S. 260] Kosaken nach in der Nähe liegenden Zelten geritten, um Proviant zu kaufen, sofort aber waren die Späher ihnen zuvorgekommen und hatten jeglichen Handel untersagt. Die Kosaken waren einer Karawane von 200 Schafen mit Salzlasten begegnet und hatten auch mit den Besitzern verhandelt. Sogleich war der Anführer erschienen und hatte in gebieterischem Ton mit seinen Landsleuten gesprochen, was zur Folge hatte, daß diese durchaus nicht zu bewegen gewesen waren, etwas zu verkaufen. Die Kosaken, die von Natur hitziger waren als ich, ließen darauf den Tibetern durch den Lama sagen, daß sie sich, wenn sie uns nur folgten, um uns am Kaufen von Lebensmitteln zu verhindern, künftig gefälligst außer Schußweite halten möchten, denn sonst würden sie augenblicklich niedergeschossen werden. Da verschwanden sie denn auch spurlos für den Rest des Tages. Dank diesem Manöver konnte die Karawane ungehindert nach den drei Zelten gelangen, wo sie freundlich von den zwölf Bewohnern empfangen wurde, welche sehr entgegenkommend waren und gern ein Schaf, Milch, Butter und Fett verkauften. Sie hatten noch keinen Befehl von dem hartherzigen Häuptlinge erhalten, der uns aus dem Lande hinaushungern zu können glaubte. Als sie uns nachher besuchten, wurden sie mit Tee, Brot und Tabak bewirtet, erhielten kleine Geschenke, wie einige Messer, einen Kompaß und ein paar Stücke Zeug, und sie waren über die Maßen entzückt. Ihre Gegend nannten sie Schannig-nagbo (die schwarze Mütze).
Während des Rasttages herrschte heftiger Wind, Gewitter und Hagel. Ich hielt es für klug, nun, da sich die Gelegenheit bot, noch einige Schafe zu kaufen und den Proviant zu vermehren. Dies geschah noch im letzten Augenblick, denn schon um 9 Uhr langte eine Reiterschar von etwas über 50 Mann an; sie schlugen ein paar Kilometer von uns zwei Zelte mit blauweißen Dächern auf. Erst gegen 1 Uhr ließen sie etwas von sich hören und unterhandelten auf neutralem Gebiete zwischen beiden Lagern mit dem Lama. Auf ihre Botschaft ließ ich antworten, daß ich, wenn es ihrem vornehmsten Anführer nicht beliebe, sich persönlich bei mir einzustellen, überhaupt nicht mit ihnen unterhandeln würde. Er kam auch, von zehn mit Säbeln bewaffneten Leuten begleitet. Nur mit Schwierigkeit konnten wir sie dazu bewegen, in das Küchenzelt einzutreten, wo auf einem Sessel Tee, Brot und Tabak aufgetragen waren, doch sie rührten die Bewirtung nicht an, — sie dachten wohl, daß sie von Menschen, die ohne Erlaubnis im Lande umherzogen, schicklicherweise nichts annehmen dürften.


Nun entspann sich die gewöhnliche zwecklose Unterhandlung. Der alte Häuptling, der übrigens ein sehr netter, liebenswürdiger Herr von angenehmem Äußern und aufrichtig in seiner Rede war, bat, als alles nichts half, wir möchten doch wenigstens noch vier Tage hierbleiben, während[S. 261] er Kuriere nach Lhasa senden und die Antwort des Dewaschung oder „Heiligen Rates“ in jener Stadt erwarten wolle. Ich sagte ihm, wir hätten keine Zeit dazu und gedächten morgen südwärts weiterzuziehen.
„Dann folgen wir euch, und wir werden euch schon daran verhindern, nach Lhasa zu gehen; wir erhalten bald Verstärkung.“
„Wenn ihr uns daran verhindern wollt“, antwortete ich, „so müßt ihr schießen, bedenkt aber, daß auch wir Gewehre haben.“
Da schüttelte der alte Mann den Kopf und versicherte, daß sie nie daran gedacht hätten, zu schießen, und fügte hinzu, daß so harte Worte zwischen uns nicht gewechselt zu werden brauchten. Ein paar Geschenke, die ihm angeboten wurden, schlug er aus, fügte aber hinzu:
„Wenn ihr hier vier Tage wartet, werde ich eure Gaben mit Vergnügen annehmen und erwidern, außerdem sollt ihr alles haben, was ihr für die Reise nach Ladak an Proviant und Karawanentieren braucht.“ —
Am Abend kam Kalpet in mein Zelt und beklagte sich schluchzend, daß einer der Leute ihn geschlagen habe. Ich hielt ein Verhör ab und ermahnte alle, freundlich gegen ihn zu sein, und Tschernoff, welcher der Oberaufseher der Karawane war, erhielt noch speziell den Auftrag, ihn zu pflegen. Der Mann tat mir schrecklich leid, denn er war eine Verkörperung der trostlosesten Verlassenheit, und nie werde ich den kummervollen Blick vergessen, der in seinem Auge lag und der sich in unendliche Dankbarkeit verwandelte, als ich seine Partei nahm und ihn mit den geeignetsten Drogen der Arzneikiste behandelte. Als ich ihn später besuchte, aß er mit gutem Appetit Reispudding, und ich glaubte, daß er an vorübergehender Bergkrankheit leide.
[S. 262]
Einer der Kamelveteranen von Kaschgar, der mehrere unserer Wüstenreisen mitgemacht hatte, war nicht mehr imstande, sich zu erheben, als wir am 7. September vom Lager 75 und den Steppen der „schwarzen Mütze“ fortzogen. Er wurde daher getötet; sein Skelett sollte als Andenken an unseren Besuch liegenbleiben.
Als die Karawane beladen wurde, kam der Bombo und machte einen letzten verzweifelten Versuch, uns zum Bleiben zu bewegen. Ich erklärte ihm rund heraus, daß unser Weg nach Süden führe. Da schwieg er und ging seiner Wege.
Wir folgten nun auf hartem, ebenem, vortrefflichem Boden dem Seeufer nach Westsüdwest. Rechts von unserem Wege erhebt sich ein jäh abfallender Landrücken, an dessen Fuß die Tibeter entlangreiten, — sie sind jetzt 63 Mann stark. An einem Punkte, wo der See nach dieser Richtung hin ein Ende zu haben schien, zeigte die Weide ganz vortreffliches, dichtes, üppiges Gras; daher rasteten wir dort der Tiere wegen eine Weile. Nun kamen die Tibeter ebenfalls herangesprengt, schlugen in unserer Nähe ihre Zelte auf, sattelten ihre Pferde ab und ließen sie grasen. Sie nahmen wohl fest an, daß auch wir hier lagern würden. Bald darauf zeigten ihre Feuer, daß sie zu frühstücken beabsichtigten.
Unsere verdutzten Späher zurücklassend, steuern wir nach Südwesten, während das Seeufer nach Süden und Osten umbiegt. Wir gingen über vier alte Uferlinien, die außerordentlich deutlich von mächtigen Kieswällen markiert wurden, deren letzter und höchster sich wohl 50 Meter über den jetzigen Spiegel des Sees erhob. Von dem Walle hatten wir eine prächtige Aussicht über die blaue, klare Wasserfläche des Selling-tso. Dieser scharfsalzige See ist also in energischem Abnehmen begriffen; er schrumpft periodenweise zusammen und hinterläßt die Wälle als unverkennbare Wahrzeichen seiner früheren Ausdehnung.
Das vor uns liegende Terrain ist jetzt ziemlich eben, bis wir einen[S. 263] neuen Wall erreichen, der nach Nordwesten abfällt, wo sich wieder ein See zeigt. Darauf stehen wir am Rande einer außerordentlich eigentümlichen Bodensenkung, einer eiförmigen Arena, in deren Mitte einige Süßwassertümpel liegen. Unmittelbar südlich erhebt sich ein Bergrücken, der sich in westöstlicher Richtung hinzieht und dessen senkrechte Seitenwände einige hundert Meter hoch sind. Wir zogen nach seinem westlichen Ende. Jetzt tauchten auf einem Hügel acht Tibeter auf und beobachteten uns von dort. Als sie bald darauf wieder verschwanden, ahnte ich, daß wir uns auf einer Halbinsel befanden und daß sie glaubten, uns vorläufig wie in einem Sacke gefangen zu haben.
Sirkin und Schagdur wurden daher vorausgeschickt, um zu rekognoszieren, indes wir langsam weiterzogen. An dem Punkte, wo die Felswand jäh in das Wasser fällt, kamen sie uns entgegen und erklärten, es sei noch derselbe See. Wir waren also auf einer Halbinsel gewandert, die ihre felsgekrönte Front nach Süden kehrt. Es war immerhin den Umweg wert, daß ich die Karte auch an diesem Punkte vervollständigen konnte. In schönster Ruhe wandten wir uns um nach Nordnordosten und entfernten uns ein wenig vom Ufer des Selling-tso.
In einer Felsschlucht „fand“ Tscherdon zehn mit Fett gefüllte Schafmagen und nahm vier davon mit. Ganz dicht bei einem am Ufer liegenden kleinen Zeltdorfe lagerten wir. Die Gegend hieß Tang-le; die Bewohner waren nette Leute, weigerten sich aber ganz entschieden, etwas zu verkaufen. Ich zeigte ihnen die Fettmagen und fragte, was sie kosteten. Drei Tsos (die landesübliche Silbermünze in Lhasa, zirka 60 Pfennig) das Stück, antworteten sie; da mir aber der Preis viel zu hoch war, gab ich ihnen ihr Fett wieder und ließ sie gehen, nachdem sie die Bemerkung des Lama, daß, wenn wir nicht so gute Menschen gewesen wären, wie wir nun einmal seien, wir alle zehn Magen einfach hätten behalten können, gleichgültig angehört hatten, ohne ein Wort zu sagen.
Die Tibeter lagerten ein paar Kilometer von uns, außer fünfzehn Mann, die ihr Zeltdorf bei unserem Lager aufschlugen. Im Laufe des Abends führten sie verschiedene Manöver und Kampfspiele aus und schossen nach der Scheibe. Beinahe den ganzen Tag fiel dichter Regen, und ein paarmal fuhren heftige Windstöße mit solcher Gewalt über das Land hin, daß wir Halt machen und warten mußten. Mit Kalpet wurde es immer schlechter, er mußte auf seinem Reitpferde festgebunden werden, um nicht herabzufallen. Tschernoff war sein Krankenpfleger und ritt neben ihm. Am nächsten Morgen bat der Kranke, zurückgelassen zu werden, welche Bitte natürlich nicht gewährt wurde. Statt dessen wurde er so bequem wie möglich zwischen zwei Zeltballen auf ein Kamel gebettet.
[S. 264]
Wenn nicht so frischer Wind gegangen wäre, würde ich den Weg über den See eingeschlagen haben, nun aber mußte ich mit der Karawane am Nordufer, das sich ziemlich gerade nach Westen hinzieht, entlangmarschieren. Sobald wir anfingen zu beladen, machten sich auch die Tibeter bereit, und nach einem Marsche von einigen Kilometern ritt unser alter Bombo mit zwölf Mann an uns heran und machte einen letzten verzweifelten Versuch, uns zu bewegen, geraden Weges nach Ladak zu ziehen. Als ich ihm jedoch sagte, ich ginge, wohin es mir passe, und er würde uns keine Furcht einjagen können, wenn er auch zehntausend Mann aufböte, sah er sehr niedergeschlagen aus und teilte mir mit, er werde uns jetzt unserem Schicksal überlassen und nach seinen Zelten im Nordwesten zurückreiten, worauf ich ihm glückliche Reise wünschte. Die Schar verschwand denn auch in jener Richtung, und es war wirklich schön, im Laufe des Tages unbelästigt zu bleiben. Erst gegen Abend tauchten in der Ferne zwei Reiter auf, offenbar Kundschafter, verschwanden aber wieder zwischen den nördlich von unserem Wege liegenden Hügeln.
Auch hier sind alte Uferwälle deutlich ausgeprägt, manchmal kann man auf einem solchen stundenlang wie auf einer Straße reiten. Nach Süden hin erstreckt der See seinen gewaltigen, blau und grün schillernden Spiegel bis in die weite Ferne.
Schließlich biegt das Seeufer nach Südwesten und Südsüdwesten ab. Zwischen einem Gewirr von Schlamminseln war das Wasser süß, hier mußte also ein Fluß münden. In kurzem gelangten wir an sein Ufer, und Schagdur machte bald eine vortreffliche Furt mit hartem Kiesboden ausfindig. Das Wasser war kristallklar, der Fluß mußte also von einem weiter aufwärts im Tale gelegenen See kommen. Beim Rekognoszieren hatte Schagdur einige Wildenten gesehen und vier geschossen, die flußabwärts trieben und von uns aufgefischt wurden. Zwei anderen, die nur verwundet waren, gelang es, an uns vorbei nach der Mündung zu kommen. Tscherdon ritt jedoch kühn mitten in den Fluß hinein und köpfte die eine mit seinem Säbel. Die andere verschwand zwischen den unzähligen Möwen, die sich in dem Mündungsgebiet aufhielten und das Wasser weißgetüpfelt erscheinen ließen. Ihre Anwesenheit schien auf das Vorkommen von Fischen in diesem Flusse hinzudeuten. Der Platz war viel zu einladend, als daß wir daran hätten vorbeigehen können; wir lagerten auf dem Gipfel der rechten Uferterrasse.

Kaum war das Lager errichtet (Abb. 266), so sahen wir schwarze Linien im Nordwesten und Nordosten. Es waren unsere zudringlichen Wachen; von Nordwesten kamen 53, von Nordosten 13, sie hatten jetzt eine nicht geringe Anzahl Packpferde bei sich. Sie waren augenscheinlich nur fortgewesen,[S. 265] um sich zu verproviantieren und sich für einen längeren Feldzug zu rüsten. Sie gingen an derselben Stelle wie wir über den Fluß und jagten dann in wildem Laufe vor, hinter und durch die Zelte, als wollten sie uns niederreiten! (S. bunte Tafel.) Doch, während sie heulten und ihre Lanzen über dem Kopfe schwangen, schienen sie uns nicht zu bemerken; sie streiften uns mit keinem Blicke, sondern ritten nur vorbei wie ein Wirbelwind, wie eine rollende Lawine. Die Schar sah malerisch aus in ihren bunten Gewändern und oft recht schönen Säbeln, ihren an den Gabelenden der Flinten befestigten weißen und roten Fähnchen und den Schwertern in silbernen Scheiden.
Im Südwesten von uns machten sie zu einer längeren Beratung Halt. Drei Männer traten vor, und die anderen sammelten sich in drei verschiedene Gruppen um sie, wie es schien, um zu lernen, wie mit Flinten umgegangen wird, denn diese waren die ganze Zeit über Anschauungsmaterial. Von Zeit zu Zeit stießen alle auf einmal ein seltsames Geheul aus. Dann wurden die Zelte aufgeschlagen, und die Männer ließen sich an ihren Feuern nieder.
Das Lager der Tibeter war auf einer unbedeutenden Anhöhe, die unsere Zelte beherrschte, aufgeschlagen, und die Kosaken hatten beobachtet, daß alle Flinten in eine Reihe mit der Mündung nach unserem Lager gelegt worden waren. Sie meinten, es sehe aus wie eine Schützenlinie und es sei nicht unmöglich, daß wir über Nacht einem mörderischen Feuer ausgesetzt werden sollten. Daher begab ich mich, als es dunkel geworden war, mit dem Lama und Schagdur nach dem Lager der Tibeter und ging in das Zelt des Bombo, wo ich höflich bewillkommnet und mir Tee und Tsamba vorgesetzt wurden. Innerhalb einer Minute war das Zelt vollgepfropft von Tibetern. Ich weigerte mich, an der Mahlzeit teilzunehmen, weil, wie ich sagte, der Bombo nicht angerührt habe, was ihm bei uns angeboten worden sei. „Re, re, re“, rief er („Wahr, wahr, wahr“). Er fragte nach meinem Namen, und ich erwiderte ihm, daß er ihn erfahren solle, wenn er mir sage, wie der Fluß heiße; er hatte aber keine Lust, auf den Tausch einzugehen. Später erfuhren wir jedoch, daß der Fluß Jaggju-rappga hieß. Auf meine Frage, ob es im Flusse Fische gebe, wurde mir geantwortet. „Ja, in großer Menge.“ Ich versprach, den nächsten Tag hierzubleiben, aber nur unter der Bedingung, daß sie mir, um die Wahrheit ihrer Worte zu beweisen, bei Sonnenaufgang einen mittelgroßen Fisch in mein Zelt brächten. Sie versprachen, ihr Bestes zu tun, und erhielten leihweise ein Netz, von dem sie aber gar nicht wußten, wie sie es benutzen sollten.
Am frühen Morgen erschienen vor meinem Zelt einige Tibeter mit[S. 266] dem Netze, in dessen Maschen ein kleiner Fisch gefangen war. Sie waren mit ihrer Beute sehr zufrieden und versicherten, daß sie bei dem Fange beinahe umgekommen seien. Unsere Wachtposten hatten indessen beobachtet, daß einige Tibeter sich mit Tagesgrauen nach der Flußmündung begeben und dort eine Möwe belauert hatten, als sie gerade einen Fisch gefangen hatte. Diese hatten sie durch Steinwürfe gezwungen, ihre Beute an einer leicht erreichbaren Stelle fallen zu lassen. Unserem Versprechen gemäß blieben wir auf alle Fälle hier, um zu fischen.
Tscherdon und alle Muselmänner, außer unseren erfahrenen Lopfischern Kutschuk und Ördek, sollten das Lager bewachen; die drei übrigen Kosaken durften mitkommen. Von einer Masse von Tibetern gefolgt und von einem Kamele, welches das Boot trug, begleitet, ritten wir am rechten Ufer aufwärts, bis wir an eine Biegung gelangten, wo der Fluß zwei kleine Wasserfälle bildet, von denen der obere meterhoch ist, der untere aber nur 30 Zentimeter Fallhöhe hat. Hier donnert und kocht die Wassermasse in fest verkitteten Geröll- und Tonschlammschwellen. Das Bett ist eng und so tief, daß das Wasser blauschwarz aussieht. Unterhalb des unteren Wasserfalles bildet sich ein langsamer Wirbel, in den das Netz vom Ufer aus spiralförmig hinabgesenkt wurde. Dadurch, daß wir in einer Kurve ruderten, mit den Rudern schlugen, schrien und lärmten, jagten wir die Fische in das Netz hinein und fingen jedesmal zwei bis drei von ihnen. Nachdem ich 28 Stück gefangen hatte, ließ ich die anderen weiterfischen. Die Kosaken angelten vom Ufer aus und hatten auch guten Fang. Tschernoff schoß einige Wildenten, die wir mit dem Boote auffingen. Kurz, wir hatten einen entzückenden, erfrischenden Tag und eine angenehme Abwechslung nach den langen, anstrengenden Karawanenmärschen. Daß der Hagel alle Augenblicke auf uns niederprasselte, störte uns wenig; die Tibeter saßen auf der Uferterrasse und glichen, schwarz wie sie waren, einer Reihe Krähen auf einem Dachfirst.
Vom Fischereiplatze trieb ich mit schwindelnder Fahrt nach dem Lager zurück. Eine Schar Wildenten flog eilig vor uns her; wir fuhren weiter bis an die Stelle, wo sich der Fluß in den Selling-tso ergießt, und von dort ging ich nach Hause, während Ördek die Jolle nach dem Lager zurückrudern und stoßen mußte. Der Fluß sollte nämlich gemessen werden, und dabei ergab sich, daß er 34,6 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führte.
Dreißig Tibeter mit dem Bombo an der Spitze besuchten mich am Abend. Sie waren so freundlich, mir zwei Schafe und drei Kübel voll prächtiger Milch zu schenken, wahrscheinlich als Belohnung dafür, daß wir, wie sie uns gebeten hatten, einen Tag hiergeblieben waren. Sie durften jetzt den Tönen der Spieldose lauschen und mehrere unserer Sehenswürdigkeiten[S. 267] betrachten, und der Bombo nahm die Geschenke an, die ihm angeboten wurden.
Die Kosaken sahen dem Scheibenschießen der Tibeter zu. Der Abstand betrug nur 40 Meter, und ein kleines Holzbrett an einer Stange diente als Scheibe. Von dreißig Schützen vermochten nur drei das Brett zu treffen — ein mehr als klägliches Resultat. Die Kosaken baten, auch einen Versuch machen zu dürfen, aber darauf wollten sich die Schützen durchaus nicht einlassen; sie fürchteten wohl, übertroffen zu werden.
Als ich am nächsten Morgen geweckt wurde, waren die Lopleute schon eine gute Weile beim Fischen gewesen, und ich wies daher den Entenbraten, der sonst hätte mein Frühstück bilden sollen, zurück.
Der Morgen versprach mehr, als der Tag halten konnte. Er war schön und sonnig, aber kaum waren wir in Gang gekommen, so zogen die schwarzblauen Wolkenwände, die am Horizonte lauerten, herauf und entluden ihren Inhalt. Die Folge davon waren Hagel, Sturm, nasser Schnee und Platzregen, so daß der Boden wieder naß und schlüpfrig wurde. Der Tagemarsch war demnach in mehrerer Beziehung düster. Die Tibeter ermüdeten uns mit ihrem ewigen Quälen, daß wir umkehren sollten, und mit unseren beiden Kranken sah es auch schlecht aus; besonders Kalpets Zustand hatte sich sehr verschlimmert.
Durch das natürliche, imposante Felsentor, das durch eine Unterbrechung der im Süden des Jaggju-rappga-Tales liegenden Kette gebildet wird, ziehen wir nach Südosten. Über den Klüften und Vorsprüngen zur Rechten kreist ein Königsadler, wahrscheinlich derselbe, den wir gestern den Wildenten hatten auflauern sehen. Die Felstauben, die zierlich und elegant auf dem Boden trippelten, schienen vor dem Adler nicht den geringsten Respekt zu haben. Kulane und Orongoantilopen zeigen sich überall; sie, wie die Fische, scheinen gewohnt zu sein, daß sie von den Menschen in Frieden gelassen werden. Auf Delikatessen verstehen sich die Tibeter nicht. „Ebenso gut, wie man Fische ißt“, sagen sie, „könnte man ja Schlangen und Eidechsen verzehren; das ist genau dasselbe.“
Die Bergkette zieht sich wie eine Halbinsel in den See hinein. Auf ihrer Südseite reiten wir durch einen bedeutenden Fluß namens Alla-sangpo, und zu unserer Linken dehnt sich wieder der marineblaue Spiegel des Selling-tso aus. Hier und dort steht am Ufer ein Zelt. Im Südwesten zeigt sich bisweilen eine verwirrende Welt von Bergen, meistens aber verhüllen Regengüsse und Hagelschauer die Landschaft, so daß Dämmerung herrscht und ich ausschließlich nach dem Kompaß marschieren muß. Der Erdboden war ein einziger Sumpf. Die Tibeter ritten einen anderen Weg, und wir zogen es schließlich vor, ihnen zu folgen; doch jetzt machten[S. 268] sie Halt und meinten, daß wir uns selbst helfen könnten! Am Ufer zeigten sich Massen von Wildgänsen, die noch rechtzeitig vor unseren Gewehren flüchteten. Einen Augenblick klärte es sich über dem ausgedehnten See auf, und wir konnten leicht mehrere Stellen wiedererkennen, die wir am anderen Ufer passiert hatten, besonders die kleine Bergkette auf der Halbinsel, auf der wir hatten umkehren müssen.
Links lassen wir auch an unserem Ufer eine derartige kleinere Kette hinter uns zurück. Wir beabsichtigten gerade, zu einer Schwelle in Südsüdosten hinaufzuziehen, als Kutschuk und Chodai Kullu heransprengten und atemlos verkündeten, daß es Kalpet sehr schlecht gehe. Ich eilte dorthin und fand ihn mehr tot als lebendig inmitten der anderen auf einer Decke am Boden liegen. Er bat um Wasser; da es dieses in der Nähe nicht gab, durfte er so viel Milch trinken, als er konnte. Seine Augen hatten einen strahlenden, intensiven, aber glasigen Ausdruck; seine Gesichtsfarbe war gelb, die Lippen weiß.
An einem großen Tümpel mit Regenwasser lagerten wir bei strömendem Regen. Eines der Zelte wurde als Lazarett eingerichtet, und hier fand Kalpet Schutz vor der Witterung. Er lag ganz still und schien keine Schmerzen zu fühlen. Eine leichte Dosis Morphium verhalf ihm zum Schlaf. Der alte Muhammed Tokta, der auch ins Lazarett gebracht wurde, hatte eine schauerliche Krankheit. Sein ganzer Leib war geschwollen und sein Gesicht eine einzige Geschwulst; es war nicht gut für ihn, seinen Unglücksgefährten mit dem Tode ringen zu sehen.
Auch heute Abend kam unser Bombo auf Besuch, und als wir ihn baten, uns Milch aus dem nächsten Zeltdorfe zu besorgen, sagte er, daß die Pocken dort grassierten; falls wir dorthin gehen wollten, könnten wir es tun; er seinerseits danke dafür. Er brachte drei neue Gesichter mit, darunter einen alten, sehr netten Lama. Sie erklärten, direkt von den Gesandten zu kommen, die der Dalai-Lama ausgeschickt habe, um uns zu verhindern, nach Lhasa zu gehen. Dann folgten die gewöhnlichen Unterhandlungen und Bitten, daß wir doch um Himmels willen bleiben möchten, wo wir seien, damit wir nicht nur uns, sondern auch sie nicht ins Unglück stürzten. Die Gesandten von Lhasa seien nicht mehr weit und würden in zwei Tagen hier eintreffen. Ich blieb unbeweglich und sagte ihnen, es sei eine Schande, friedliche Gäste auf diese Weise zu behandeln und uns mit Hunderten von bis an die Zähne bewaffneten Spionen zu umgeben. Wir beabsichtigten nicht, Krieg zu führen, und hätten alles, was wir gekauft, ehrlich bezahlt. Über unsere Pläne würde ich nicht eher Auskunft geben, als bis die Gesandten angelangt seien. Sie waren verblüfft und sahen sehr sorgenvoll aus.
[S. 269]
Um 7 Uhr erhob sich ein so heftiger Sturm, daß das ganze Lager fortzufliegen drohte und die Zelte von der Wucht des Hagels und Regens beinahe zu Boden gedrückt wurden. Nach einem letzten Besuche im Lazarettzelte (Abb. 267), wo Kalpet ruhig schlief und Muhammed Tokta über sein Herz klagte, gingen wir zur Ruhe, um die Sorgen des Tages in den Armen des Schlafes zu vergessen.
Sobald ich am 11. September aufgestanden war, besuchte ich die Kranken. Muhammed Tokta war unverändert; er war bei klarem Bewußtsein und scherzte sogar, hatte aber gemerkt, daß er allmählich das Gefühl in den Fingern verlor. Schlimmer war es mit Kalpet. Er rang mühsam nach Atem, seine Wangen waren eingefallen, aber die Augen hatten ihren Glanz beibehalten. Es schien mit ihm zu Ende zu gehen, aber er sprach vernünftig und sagte, er habe eine „kattik kessel“ (schwere Krankheit) und sei noch kränker davon geworden, daß einer seiner Kameraden ihn vor einigen Tagen geschlagen habe. In Wirklichkeit war es damit, wie sich herausstellte, nicht so schlimm gewesen, aber die Erinnerung daran erfüllte den Sterbenden ganz und gar, und er wußte von nichts anderem zu reden. Der arme Kerl, der dies auf seinem Gewissen hatte, würde jetzt viel darum gegeben haben, wenn er die Sache hätte ungeschehen machen können.
Allmählich schwand das Bewußtsein; er sprach nicht mehr, war total geistesabwesend und starrte in unbekannte Fernen, vielleicht nach dem Paradiese, das der Prophet ihm versprochen hatte. Ich wollte den Tag über hierbleiben, aber die Gegend war so erbärmlich, daß alle für das Übersiedeln nach einem besseren Platze stimmten. Kalpet wurde daher bequem und weich auf sein Kamel gebettet (Abb. 268), und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Wir alle fühlten, daß heute der Tod mit der Karawane zog, und die Stimmung war daher gedrückt und düster.
Es ging nach Südosten. Von der ersten kleinen Paßschwelle sahen wir wieder einen außerordentlich schönen, von niedrigen Bergketten eingefaßten See mit bizarren Ufern vor uns liegen. Das Wasser war kristallhell; daß es diesmal nicht wieder der Selling-tso sein konnte, merkte man bald, denn hier sah man sowohl Wasserpflanzen als auch Fische, und das Wasser war so süß, wie das eines Flusses.
Das linke Seeufer sah bedenklich aus, denn steile Felsen fielen hier jäh ins Wasser hinunter, und ich hielt es daher für das Klügste, Sirkin und Schagdur auf Rekognoszierung auszuschicken. Inzwischen überfiel uns ein gewaltiger Hagelsturm, und Kalpet wurde mit einem Filzteppiche zugedeckt. Die drei neu angekommenen Tibeter ritten an mich heran, um mir zu erklären, daß es auf dem Westufer keinen Durchgang gebe, doch führe auf dem Nordufer ein Weg nach Osten, den wir benutzen könnten,[S. 270] wenn wir durchaus weiter wollten. Ich ahnte sofort, daß etwas dahinter liegen müsse; es blieb mir aber keine Wahl, um so mehr, als nachher die Kosaken die Aussage der Tibeter bestätigten.
Wir zogen also längs des nördlichen Ufers weiter; es wurde eine Wanderung in den schönsten Schlangenlinien. Ein gerade nach Osten gehender Weg führte über die Hügel, aber die Tibeter hielten sich hinter uns und hüteten sich wohl, ihn uns zu zeigen. Wir gingen also am Strande entlang und nahmen so alle Buchten, Landzungen und Halbinseln mit, ohne zu wissen, nach welcher Seite der See ausbog. Wenn wir infolgedessen auch viele unnötige Schritte machten, so erhielt ich doch wenigstens eine getreue Karte des launenhaften Sees, und eine herrlichere Landschaft als diese hatten wir in Tibet noch nicht gesehen. Nach allen Seiten hin öffneten sich großartige Perspektiven in Buchten und Fjorde hinein, die zwischen malerischen, dekorativen kleinen Bergketten mit steil nach dem See abfallenden Abhängen tief in das Land einschnitten. Hier und dort tauchten kleine Inseln auf, gewölbt wie Delphinrücken. Alte Uferlinien waren hier nicht zu sehen, und das süße Wasser sprach dafür, daß der See, der Nakktsong-tso heißt, Abfluß nach einem weiter südlich liegenden Salzsee hat.
Nachdem wir einige Stunden in allen möglichen Richtungen gewandert waren, überraschten wir die Tibeter, die ihre Zelte am Ufer aufgeschlagen hatten und ihre gewöhnliche Teerast hielten. Sie hatten dadurch Zeit gewonnen, daß sie einen Richtweg hinter den Uferfelsen benutzt hatten. Wir zogen an ihnen vorbei, bis der See definitiv nach Südosten abzubiegen schien. Hier traten die Berge vom Ufer zurück, das eben und mit festem Kiese bedeckt war und den Kamelen ein vortreffliches Terrain bot. Am östlichen Ende des Sees lagerten wir bei einem Zeltdorfe. Die Späher waren uns auch diesmal zuvorgekommen und hatten schon ihre Zelte aufgeschlagen.
Kalpet hatte oft gesprochen und besonders Rosi Mollah, seinen Kerijaer Landsmann, gerufen; er hatte um Wasser gebeten und darum, daß seine Lage auf dem Kamele verändert werden möchte, wenn er sich auf einer Seite müde gelegen hatte; manchmal rief er laut und deutlich, das Kamel gehe zu schnell. Als er jedoch in der Nähe des Lagers längere Zeit still gewesen war, hielt die Ambulanz, welche die Nachhut der Karawane bildete, und Mollah horchte. Er holte mich sofort, und es war nicht schwer zu konstatieren, daß mein armer Diener verschieden war. Sein Ausdruck war ruhig und verklärt, aber die Augen hatten ihren Glanz verloren. Er war schon kalt, obwohl es kaum eine Stunde her war, seit er zuletzt um Wasser gebeten hatte. Mollah drückte ihm für immer die Augen zu, und[S. 271] dann setzte die jetzt in einen Leichenzug verwandelte Karawane ihren Weg fort. Die Muselmänner hatten, wie gewöhnlich, gesungen, um sich den Marsch weniger langweilig zu machen; jetzt aber wurde es still wie in einem Grabe, und nur die Tritte der Tiere auf dem Sande und Kiese des Ufers und das keuchende Atmen der Kamele unterbrachen das Schweigen. Wir standen wieder vor dem furchtbaren, erbarmungslosen Ernste des Todes, und wieder führten wir einen Toten auf einem lebendigen Katafalke mit uns (Abb. 270).
Als wir an den Zelten der Tibeter vorbeizogen, kamen diese uns entgegen, um uns zu sagen, daß es bis zur nächsten Stelle mit Weide noch weit sei. Ich teilte ihnen mit, daß wir einen Toten bei uns hätten, der begraben werden müsse, was sie sehr ruhig anhörten, uns dann aber einen Platz anwiesen, wo dies am besten geschehen könne.
Sobald das Lager fertig war, sprach ich mit Mollah und Turdu Bai über die Beerdigung; sie schlugen vor, sie bis zum nächsten Morgen aufzuschieben und dann mit den üblichen Zeremonien vorzunehmen. Die Leiche wurde für die Nacht in das eine weiße Zelt gelegt und sollte von einem Wächter vor den Hunden geschützt werden.
Kalpets Beerdigungstag, der 12. September, brach strahlend hell und klar an; nur dann und wann segelte in der frischen Seebrise, welche die Wellen ans Ufer rauschen ließ, ein kreideweißes Wölkchen über den Himmel. Das Grab war schon fertig, und im Todeszelte waren Hamra Kul, Mollah Schah und Turdu Bai damit beschäftigt, die Leiche in ein Laken zu hüllen, nachdem sie vorschriftsmäßig gewaschen worden war. Dabei hatten sie sich das Gesicht außer den Augen mit weißen Binden umwunden, um nicht die Leichenluft einatmen zu müssen. Vor dem Zelte saß Rosi Mollah und las laut aus einem Gebetbuche. Das Grab war nicht viel mehr als einen Meter tief, und seine eine Längsseite bildete eine Höhlung, in welche die Leiche hineingeschoben werden sollte. Hierher lenkte der Leichenzug seine Schritte. In eine weiße Filzdecke gewickelt, lag der Tote lang, mager und kalt auf einer Kamelleiter und wurde von Mollah Schah, Islam, Li Loje, Chodai Kullu, Ördek, Hamra Kul und Kutschuk getragen (Abb. 269). Die improvisierte Bahre wurde auf den Rand des Grabes gestellt und Kalpet dann vorsichtig in seine letzte Ruhestätte hinabgelassen (Abb. 271), wobei Mollah Schah und der Mollah mit hinabstiegen, um ihn unter den Vorsprung, der sich über der Aushöhlung in der Seite des Grabes wölbte, zu legen. Der Mollah setzte sich dann und hielt folgende Rede an den Verstorbenen:
„Du bist ein rechtschaffener, rechtgläubiger Muselmann gewesen, du hast niemals einem von uns etwas zuleide getan, du läßt eine Lücke zurück,[S. 272] und wir beweinen dein Hinscheiden, du hast dem Tura gut und redlich gedient.“
Nachdem die beiden Männer aus dem Grabe gestiegen waren, wurde die Kamelleiter quer über die Öffnung gelegt und das Ganze mit einem Filzteppiche bedeckt, dessen Kanten mit Erdschollen beschwert wurden; darauf wurde der Grabhügel über dem Teppiche aufgeworfen, welch letzterer dieses Gewicht natürlich nicht sehr lange würde aushalten können, — es bedurfte nur eines Regens oder des Darüberlaufens umherstreifender Yake, um das Ganze zum Einstürzen zu bringen. Als der Hügel fertig und am Kopfende mit einem ebenso vergänglichen Denkmale aus Erdschollen und einigen dar aufgestellten Steinen verziert war, warfen sich die Muselmänner um das Grab herum auf die Knie, hielten sich die Handflächen vor das Gesicht und murmelten leise Gebete, die nur dann und wann von den Gebetformeln des Mollah unterbrochen wurden.
Und dann war der feierliche Akt vorbei und Kalpet der Erde wiedergegeben. Wir kehren, wie aus einer Kirche, aus einer Sonntagsstimmung in der Wildnis, zu den Sorgen des Alltagslebens zurück. Wir packen unsere Habseligkeiten ein, brechen unsere Zelte ab, beladen unsere geduldigen Kamele, steigen zu Pferd und ziehen von diesem dritten Todeslager fort. Alles erscheint so eitel und zwecklos, wenn man eben am Rande eines Grabes gestanden hat, wo man sich von dem erhabenen Ernste des Lebens und des Todes durchdrungen gefühlt und das Stundenglas ablaufen gesehen hat. Und dann kommt man zu den unbedeutenden kleinen Sorgen eines neuen Tages zurück und setzt seine endlose Wanderung über die Gebirge ohne Rast und Ruhe fort! Auf der Karte steht neben diesem Lagerplatz ein schwarzes Kreuz. Heute ist das Grab sicherlich schon verschwunden. Die Nomaden treiben ihre Herden darüber hin, und ringsumher in den Bergen heulen in den Winternächten die Wölfe. Und sollte das Grab wirklich noch nicht verschwunden sein, so weiß doch keiner, wer der Tote war. Der Rechtgläubige ruht in heidnischer Erde, aber seine Ruhestätte ist doch mit Gebeten aus dem Koran geweiht worden.
Nach der Beerdigung kam Rosi Mollah mit folgendem Anliegen zu mir: „Ehe wir uns nach Beendigung dieser Reise trennen, gebt mir, bitte, ein schriftliches Zeugnis, daß Kalpet eines natürlichen, ehrlichen Todes gestorben ist, damit seine Brüder in Kerija nicht glauben, er sei von mir oder irgendeinem anderen von uns totgeschlagen worden.“ Dies versprach ich, und es geschah auch, worauf das Zeugnis nebst Kalpets Lohn an seine Brüder geschickt wurde.
Die Tibeter, die dem Begräbnisse zusahen, erlaubten sich die Bemerkung, daß wir uns viel zu viel Mühe damit machten. „Werft den[S. 273] Toten den Raben und den Wölfen hin!“ sagten sie. Dies tun sie selbst, wie wir bei einer spätern Gelegenheit mit eigenen Augen sahen.
Die Muselmänner verbrannten das Zelt, in welchem Kalpet aufgebahrt gestanden, seine Kleider und seine Stiefel. Bei der heutigen Gelegenheit waren alle üblichen Zeremonien beobachtet worden; als Aldat starb, war er wie er ging und starb begraben worden.
Heiterlächelnd verjagte der Tag die traurige Erinnerung des Morgens, und wieder entrollte die Erde, auf deren Oberfläche wir ein so flüchtiges, unsicheres Dasein führen, vor uns eine ihrer schönsten Landschaften. Auch jetzt gingen wir durch ein Felsentor im Südosten. Links zeigte sich noch einmal ein Teil des Selling-tso. Von einer niedrigen Paßschwelle erblickten wir nach Süden hin eine offene, weite Ebene, die ganz hinten vom Gebirge begrenzt wurde. Die Tibeter waren uns auf den Fersen. Links von uns lagen einige schwarze und zwei blauweiße Zelte, wohin sie sich begaben. Als wir dicht bei diesem Zeltdorfe waren, sprengte eine Reiterschar an mich heran und überbrachte mir die Nachricht, daß zwei hohe Herren aus Lhasa angelangt seien, weshalb sie uns bitten müßten, der Verhandlungen wegen in ihrer Nähe zu lagern. Anfangs weigerte ich mich und sagte, wir hätten mit diesen Leuten nichts zu schaffen, sondern würden weiterziehen. Doch als es nachher um ihr Lager herum von Soldaten zu wimmeln begann und mir gesagt wurde, daß sie mir Botschaft direkt aus Lhasa brächten, hielt ich es für das Klügste, wenigstens zu hören, was sie eigentlich wollten, und bat die Tibeter, ihren hohen Herren zu sagen, daß ich mit ihnen sprechen würde, wenn sie zu mir kämen.
Jetzt zeigten sich zwei ältere Männer in roten Gewändern. Sie saßen zu Pferd. Vier Fußgänger hielten jedes Pferd am Zügel und führten die hohen Herren zu mir, der ich im Sattel sitzen blieb. Sie grüßten höflich und sahen freundlich und gutherzig aus: die Berichte, die sie während der letzten Tage über uns erhalten hatten, waren sicher zu unserem Vorteil ausgefallen. Sie hatten mir, wie sie sagten, so wichtige Mitteilungen zu machen, daß ich unbedingt bei ihnen lagern müsse; nach vielem Wenn und Aber ging ich schließlich darauf ein.
Doch als wir unser Lager aufgeschlagen hatten, verging eine lange Zeit, ohne daß die Gesandten etwas von sich hören ließen. Ich schickte nun den Lama mit dem Bescheid dorthin, daß sie uns gebeten hätten zu bleiben und sich nun gefälligst sputen möchten, wenn sie mir etwas so Wichtiges zu sagen hätten, da wir sonst wieder aufbrechen würden. Dies half. In ihrem Lager wurde es lebendig. Die beiden Gesandten kamen schleunigst aus dem Zelte und ritten zu uns; die Entfernung betrug kaum 150 Schritt. Der Sicherheit halber umgaben sie sich mit einer starken[S. 274] Eskorte, die jedoch nicht mit Feuerwaffen, sondern nur mit Schwertern bewaffnet war. Sie saßen ab und traten mit artigem Gruße in das Küchenzelt ein, das für Audienzen gewöhnlich ausgeräumt und mit einem bunten Chotaner Teppich geschmückt wurde. Auf diesem Teppich nahmen wir Platz, während draußen ein dichter Kreis von Kosaken, Tibetern und Muhammedanern um das Zelt herum stand. Der Lama, mein Dolmetscher, mußte zwischen uns sitzen.
Sie stellten sich als Mitglieder des „Dewaschung“, des Heiligen Rates in Lhasa, vor, denen der Auftrag geworden sei, mich zu verhindern, nach dieser Stadt zu reisen. Sie wußten, daß ich schon auf einem anderen Wege mit nur zwei Begleitern nach Lhasa zu reiten versucht hatte, aber aufgehalten und von Kamba Bombos Leuten über die Grenze gebracht worden sei. Nun hieß es wieder wie damals: „Nach Süden dürft ihr keinen Schritt weiter“, und dieses Thema wurde drei Stunden lang in allen möglichen Variationen wiederholt.
„Wir haben Millionen Soldaten, und wir werden euch daran verhindern!“
Als ich fragte, was sie wohl machen wollten, wenn wir doch nach Süden gingen, antworteten sie, das würde entweder ihnen oder uns den Kopf kosten.
„In unserer Order steht, daß wir enthauptet werden, wenn wir euch hier durchlassen, und dann können wir lieber erst mit euch kämpfen; das ganze Land ist voller Soldaten.“
Ich bat sie, sich unserer Köpfe wegen ja nicht aufzuregen, da sie an diese doch nicht herankönnten, denn teils hätten wir Beistand von höheren Mächten, teils besäßen wir fürchterliche Waffen.
Beide Gesandten wurden außerordentlich aufgeregt, schrien, schwitzten und gestikulierten, und als ich trotzdem ruhig blieb und ihre Drohungen mit trocknem Lachen erwiderte, platzten sie beinahe vor Ärger.
„Kari-sari? (was sagt er)“, fragten sie unaufhörlich.
„Er sagt, daß er nach Süden weiterziehen will.“
„Mig jori (wenn er Augen hat), wird er morgen sehen, wie wir eure Karawane zurücktreiben“, riefen sie; unaufhörlich schrien sie „mig jori, mig jori!“
Ich lachte nur und erwiderte schließlich:
„Mig jori, wenn ihr Augen habt, so paßt morgen auf, wenn wir südwärts ziehen; haltet aber eure Flinten bereit, denn es wird euch heiß um die Ohren werden!“
Da schlugen sie einen anderen Ton an und baten flehentlich, wir möchten doch endlich die Reise nach Süden aufgeben. Wenn wir auf demselben Wege, den wir gekommen, wieder umkehren wollten, sollten wir[S. 275] Führer und Proviant und alles, was wir nur brauchten, haben, ja, dann würde alles in jeder Hinsicht gut werden.
Ich hatte gar nicht die Absicht, noch weiter „wider den Stachel zu löcken“; tatsächlich hatte ich für diesmal genug von Tibet und sehnte mich nach Ladak und noch mehr nach Hause, nach meiner schwedischen Heimat. Spaßeshalber aber sagte ich noch einmal, daß alle ihre Versuche vergeblich seien.
„So“, antworteten sie, „nun gut, wir werden nicht auf euch und eure Leute schießen, aber wir werden eure Reise unmöglich machen!“
„Wie soll das geschehen?“
„Zehn, zwanzig von unseren Soldaten werden je einen eurer Reiter festhalten, und ebenso viele jedes Kamel, wir werden eure Tiere festhalten, bis sie nicht mehr stehen können und stürzen.“
„Wenn wir dann aber auf euch schießen?“
„Das macht nichts; wir werden auf jeden Fall getötet, wenn wir euch durchlassen. Wir haben bestimmte Befehle aus Lhasa erhalten.“
„Zeigt mir sie, dann werde ich nicht weiter nach Süden gehen“, antwortete ich.
„Sehr gern“, sagten sie und ließen das Papier aus dem Zelte der Gouverneure holen. Es wurde von dem jüngeren Gesandten vorgelesen und war ein recht merkwürdiges Aktenstück. Schereb Lama las mit und konnte kontrollieren. Nach einer ersten Vorlesung und Übersetzung nahmen wir es langsam Punkt für Punkt noch einmal durch, so daß ich es in mongolischer Sprache mit lateinischen Buchstaben abschreiben konnte. Später übersetzte ich es ins Schwedische.
Es lautete, wie folgt. Zuerst die Adresse auf der Außenseite des zusammengefalteten Papieres:
„Im Jahre der eisernen Kuh, den sechsten Monat, am 21. Tage. Dieses Schreiben soll den beiden Gouverneuren von Nakktsong zu Händen kommen. Es ist vom Dewaschung und wird mit der Post befördert. Im siebenten Monate, am 22. Tage muß es angelangt sein.“
Und dann das Schreiben selbst:
„Im Jahre der eisernen Kuh, im sechsten Monate, am 19. Tage ist hier von dem Gouverneur von Nakktschu ein Schreiben angekommen, daß der Sekretär der Mongolen Tsange Chutuktu, der Lama Sandsche, nebst mehreren Pilgern die Wallfahrt nach Dscho-mitsing in Hamdung gemacht hat und er sowohl wie Tugden Dardsche dem Gouverneur von Nakktschu (also Kamba Bombo) gewisse Mitteilungen gemacht haben.
„Der Gouverneur von Nakktschu hat (seinerseits) dem Dewaschung (folgende) Mitteilungen gemacht. Tsanges Sekretär hatte gesagt, daß er um die Zeit, als er sich auf den Weg gemacht, europäische Männer[S. 276] gesehen habe und eine Strecke weit in ihrer Gesellschaft gereist sei. Nachdem sie eine Menge Kleidungsstücke gekauft, seien sie weitergezogen. Im Basare habe er zwei Russen gesehen. «Wohin reist ihr», habe er gefragt, «seid ihr Lamas?» «Wir sind Lamas», hätten sie geantwortet. Der Arzt Schereb Lama, ein Chalchamongole, sei mit ihnen zusammengereist und ihr Führer gewesen. Unterwegs habe er sechs russische Leute marschieren sehen. Eine Menge Kamele und Leute seien im Anzuge.
„Nach Namru und Nakktsong sollen schleunigst Schreiben abgesandt werden, so daß es überall bekannt wird, daß von Nakktschu an und landeinwärts, soweit mein (d. h. des Dalai-Lama) Reich reicht, russische (europäische) Männer keine Erlaubnis erhalten, nach Süden zu ziehen. An alle Häuptlinge sollen Schreiben erlassen werden. Bewacht die Grenzen von Nakktsong; es ist notwendig, das Land Stück für Stück streng zu bewachen. (Diese Stelle lautet auf Mongolisch. “Nakktsäng-tsonguin tsachar hara, gadser gadser sän harreha kerekté„. Die Provinz wird hier also «Nakktsäng-tsong» genannt, aber sonst hörten wir sie stets kurzweg «Nakktsong» nennen, wie auch der See Nakktsong-tso hieß.) Es ist absolut unnötig, daß europäische Männer in das Land der heiligen Bücher kommen, um sich dort umzusehen. In der Provinz, die euch beiden untertan ist, haben sie durchaus nichts zu suchen. Wenn sie sagen, daß es notwendig sei (so wisset), daß diese beiden Anführer nicht nach Süden reisen dürfen. Sollten sie dennoch ihre Reise fortsetzen, so verliert ihr euren Kopf. Zwingt sie, umzukehren und den Weg, auf dem sie gekommen sind, wieder zurückzugehen.“
Durch dieses Schreiben kam für uns Licht in verschiedene Punkte, die uns bisher dunkel geblieben waren. Lama Sandsche und Tugden Dardsche gehörten zu der Karawane von mongolischen Pilgern, die im Mai 1900 Tscharchlik passiert hatte. Schon in Korla und Kara-schahr waren sie mit meinen burjatischen Kosaken und mit dem Lama zusammengetroffen, und die Mitteilungen, die sie hierüber gemacht hatten und die hier in dem Dokumente angeführt waren, entsprachen in der Hauptsache der Wahrheit. „Eine Menge Kamele und Leute“, bezieht sich auf die große Karawane unter Tschernoff und Turdu Bai.
Sobald sie in Nakktschu angelangt waren, hatten sie Kamba Bombo über alles Geschehene Bericht erstattet, und dieser hatte sofort einen Kurier nach Lhasa an den Dewaschung gesandt. Der Kurier langte am 19. des 6. Monats in Lhasa an, und schon am 21. wurde das ganze Land im Norden und Westen der Hauptstadt, besonders die Provinzen Namru und Nakktsong, benachrichtigt, daß scharf aufgepaßt und das Eindringen von Europäern in das Land verhindert werden müsse. Der Ausdruck „die Provinz, welche euch beiden untertan ist“ beweist, daß das Schreiben, welches[S. 277] mir jetzt vorgelesen wurde, besonders an die beiden Gesandten, die uns hier am Nakktsong-tso den Weg versperrten, gerichtet war. Der ältere hieß Hladsche Tsering, der jüngere Junduk Tsering. Sie sind also die Gouverneure von Namru und Nakktsong. Doch nach anderen Aufklärungen, die wir erhielten, scheint es, als hätten sie sich zur Zeit von Kamba Bombos Schreiben zufällig in Lhasa aufgehalten und dort die eben angeführte Order persönlich in Empfang genommen. Ihnen waren auch eine Menge Einzelheiten von meinem ersten Vordringen nach Lhasa und von Kamba Bombos Art und Weise, uns festzunehmen, bekannt. Mit „diese beiden Anführer“ sind sicherlich Tschernoff und Sirkin gemeint, denn wir hatten, als Kamba Bombos Leute uns festnahmen, erklärt, daß im Hauptquartiere zwei Europäer seien, die Rache nehmen würden, wenn uns ein Leid widerführe. Wie wir gefürchtet, hatten die mongolischen (tangutischen) Pilger uns einen bösen Streich gespielt! Doch auch ohne ihre Angeberei hätten wir bald festgesessen, denn sowohl Kamba Bombo wie jetzt Hladsche Tsering erzählten, daß Yakjäger, die uns gesehen, sofort Bericht darüber erstattet hätten.
Ich konnte darauf nichts weiter erwidern, als daß alles in Ordnung und sie völlig in ihrem Rechte seien, uns den Weg zu versperren, und ich sagte ihnen ehrlich, daß die von ihnen beobachtete Absperrungspolitik die einzige sei, die ihr Land vor dem Untergange bewahren könne.
„Rund um Tibet herum, im Norden, im Süden und im Westen haben die Europäer entweder die Länder eurer Nachbarn erobert oder sie von sich abhängig gemacht; jetzt geht auch China allmählich unter, euer Land ist in Asien das einzige, das noch unberührt ist.“
„Re, re“, antworteten sie, „so wollen wir es haben! Es tut uns euretwegen sehr leid, daß ihr nicht nach Lhasa reisen könnt, aber wir müssen unseren Befehlen gehorchen. Für uns wäre es viel angenehmer gewesen, wenn wir Befehl erhalten hätten, euch nach Lhasa zu führen und euch alles zu zeigen.“
Um eine Aufklärung zu erzwingen, fragte ich, ob sie etwas dagegen hätten, meinen chinesischen Paß nach Lhasa zu schicken, während welcher Zeit wir ja die Antwort zusammen erwarten könnten.
„Unter keiner Bedingung, und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat der Kaiser von China hier bei uns überhaupt nichts zu sagen, und zweitens würden wir dann beim Dewaschung in den Verdacht geraten, in eurem Interesse tätig zu sein, und im günstigsten Falle abgesetzt werden.“
Schereb Lamas Name kam in dem Dokumente vor. Hier hatten sie ihn leibhaftig vor sich. Sie sagten ihm, daß, wenn es nicht meinetwegen wäre, sie ihn eigentlich mitnehmen und an die Behörden von Lhasa ausliefern müßten, von denen er seine wohlverdiente Strafe erhalten würde, weil er einen Europäer nach Lhasa habe führen wollen. Sein Name sei[S. 278] jetzt in dieser Stadt bekannt und stehe schon im Buche der Verdächtigen. Es sei für ihn selbst das Beste, sich in der heiligen Stadt nie wieder sehen zu lassen. Sie hielten unserem armen Lama eine donnernde Strafpredigt. Aber jetzt, da sein Spiel doch verloren war, nahm auch er kein Blatt mehr vor den Mund; er legte ordentlich los, machte die beiden Gesandten schonungslos herunter und fragte, mit welchem Rechte sie einen Lama züchtigen wollten, der kein tibetischer Untertan sei; er habe von dem chinesischen Gouverneur in Kara-schahr Erlaubnis erhalten, mit mir zu reisen; der Prior seines dortigen Klosters habe gleichfalls seine Einwilligung dazu gegeben, und er werde bei seiner Rückkehr berichten, wie die tibetischen Behörden sich betragen hätten. Da ich fürchtete, daß der Zank in Handgreiflichkeiten übergehen würde, holte ich die große Spieldose, deren Musik wie Öl auf die Wogen wirkte.
Hladsche Tsering war übrigens der Typus eines tibetischen Gentleman, ein wirklich netter, gemütlicher alter Onkel, von dem schließlich alle Mitglieder unserer Karawane, sogar der Lama, entzückt waren (Abb. 272). Niemand wird mir widersprechen, wenn ich sage, daß er viel mehr Ähnlichkeit mit einem runzeligen, alten Mütterchen als mit einem gebieterischen Statthalter hatte. Man betrachte nur das Bild, das ich von ihm zeichnete. Sein völlig bartloses Gesicht, die Art, wie er sein Haar trug, der Zopf, die Mütze mit dem Amtsknopfe, die Ohrringe, alles trug dazu bei, ihm einen so stark femininen Anstrich zu geben, daß ich ihn in vollem Ernst fragte, ob er am Ende nicht doch ein altes Weib sei. Diese Aufrichtigkeit, die manches andere männliche Individuum sehr übel genommen haben würde, machte auf Hladsche Tsering einen ganz guten Eindruck; er lächelte freundlich, nickte und verzog sein Pergamentgesicht zu den muntersten Grimassen, hielt sich die Hand vor die Augen, lachte schließlich derart, daß ihm die Tränen über die Wangen liefen, und versicherte, er sei wirklich ein Mann.
Um 7 Uhr abends ging ich mit Schagdur und dem Lama nach seinem Zelte und kam erst um Mitternacht wieder nach Hause. Jetzt wurde von unseren Plänen kein Wort mehr gesprochen, wir amüsierten uns nur und scherzten miteinander wie zwei junge Studenten. Jeder prahlte mit seinen Waffen. Daher schlug ich vor, Schagdurs Säbel gegen ein tibetisches Schwert zu probieren. Nach der Probe sah dieses wie eine Säge aus, aber später sahen wir auch mehrere von ziemlich gutem Stahl. Hladsche Tsering zeigte uns, daß er auch einige recht brauchbare Revolver hatte.
Sein weißes Zelt mit blauen Streifen und Bändern war sauber und hübsch eingerichtet. An der hinteren Querwand stand eine Art niedrigen Diwans aus Polstern und Kissen und davor ein ebenfalls niedriger Tisch, auf welchem uns Tee, sauere Milch und Tsamba angeboten wurden. Auf[S. 279] der rechten Seite des Diwans (d. h. wenn man darauf saß) stand ein kleiner tragbarer Tempel mit verschiedenen Burchanen (Götterbildern), die vergoldet und zum Teil in „Haddik“ gewickelt waren; unter anderen sah man dort auch den Burchan des Dalai-Lama. Vor ihnen brannten einige Öllampen, und in kleinen Messingschalen waren, wie es auch in den großen Tempeln Brauch ist, den Götterbildern allerlei leicht verdauliche Speisen hingestellt. Sobald man einen Schluck von seinem Tee trank, war sofort ein Diener da und goß die Tasse wieder bis oben voll, selbst wenn dazu nur fünfzehn Tropfen gehörten. Ein eigener Pfeifenreiniger bediente Hladsche Tsering, der aus seiner langen chinesischen Pfeife rauchte und sehr von meinem Tabak entzückt war, weshalb ich ihm eine ganze Blechschachtel davon schenkte.
Der ungefähr 45 Jahr alte Junduk Tsering war weniger intelligent und glaubte, uns durch große Worte schrecken zu können. Er war es, der bei jeder Gelegenheit unübersehbare Heerscharen ins Treffen führte und seine Soldaten nach Millionen rechnete. Ich klärte ihn darüber auf, daß ich seine Krieger selbst gezählt und nur 120 Mann gefunden hätte. Diese Zahl wuchs indessen unaufhörlich, bis sie schließlich beinahe fünfmal so groß war! Ich hatte nicht die geringste Lust, mit ihnen Krieg anzufangen, denn ich hatte ja nur vier Kosaken und überdies, wie jedermann begreifen wird, weder das Recht noch den Wunsch, Gewalt zu brauchen. Wenn wir trotzdem einen ebenso wahnsinnigen wie verwerflichen Schritt getan hätten, wäre es den Tibetern mit ihrer Übermacht eine Kleinigkeit gewesen, uns in irgendeinem Passe den Weg zu versperren. Aber der russische Kaiser hatte mir die Eskorte nicht gegeben, um in Tibet Streit anzufangen, sondern nur als Sicherheitswache für meine Person. Es war für mich also eine Ehrensache, die Kosaken unverletzt wieder zurückzubringen, und ich hatte daher Rücksicht auf sie zu nehmen.
Der gutmütige, ein wenig beleibte und aufgeschwemmte Junduk Tsering war also nur schwach begabt. Unaufhörlich fuhr er sich bei unserem Wortwechsel mit der flachen Hand um den Hals, um zu veranschaulichen, wie wir um einen Kopf kürzer gemacht werden würden, wenn wir weiter nach Süden zögen. Ich sagte ihm gerade heraus, daß er von allen Herren, die ich bisher kennen gelernt, einer der dümmsten sei, und fragte ihn, ob es viele zweibeinige Esel in Lhasa gebe.
Beide Gesandten waren elegant und sauber gekleidet und hatten verschiedene Anzüge, Alltags- und Paradekostüme, warme und leichte, mitgebracht. Sie waren nach chinesischer Mode gekleidet, denn sie trugen Kleiderröcke und Jacken oder Westen von seidenen und wollenen Stoffen. Auf den beigefügten Bildern sind sie im Paradeanzug (Abb. 273, 274).
[S. 280]
Am 14. September verließ ich das Lager, um eine der herrlichsten Seefahrten anzutreten. Ich ritt mit Kutschuk westwärts nach dem naheliegenden Ufer des Nakktsong-tso; das Boot wurde auf einem Kamele hinbefördert. Die Tibeter ließen mich merkwürdigerweise in Ruhe, aber ich hatte ihnen ja auch gesagt, daß ich nur fischen wolle. Die Karawane hatte Befehl, noch einen Tag hier liegenzubleiben, dann aber nach dem Westufer des Sees zu ziehen und mich an dem Punkte, wo wir vor einigen Tagen hatten umkehren müssen, zu erwarten. Wir nahmen Proviant für drei Tage und warme Kleidung für die Nächte mit.
In Südwesten erhob sich aus der blauschillernden Wasserfläche eine kleine Felseninsel, nach der wir steuerten. Es dauerte mehrere Stunden, ehe wir sie erreichten. Der See scheint sich sehr weit nach Westen zu erstrecken. Ich freute mich über die herrliche Aussicht, das schöne Wetter, das Rauschen der kristallklaren Wellen um die Jolle, den warmen, heiteren Tag mit 14,2 Grad Wärme und schwelgte in dem Bewußtsein, von der liebenswürdigen Aufdringlichkeit der Tibeter und ihren rührenden Besorgnissen um unseren Weg befreit zu sein. Die größte Tiefe auf diesem Weg betrug 12,70 Meter.
Die kleine Felseninsel überragt den Spiegel des Sees um etwa 50 Meter. Auf ihrem westlichen Vorsprung ist eine Steinplatte errichtet, die sicherlich zur Bezeichnung eines Winterweges, der über das Eis führt, dient. Ein kleiner Streifen von dichtem, üppigem Grase kann jetzt ungestört wachsen, da die Tibeter keine Boote besitzen; aber Yakdung und Schafmist verrieten gelegentliche Winterbesuche, um welche Zeit die Insel dank der Eisdecke mit dem Ufer in Verbindung steht. Im übrigen fallen die Kalksteinfelsen nach allen Seiten steil ab. Vom Gipfel aus bot sich uns eine prächtige Aussicht über die südlichen Partien des Sees, und ich zeichnete eine Kartenskizze dieses ganzen Gebiets, zu dessen genauer Untersuchung es uns an Zeit gebrach.

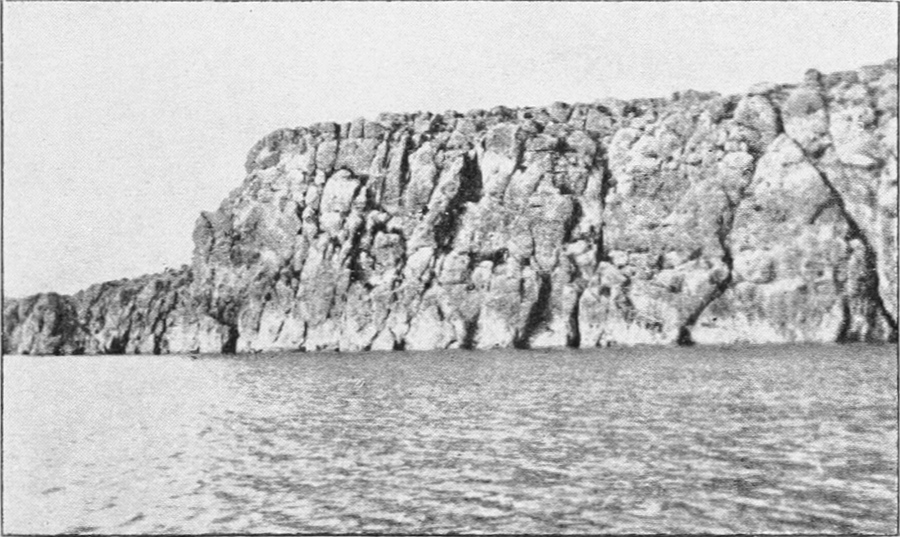
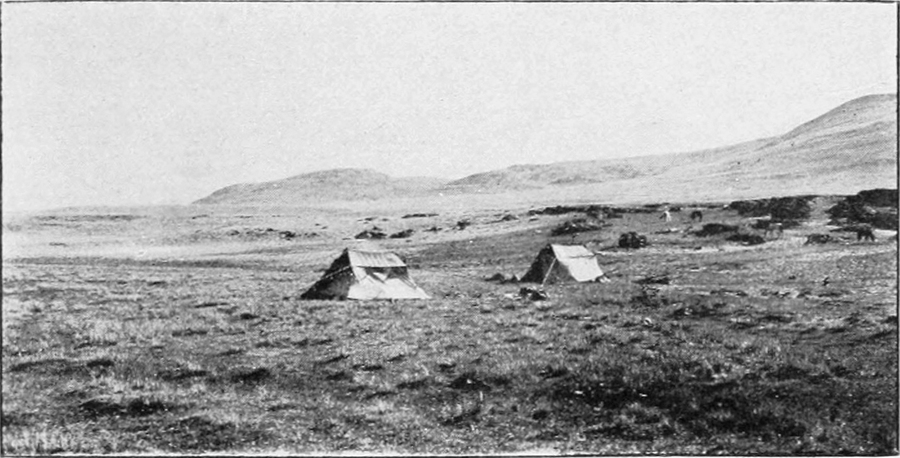
[S. 281]
Während des Marsches nach der „Kalpetbucht“ war es uns vorgekommen, als dehne sich der Nakktsong-tso sehr weit nach Süden aus und erstrecke sich bis an den Bergrücken, der nach dieser Seite hin die Aussicht begrenzte. Nun aber stellte sich heraus, daß nur ein paar Kilometer die Insel vom Südufer trennten. Die Gesichtstäuschung beruht auf der Luftspiegelung, in welcher die außerordentlich tiefliegende Ufersteppe, die sich zwischen dem Seeufer und dem Fuße des Gebirges ausdehnt, verschwindet. Die Steppe glänzte grün von vorzüglicher Weide; schwarze Punkte zeichneten sich dort ab: Yake, Pferde und Schafe, sowie acht schwarze Zelte, auch einige kleine Steinhäuser, möglicherweise Tempel, waren zu sehen.
Westlich von der Insel erheben sich drei wilde, bizarre Bergkämme, die sich auf einer größeren Insel zu erheben schienen oder die vielleicht — ja, wie es sich mit dieser Sache verhielt, wollten wir jetzt gerade feststellen. Nachdem wir eine niedrige Landspitze am Ostende der südlichsten Kette umrudert hatten, steuerten wir nach West zu Süd, welche Richtung wir bis zum Nachtlager beibehielten. Nun haben wir den südlichen Bergast gleich linker Hand. Er gleicht einer aus gewaltigen, rauhen Blöcken aufgetürmten Riesenmauer; hier und dort fällt er senkrecht in das Wasser hinunter, das überall seicht und selten mehr als 2 Meter tief ist. Westwärts rückt das Land zusammen; vielleicht würden wir hier in eine Sackgasse geraten. Der See wird immer enger; wir passieren das westliche Ende der ersten Kette, dann das der zweiten, die in einem zerrissenen Gipfel kulminiert. Jetzt ist es nur noch ein Kilometer bis an das Südufer. Ist das rechts von uns eine Insel oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns bei jedem Ruderschlage vorlegen. Wir rudern immer weiter in diese rätselhafte Bucht hinein. Die untergehende Sonne streut Gold und Purpur über die rauhen Felsvorsprünge, die sich in der ruhigen Wasserfläche spiegeln, durch deren glashelle Decke Algen und Wasserpflanzen schimmern.
Wir folgen dem nach Nordwesten abbiegenden Ufer. Der Graswall sah ganz unberührt aus, und wieder hofften wir, daß es eine Insel wäre, auf der wir eine friedliche Nacht ohne alle tibetischen Besuche würden zubringen können. In der westlichen Verlängerung des zweiten Bergarmes erhebt sich jenseits des Wassers ein imposanter Gebirgsstock. An seinem Südfuße, nur ein paar hundert Meter von uns entfernt, taucht eine steinerne Hütte auf, von welcher Rauch aufsteigt und vor welcher ein einsamer Hund wütend bellt.
In der Dämmerung rudern wir in die stille Bucht hinein; das Hundegebell verstummt hinter uns, Felsen erheben sich senkrecht auf beiden Seiten und werfen ein helles Echo der Ruderschläge zurück; jeder Laut zittert zwischen den Bergwänden, und wir treten wie in einen Tempelsaal in[S. 282] Gottes freier, erhabener Natur ein. Einige Königsadler kreisen mit regungslosen Flügeln in diesem großartigen Engpasse.
Auf einmal schien die Bucht ein Ende zu nehmen; doch nein, es war nur eine niedrige Landzunge, die den schmalen Sund fast ganz sperrte; jenseits derselben ging der Weg nach Nordwesten weiter, aber vor Felsen sah man nicht weit. Die Dunkelheit verhüllte auch bald diese entzückende Gegend unseren Blicken, und wir mußten für die Nacht landen. Dicht bei unbekannten Menschenwohnungen im Freien zu liegen, war gerade nicht angenehm, aber ich hatte den Revolver bei mir. Sobald das Boot aufs Land gezogen war, wurden die nächsten Umgebungen untersucht, und nun fanden wir zu unserer Freude, daß die Landzunge einen 30 Meter breiten Sund neben der südlichen Bergwand offen ließ, so daß wir am nächsten Morgen unsere Entdeckungsreise fortsetzen konnten und von den Eingeborenen getrennt blieben, die aus Mangel an Booten nicht imstande sein würden, uns zu belästigen. Prächtiger, trockner Argol war in Menge vorhanden, und bald brannte ein gemütliches Feuer mit heller blauer Flamme, lautlos wie ein Elmsfeuer; der Argol knistert nicht wie Holz. Die Nacht war klar und windstill und verfloß für uns, die wir in unseren Pelzen zusammengekauert lagen, in aller Ruhe.
Sobald die Sonne die Felsenspitzen auf der Westseite des Sundes vergoldete, erhoben wir uns, machten Feuer an und setzten das Teewasser auf. Tscherdon hatte uns einen vortrefflichen Proviant mitgegeben, eine gebratene Gans und einige Fladen Brot, und es war nicht das erstemal, daß Kutschuk und ich zusammen kampierten.
Es währte nicht lange, so tauchte Kutschuk wieder sein Ruder in das klare Wasser, und das Boot glitt schnell zwischen den Felsen hin nach Nordwesten. Ich kann mich kaum erinnern, je eine so großartige, hinreißende Natur gesehen zu haben, wie hier dem Auge begegnete: ein venezianischer Kanal mit alten Zyklopenpalästen. Von Zeit zu Zeit springt vom Ufer eine Landspitze vor, welche die Aussicht versperrt, und wir glauben den Punkt erreicht zu haben, wo wir umkehren müssen; aber der Engpaß geht weiter, der natürliche Kanal öffnet vor uns eine neue Perspektive. Die Richtung Nordwesten ist für uns besonders vorteilhaft, denn gerade nach dieser Seite hin liegt unser Sammelplatz. Die Tiefe übersteigt 3½ Meter nicht, und die Breite dieses schmalen Wasserweges beträgt im allgemeinen nicht über ein paar hundert Meter.
Wir waren sehr erstaunt, auf dem rechten Ufer hinter einem Felsvorsprunge eine Anzahl kleine Yake und Pferde zu sehen. Als das Boot an der Landspitze vorbeiglitt, stürmten drei Männer ans Ufer und trieben unter Geschrei und Steinwürfen ihre Tiere landeinwärts. Am Fuße des[S. 283] nächsten Vorgebirges auf der rechten Seite zeigten sich zwei schwarze Zelte; hier begafften uns ein Mann, eine Frau und ein Junge, die das größte Erstaunen über einen solchen Besuch in ihrer Gegend verrieten. Wenn überhaupt irgendwo, so mußte man hier vor Besuchen sicher sein, war doch ihr Wohnsitz mit einem wassergefüllten Graben umfriedigt. Das Auftreten von Nomaden ließ uns als gewiß erscheinen, daß das Land eine Halbinsel war und wir bald den ganzen Weg würden zurückmachen müssen. Wir bildeten uns beinahe ein zu bemerken, wie sich die Tibeter bei dem Gedanken, daß wir immer tiefer in den Sack hineinkröchen, über uns lustig machten. Einer von ihnen lief nach dem nächsten Bergkamme hinauf, wohl um zu sehen, was wir für verdutzte Gesichter machen würden, wenn wir nicht weiterkommen könnten.
Dann aber erweiterte sich der Fjord, und eine neue Perspektive entrollte sich im Nordwesten. Das Boot war leck und mußte ausgeschöpft werden; unterdessen schneite es eine Zeitlang, doch dann hatten wir wieder Sonnenschein. Die Tiefen nahmen schnell zu und betrugen hier bis zu 11,68 Meter. Da sich die Landschaft jetzt bis in die Ferne öffnete, hofften wir, daß wir auf diesem Wege wieder auf den See hinaus gelangen könnten, ließen aber den Mut sinken, als der Fjord plötzlich zu Ende war und flaches Land sich vor uns ausdehnte. Auf außerordentlich seichtem Wasser zogen wir das Boot, soweit wir kommen konnten, in eine keilförmige Bucht hinein, und dort saßen wir hilflos fest.
Der Strand, an dem wir zu Gaste waren, bestand aus lockerem, weichem Schlamm, in den man fußtief einsank. Kutschuk mußte sich Schuhe und Strümpfe ausziehen und durch den Morast nach dem nächsten Bergrücken waten, um zu rekognoszieren. Hierbei fand er, daß ein von Süden kommender Fluß in einen kleinen See mündete, der mit dem Nakktsong-tso zusammenzuhängen schien. Wir zogen daher das Boot ganz aufs Land, nahmen es auseinander und trugen es nebst dem ganzen Gepäck in mehreren Partien gute 500 Meter weit von der Bucht nach dem Flußarme. Das Vergnügen kostete uns drei Stunden, was jedoch noch immer besser war, als den ganzen Weg wieder zurückzumachen. Der Fluß hat zwei Arme, und vor seiner Mündung ist der See voller Schlammbänke, auf denen sich Hunderte von Möwen aufhielten. Jetzt konnten wir nach Nordosten rudern.
Auf einem molenförmigen Sandvorsprunge saßen in der untergehenden Sonne etwa zwanzig Möwen, die sich blendendweiß von einem für uns besonders erfreulichen Hintergrund, der weiten, dunkelblauen Fläche des Nakktsong-tso, abhoben. Es war uns also geglückt. Streng genommen war es doch eine Halbinsel, die wir umrudert hatten, und wir hatten das[S. 284] Boot nur über eine 500 Meter breite Landenge zu schleppen gehabt; letztere aber bestand sichtlich aus alluvialem Schlamme, der diesen Teil des Fjords verstopft hatte; sonst wäre das Land der Nomaden eine vollständige Insel gewesen. Der Nakktsong-tso, der auf den Karten entweder gar nicht oder bestenfalls außerordentlich entstellt angegeben ist, besaß, wie sich herausstellte, eine höchst sonderbare Gestalt. Er bildet einen Wasserring, der nur in seinem nördlichen Teile ziemlich weit, in dem südlichen dagegen schmal wie ein Fjord ist. Eine ähnliche Form hat der südlich von Lhasa liegende See Jamdok-tso.
Hinter der Sandmole nahmen die Tiefen schnell zu, von 3 Meter bis zu 22,20 Meter. Wir ruderten nach Ostnordost, nach welcher Richtung der Ring jetzt umbog. Als die Sonne am Horizont hinter uns stand, nahm das bisher dunkelblaue Wasser bei 3 Meter Tiefe einen intensiv grünen Farbenton an, und die Wasserpflanzen traten, wie durch Spiegelglas gesehen, klar hervor. Eine Landspitze am nördlichen Ufer war unser Ziel; von dort mußten wir das Signalfeuer der Unsrigen sehen können. Aber die Spitze lag mitten im Winde, und wir mußten in der Dämmerung den ersten besten Strand suchen. Der Himmel war außergewöhnlich klar, und die Deutlichkeit, mit welcher der Mond sich abzeichnete, war für eine Beobachtung verlockend. Es ging immer noch ein kalter, unfreundlicher Wind, doch das machte uns nichts mehr aus, nachdem wir in unsere schönen Pelze wie Murmeltiere gekrochen waren. Glücklicherweise regnete es während dieser beiden Nächte, die wir im Freien zubrachten, nicht; nur das Wiegenlied der Wellen lullte die müden Pilger in den Schlaf. Es ist schön, in Tibets sternklaren, stillen Nächten und in der klaren, dünnen, reinen Hochgebirgsluft den Himmel als Dach zu haben.
Die Nachtkälte ging auf kaum 2 Grad herunter. Wir brachen in aller Frühe auf. Jetzt ist es kalt und unfreundlich. Der Seegang ist so stark, daß wir uns ganz in der Nähe des Landes halten müssen. Nachdem wir fünf Minuten unterwegs waren, brach ein abscheuliches Unwetter los. Der Hagel stürzte in solcher Menge nieder, daß das Innere des Bootes mit Eisschlamm erfüllt war. Gleichzeitig aber wurde die Heftigkeit des Wellenganges und auch der Wind gedämpft. Der Sturm schien über uns stehenzubleiben und setzte seine Dusche über zwei Stunden lang fort. Hier herrschte halbe Dämmerung, doch im Osten badete sich das Land in Sonnenschein; hinter uns war der Himmel schwarz und das Gebirge in Weiß gehüllt, wir sind auf dem Wege von dem Sitze des Winters nach der Wohnstätte des Sommers. Der Hagel ging allmählich in Schnee über, der sich weich wie Baumwolle in das Boot legte.
Das Wasser hat die wunderbarste blaugrüne Farbe, ein leicht erregtes,[S. 285] flüchtiges Element, das den Blick nicht an der Erforschung der Geheimnisse des Seebodens hindert.
Eine gute Weile mußten wir auf einer Landzunge rasten. Ich erstieg eine Anhöhe, um mich zu orientieren. Am Nordufer erschien jetzt gerade wie gerufen die Karawane mit ihrer Kosakenbedeckung; ihr folgten auf den Fersen die Tibeter in dichten, schwarzen Schwärmen. Rechts haben wir eine ziemlich große Insel, auf der 20 Pferde grasen. Von dieser Insel springt eine Landzunge vor, der eine ebensolche vom Festlande entgegenkommt. Sie zeigen aufeinander hin wie die Kohlenspitzen in einer elektrischen Lampe, und der schmale Sund zwischen ihnen ist so seicht, daß die Jolle gegen den Grund schrammt. Über diese Landzungen geht die nach der Insel führende Furt.
Eine Stunde später hatten wir das ganze Lager auf dem verabredeten Platze vor uns. Es breitete sich in seiner ganzen Herrlichkeit am Ufer aus; Massen von Leuten und Pferden waren auf allen Hügeln. Hier und dort zerteilte der Wind eine Rauchsäule; wir haben 5, die Tibeter 19 Zelte, aber die meisten von ihnen kampieren doch am Feuer unter freiem Himmel. Alle die Unseren standen am Ufer, und die Kosaken machten wie gewöhnlich Honneur. Jeden Morgen muß ich meine Leute in drei verschiedenen Sprachen begrüßen: mit „Sdrasdwijte“, „Salam aleikum“ und „Ämur sän bane“.
Als ich zwei Nächte ausblieb, waren die Gesandten sehr ängstlich geworden und hatten das Lager unter besondere Bewachung gestellt. Den ersten Abend hatte Hladsche Tsering die Kosaken gefragt, die, ohne eine Miene zu verziehen, geantwortet hatten, ich sei nach dem Südufer gerudert, um mich von dort nach Lhasa zu begeben, und sie hätten Befehl, meine Rückkehr abzuwarten. Dies hatte die Gesandten sehr verstimmt, und sie hatten nach allen Richtungen, namentlich nach Süden, Patrouillen ausgeschickt. Unzweifelhaft waren sie jedoch schon im Laufe des zweiten Tages dahintergekommen, daß wir uns auf dem See aufhielten, hatten aber den auf dem Südufer wohnenden Nomaden verboten, uns irgendwie zu helfen. Während des Marsches hatten sie dann wiederholt meine Leute gezählt und gefunden, daß noch immer zwei fehlten. Sie konnten den Zusammenhang nicht recht begreifen, fürchteten aber, daß einer meiner Leute zwei Pferde nach dem Südufer geführt habe, auf denen ich mit irgendeinem Begleiter nach Lhasa zu reiten gedächte. Ihr Auftreten gegen die Karawane wurde daher strenger; es wurde ihr kein Proviant mehr geliefert, und das Lager wurde nachts mit starken Wachtposten umgeben. Ihre Unruhe legte sich auch nicht eher, als bis sie das Boot zwischen den Wellen heranstampfen sahen. Jetzt bestanden ihre Truppen aus 194 Mann,[S. 286] obgleich mehrere Patrouillen noch nicht zurückgekehrt waren; wir waren 18, d. h. einer gegen 10, nein, — einer gegen 50, wenn ich nur die Kosaken rechne!
Die Tibeter müssen von uns Europäern eine jämmerliche Meinung haben; die meisten von uns sind, wenn sie bis in die „heilige Sphäre“ gelangten, so von allem entblößt und in so erbärmlichem Zustande gewesen, daß sie der Hilfe und Unterstützung der Tibeter bedurften, um überhaupt nur wieder aus dem Lande herauskommen zu können. Sie haben nie eine ordentliche Truppe in guter Verfassung gesehen, die nicht danach fragte, ob ihr der Durchzug erlaubt sei. Es war allerdings eine starke Versuchung für mich gewesen, den Tibetern mit Hilfe des Sees und des Bootes ein Schnippchen zu schlagen, und zwei Pferde hätte man mitten am Tage von einem Weideplatze nach dem Südufer bringen können. Ich hätte aber dadurch nicht viel gewonnen, vielleicht nur wenige Tagemärsche.
Das „Land der Burchane“, das Land der heiligen Bücher im Süden — dorthin darf kein Europäer ziehen; es ist das Erbland des Dalai-Lama, ein heiliges Land, sein Eigentum. Schwerlich sind seine Lamas jetzt fanatischer als in jener Zeit, da die Jesuitenmissionare gastfreundlich von ihnen aufgenommen wurden, und sicherlich sind sie heutzutage auch nicht weniger tolerant als im Jahre 1845, da die Missionare Huc und Gabet sich einige Monate in Lhasa aufhielten. Nein, ihre strenge Isolierung während der letzten Jahrzehnte hat politische Gründe. Ihre friedliche, aber wirksame Taktik geht darauf aus, die Grenzen gegen Europäer zu bewachen und die ungebetenen Gäste höflich und freundlich, aber bestimmt aus dem Lande hinauszutreiben. Dennoch wird auch an Tibet einst die Reihe kommen. Solange die Tibeter auf derselben Erde wohnen wie wir, müssen sie es sich gefallen lassen, daß wir den Wunsch haben, sie kennen zu lernen, ihre Religion und heiligen Schriften, ihre Tempel, Sitten und Gebräuche zu studieren, ihr Land und seine Mittel zu erforschen, Karten von ihren majestätischen Gebirgen aufzunehmen und ihre launenhaften Seen zu sondieren. Noch haben sie sich allerdings nicht durch Vorspiegelungen von dem Aufschwunge des Handels und der Einfuhr von Tabak, Spirituosen, Opium und Feuerwaffen locken lassen; nein, „fort mit allen euren Genußmitteln, eurem Stahle, Golde und Silber, und laßt uns nur in unsrem eigenen Lande in Frieden!“
Wenn ich sage: „Ich will den südlichen Weg nach Ladak gehen“, so antworten sie mir: „Dort gibt es keinen Weg.“ Wenn ich ihnen den Weg auf der Karte zeige und einige Namen nenne, so wenden sie ein:
„Nun wohl, es gibt dort einen Weg; er ist aber nur für uns, ihr dürft nicht durch das Land der Burchane gehen.“
[S. 287]
Und wenn ich sage: „Ihr seid nicht gastfrei; wenn ihr in mein Land kommt, werdet ihr freundlich aufgenommen und dürft alles sehen“, so beeilen sie sich zu antworten: „Euer Land gehört euch, dort haben wir nichts zu tun, aber unser Land gehört uns; ihr müßt es daher verlassen und wieder heimreisen.“
Recht kostspielig muß es sein, eine Truppe von 200 Mann so lange unter Waffen zu halten, ganz abgesehen davon, daß die Leute ihr Heim und ihre Herden haben verlassen müssen. Doch es mag kosten, was es will, wenn nur keine Fremdlinge über die Grenze kommen. Es war für sie eine ungeheure Plackerei, trotzdem waren sie aber stets höflich und freundlich. Ihre Scheu vor Fremden wendet sich nur gegen die Europäer; Chinesen und Leute aus Ladak haben freien Zutritt, andere benachbarte asiatische Völker ebenfalls. Hladsche Tserings Koch war ein Dungane, der ein wenig „Tschanto“ (Türkisch) verstand und in Ostturkestan gewesen war. Die Muhammedaner nennen alle, die sich nicht zum Islam bekennen, Heiden (Kaper), einerlei, ob diese Asiaten oder Europäer sind. Die Tibeter verschließen ihr Land nur den Europäern; ihre Isolierung ist also politisch, nicht religiös. Ein Chinese, ein Japaner oder ein Burjate, ein Pundit, wie Nain Singh oder Krishna, ein Kaufmann aus Leh, alle können sich ohne Schwierigkeit nach Lhasa begeben. Und ist solch ein Asiate nur entsprechend instruiert worden, so kann er nachher über alles, was er gesehen hat, genaue Auskunft geben. Wir kennen, wie ich bereits erwähnt habe, Lhasa besser als sonst eine Stadt in Innerasien, Kaschgar, Kuldscha und Urumtschi vielleicht ausgenommen. Wer Lamas in Urga, Kum-bum, in Hemis oder in anderen Tempeln in Ladak besucht hat, kann bezeugen, daß er überall mit der größten Gastfreundschaft aufgenommen worden ist und keine Spur von Intoleranz gefunden hat. —
Nach einem ruhigen, klaren Abend fuhr um 10 Uhr wieder ein Hagelsturm über die Erde hin. Dann schneite es die ganze Nacht, und es war recht ungewöhnlich, die Schritte der Nachtwache im Schnee knarren zu hören. Am 17. September blieb der Schnee auf den nördlichen Abhängen den ganzen Tag liegen, auf den südlichen dagegen verschwand er bald im Sonnenbrand. Fern im Süden überragte alle anderen Gebirge in der Gegend ein großartiger, kegelförmiger Gipfel, der blendend weiß glänzte und mit seiner regelmäßigen Gestalt einem erloschenen Vulkane glich.
Die Karawane erhielt Befehl, nach der Mündung des Jaggju-rappga zu ziehen. Das Kamel, auf dessen Rücken Kalpet verschieden war, erkrankte jetzt, und Turdu Bai, der sich auf Kamele verstand, erklärte, daß es bald sterben würde, weil es einen Toten getragen habe. Das schöne Wetter lockte mich wieder auf den See hinaus; ich hatte auch keine Lust, einen[S. 288] ganzen Tag auf dem mir schon bekannten Wege nach dem Jaggju-rappga zu reiten. Ördek war mein Ruderer. Das Boot und das Gepäck wurden auf Pferde geladen; wir ritten nordwärts über die schmale Landenge zwischen Nakktsong-tso und Selling-tso.
Die Schwelle zwischen den Seen ist höchst eigentümlich. Unmittelbar nördlich vom Ufer des Nakktsong-tso gelangen wir auf ihren Kamm, der höchstens 10 Meter über dem See liegt; von dort aus aber müssen wir eine ziemliche Strecke weit abwärtsreiten und können dabei ein Gefälle von wohl 50 Meter konstatieren, ehe wir den Selling-tso erreichen, der also ungefähr 40 Meter tiefer liegt als sein Nachbarsee. Ich bin fest davon überzeugt, daß der Nakktsong-tso einen Abfluß hat, habe aber vergeblich danach gesucht. Möglicherweise ergießt er sich durch unterirdische Abflüsse in den Selling-tso. Am Nordabhange der Landenge passieren wir dieselben deutlichen Uferlinien, die wir schon früher an den Ufern des letztern Sees gesehen haben und die anzeigen, daß er fällt.
Das tiefliegende, morastige Ufer zwang uns, eine Strecke weit barfuß zu gehen, ehe wir das Boot ins Wasser setzen und dann nach Nordnordwest steuern konnten. Die Tiefen sind unbedeutend und betragen selten mehr als 3 Meter; der Boden besteht aus graublauem Ton ohne Spur von Vegetation, das Wasser hat eine leicht maigrüne Farbe, und darüber wölbt der Himmel seinen klaren, sonnigen Dom. Nur der Kamm der breiten Halbinsel, wo wir vor einigen Tagen umkehren mußten, zeichnet sich scharf ab und wird noch eine Strecke nach Osten hin durch eine Reihe kleinerer Felsenzähne, die über dem Wasser zu schweben scheinen, fortgesetzt. Auf der linken Seite sieht man durch das Fernglas die Karawane mit ihrem Gefolge von Tibetern, deren Zahl sich heute beinahe verdoppelt hat, da sich noch einige kleine Reiterscharen zur Haupttruppe gesellt haben. Eine schwarze Hagelwolke schwebte hartnäckig über ihnen und duschte sie unaufhörlich, was man deutlich an den hellen und dunkeln Streifen sehen konnte, die sich von der Wolke auf die Erde erstreckten. Wir dagegen bekamen nichts davon ab.
Nachdem wir die Landspitze an der Mündung des Alla-sangpo umschifft haben, steuern wir westwärts gerade auf die Gabel der Kette zu, die das Tal des Jaggju-rappga im Süden begrenzt. Wir sahen sie in Verkürzung; hinter ihr stand die Sonne, und daher trat sie wie eine intensiv schwarze Silhouette hervor. Es war bereits stockdunkel, als wir das große Lager erreichten, dessen Feuer wie die Laternen in einer kleinen Stadt strahlten.
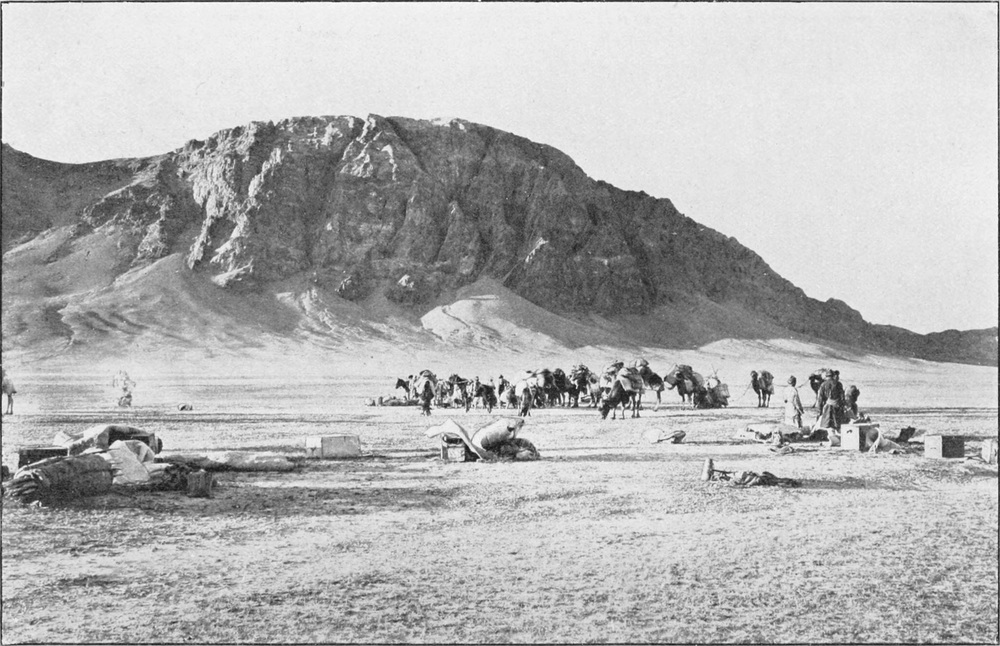
Frühmorgens am 18. September gab ich Befehl zum Aufbruch. Während wir die Tiere beluden, erschienen einige Tibeter, die uns baten, noch[S. 289] einen Tag hierzubleiben, weil Hladsche Tsering und Junduk Tsering umkehren müßten und es in unserem eigenen Interesse liege, den Ankauf von Pferden und das Mieten von Yaken während ihrer Anwesenheit zu besorgen. Ich ließ antworten, es sei uns gleichgültig, wo sie blieben, wir würden heute auf jeden Fall reisen.
„Wohin denn?“ fragten sie. Ich zeigte westwärts nach dem Tale des Jaggju-rappga.
„Dort kommt ihr nicht durch“, behaupteten sie, „ihr müßt nach Nordwesten gehen.“
Ohne weiteres Parlamentieren ritten wir jedoch auf dem linken, nördlichen Ufer flußabwarts. Von einem Hügel entwickelte sich bald nach Westen hin eine entzückende Aussicht über einen neuen, ansehnlichen See, der reich an Felseninseln, Vorgebirgen und Buchten war und beinahe ebenso unentwirrbar aussah wie der Nakktsong-tso.
Sehr weit waren wir noch nicht gelangt, als uns schon die Tibeter in schwarzen Haufen von je 15 oder 20 Mann überholten; wir waren vollständig umschwärmt von diesen Reitern, deren rote Fähnchen an den Flintengabeln flatterten, wohin man nur das Auge wandte.
Als wir uns in der Nähe des Seeufers befanden, stellte es sich heraus, daß der Felsenarm, den wir rechter Hand hatten, in den See vorsprang und eine Halbinsel mit steilen Seiten bildete. Umgehen ließ sie sich nicht. Die Tibeter zeigten uns jedoch einen recht schwierigen Paß. Einige Stellen waren so steil, daß ein hier stürzendes Kamel unten als gehacktes Beefsteak angekommen wäre. Von der Paßschwelle entrollte sich eine neue herrliche Aussicht nach Nordwesten über einen anderen Teil des Sees mit neuen pittoresken Halbinseln und Felseneilanden. Die schwarzen Haufen der Tibeter rollten in Staubwolken wie Lawinen die Abhänge hinunter. Ehe wir noch hinuntergelangten und uns neben ihrem Hauptquartier niederließen, rauchte es schon aus allen ihren Zelten.
Dieser Lagerplatz. Nr. 84, am Ostufer des Tschargut-tso (4613 Meter) war einer der besten und angenehmsten, die ich je gehabt habe. Alles, was man sah, war schön, entzückte das Auge und machte den Sinn fröhlich. Westwärts sieht man tief in die Fjorde des Sees hinein wie in einen Steinwald (Abb. 275). Je entfernter sie liegen, in desto leichteren Nuancen treten Inseln und Vorgebirge hervor, aber alles ist von der Sonne überflutet. Die Tibeter passen gut in diese wilde Landschaft hinein, von der ihre malerische Tracht und kriegerische Ausrüstung durchaus nicht unangenehm absticht.
Der Strand, ein natürlicher Korso, bietet dem Auge ein sehr lebhaftes, farbenreiches Bild dar. Außer unseren Zelten kann man noch 25 zählen,[S. 290] und doch kampieren die meisten Soldaten an offenen Feuern. Der Strand wimmelt von Menschen und Pferden. Dabei vermehrt sich die Zahl unserer Wächter, die jetzt 500 Mann betrug, noch immer.
In der Dämmerung kam Almas allein an. Kalpets Kamel, der „Katafalk“, war nicht mehr am Leben; Turdu Bai hatte recht gehabt. Was denkt das Kamel, wenn es weint und den Tod im Herzen fühlt? Kein Philosoph auf Erden kann es uns sagen; man weiß ja nicht einmal, was der Mensch träumt, wenn die Flügelschläge des Todesengels eiskalt durch seinen Körper gehen.
Wir waren uns über die Absichten der Tibeter nicht ganz klar. Wozu brauchten sie jetzt, da wir auf dem Wege nach Ladak waren, so viele Truppen zusammenzuziehen? Sie verstärkten die Nachtwachen und hielten ihr Arsenal in steter Bereitschaft. Sollten sie einen nächtlichen Überfall beabsichtigen?
Ich träumte in der Nacht etwas derartiges und wachte um 1 Uhr auf. Ich hatte auf dem rechten Arme gelegen, und die Hand, die auf der Erde lag und vollständig eingeschlafen war, war eiskalt und gefühllos. Zufälligerweise berührte ich mit der linken Hand die rechte, und dabei fuhr mir, schlaftrunken wie ich war, der Gedanke durch den Kopf, daß die Tibeter mir eine Leiche ins Zelt geworfen hätten. Ich sprang auf, machte Licht, fand das Zelt leer und verstand nun erst, sobald die Gedanken wieder klar wurden, den Zusammenhang.
Zwei Tage blieben wir an diesem schönen Strande. Nur zu schnell verging die Zeit unter Visiten, Gastmählern und neuen Überlegungen über den Weg nach Ladak. Ich erklärte offen, daß ich den Weg zu gehen gedächte, der mir behage, und daß ich mir darin keine Vorschriften machen ließe. Eine Eskorte sollten wir aber auf jeden Fall haben, und alles, was wir brauchten, sollte während der Reise angeschafft werden. Hladsche Tsering schenkte mir zwei Pferde, wie Kamba Bombo es getan hatte, und daneben sollten uns, da unsere Karawane jetzt in besorgniserregender Weise zusammengeschmolzen war, auf besonderen Befehl des Dalai-Lama stets 40 Yake zur Verfügung stehen. Es ist eigentlich seltsam, daß die Tibeter so artig und freundlich sein können, hatte ich doch die erste Warnung nicht beherzigt und zum zweitenmal versucht, in das verbotene Land einzudringen! Viele andere asiatische Völker hätten in solchem Falle ein Exempel statuiert, aber die Tibeter sind viel zu gutmütig und weichherzig, um Blut zu vergießen, und begnügen sich mit Waffengeklirr und Drohungen.
Ein wahrhaft großartiges Schauspiel boten sie uns am Mittag des 19. September. Ich hatte Hladsche Tsering mitgeteilt, daß ich ihn selbst und seinen Kollegen und dann seine große Kavallerie photographieren wolle.[S. 291] Meine Bitte wurde mit dem größten Vergnügen gewährt, und sofort wurden einige Hundert Reiter aufgeboten (Abb. 276). Sie wurden in Gliedern geordnet; aber es war nicht leicht — nicht einmal für die Häuptlinge, — sie dazu zu bringen, daß sie sich einen Augenblick ruhig verhielten. Als ich bat, sie möchten ihre Schwerter und Lanzen in die Luft strecken, und dies geschah, erwachten sofort ihre kriegerischen Instinkte; die Pferde wurden unruhig, und die ganze Schar sprengte unter wildem Kriegsgeschrei wie zum Angriff vor! Als diese zügellose Horde über die Steppe hinsauste und die klirrenden Waffen in der Sonne blitzten, konnte man den Blick nicht davon losreißen. Der photographische Apparat mußte ruhen, bis sich der kriegerische Sinn der Leute wieder beruhigt und sie begriffen hatten, daß man beim Photographieren nicht so schrecklich zu lärmen und zu toben brauche.
[S. 292]
Wir hätten eigentlich heute (am 20. September) nach dem fernen Ladak aufbrechen sollen; aber die Gesandten baten uns zu bleiben, weil sie noch einige Tagereisen weit mit uns ziehen wollten. Heute hatten sie jedoch einen großen Festtag und wollten sich still verhalten, und ich ging mit um so größerem Vergnügen auf den Vorschlag ein, als der Tschargut-tso mich auf seine schönen, aber falschen Wogen hinauslockte.
Chodai Kullu wurde zum Ruderer ernannt. Wir hielten Kurs auf die äußerste Spitze der bergigen Halbinsel, die unsere Bucht im Süden begrenzte. Von dort gingen wir weiter auf den See hinaus, als auf einmal der Himmel im Westen schwarz wurde und der Sturm mit seinem gewöhnlichen Getöse angezogen kam. Wir wendeten sofort und landeten an dem steilen Ufer der Landspitze, wo indessen herabgefallene, scharfkantige Felsstücke das Boot zu zerschneiden drohten, denn die Wellen gingen bald hoch und preßten es gerade gegen das Ufer. Ich beschloß, quer über die heftig aufgeregte Bucht gerade nach unserem Lager hinzusteuern. Es knackte in dem Holzrahmen des Bootes, und der Sturm war zum Orkan geworden. Mit sausender Fahrt trieben wir nach dem Strande hin, wo sich die Tibeter in dichtgedrängten Haufen versammelt hatten, um Zeugen unseres Schiffbruchs zu werden. Bald entschwand die Jolle in einem Wellentale ihren Blicken, bald erschien sie auf einem Kamme, auf dessen Rücken sie stampfte und bebte. Für uns sah es unheimlich aus. Wir nähern uns dem Strande mit beängstigender Geschwindigkeit; im nächsten Augenblick muß das Boot von einer Welle auf den Sand geschleudert, im andern aber, wenn sie sich zurückzieht, wieder ins Wasser gezogen werden. Stumm vor Staunen, mit verhaltenem Atem standen die Tibeter und waren entschieden überzeugt, daß wir in der Brandung zerschellen würden. In dem Augenblick, als die Welle das Boot auf den Strand schleuderte, sprang Chodai Kullu ins Wasser, und alle vier Kosaken sprangen herzu, faßten die Relinge des[S. 293] Bootes und trugen mich wie auf einer Bahre aufs Trockne. Das Ganze ging blitzschnell vor sich, und die Tibeter eilten herbei, um sich zu überzeugen, ob ich wirklich noch lebe.
Erst nachdem der Sturm sich gelegt hatte, konnten wir uns wieder hinausbegeben, worauf wir einige Lotungen mit gutem Gelingen ausführten und erst in der Dämmerung zurückkehrten. Es war ganz dunkel, als wir noch draußen auf dem See plätscherten, und die Arbeit wurde bei Laternenschein ausgeführt. Als wir uns spät abends dem Strande näherten, war der Anblick der Lagerstadt nicht weniger großartig als bei Tag. Alle Feuer leuchteten in einer langen Reihe längs des Ufers der Bucht, das beinahe wie ein illuminierter Hafenkai aussah. Der Rauch der Feuer wurde von der schwachen östlichen Brise über den See getrieben und lag wie ein graublauer Schleier über dem jetzt wieder ruhigen Wasser. Der Mond überflutete mit seinem Lichte diese außerordentlich schöne Landschaft und warf einen zitternden, silberglänzenden Streifen über den See. Bald schlägt das Lachen und Plaudern aus den Zelten und von den Soldatengruppen an unser Ohr. Die Leute trinken Tee, rauchen und sind mit Würfelspiel beschäftigt.
Als ich am Morgen des 21. September geweckt wurde, stand die Quecksilbersäule auf dem Gefrierpunkte. Der See lag spiegelblank da, und seine weit hinten im fernen Westen verschwindende Perspektive mit den kulissenartig vorspringenden Gebirgspartien glich einem gigantischen Flußtale. An diesem hellen, schönen Herbstmorgen war ich fröhlich gestimmt und fühlte mich zu einer längeren Seefahrt um so mehr aufgelegt, als ich das Alleinsein im Boote dem Waffengeklirr und Pferdegetrappel der 500 Tibeter vorzog.
Mit Proviant für drei Tage, warmen Kleidern und den nötigen Instrumenten versehen, steuerten Kutschuk und ich über den See. Bald darauf brach auch die Karawane auf; die Tibeter umschwärmten die Unsern in einzelnen Haufen, und ehe wir noch aus der Bucht auf den offenen See hinaustraten, war der eben noch so lebhafte Strand von Zelten und Menschen reingefegt, und das Schweigen der Wildnis legte sich wieder über die entzückende Gegend. Statt dessen zeichneten sich die Reisenden wie lange schwarze Linien, Gruppen und Punkte auf den Ebenen des Nordufers ab, wo sie westwärts zogen und bald hinter den Bergen verschwanden. Sie hatten Befehl, irgendwo in der Nähe des Westufers, wo es gutes Gras gab, zu rasten und uns dort zu erwarten. Die Gesandten waren ganz aufgeregt über die neue Seefahrt gewesen und hatten gefragt, was dies wieder heißen solle.
Wir waren kaum eine Viertelstunde unterwegs, so war es mit der[S. 294] Stille für heute vorbei. Eine frische Westbrise erhob sich, und der Spiegel der Bucht wurde matt, seine Bilder wurden von einer leichten Kräuselung zerstört, die bald zu Wellen und Wogen anschwoll. Jenseits des südlichen Felsenvorsprungs wurde der Wind stärker und kam uns gerade entgegen. Er schwoll zu einem halben Sturme an, der See ging hoch, das Loten mußte unterbleiben, und es galt wieder, uns selbst und unser Gepäck zu retten. Zum Umkehren war es zu spät, und jetzt war niemand mehr an dem Strande, auf den uns der Sturm widerstandslos geschleudert haben würde. Wir versuchten vergebens, irgendeine freundliche Landspitze zu erreichen, hinter der wir hätten Schutz finden können, aber es blieb uns nichts weiter übrig, als draufloszurudern und uns nach der vor dem Wind geschützten Seite der nächsten Felseninsel im Westen hinzuarbeiten. Unter diesen Umständen konnten natürlich nur wenige Lotungen gemacht werden; als größte Tiefe wurden 42 Meter festgestellt.
Wir arbeiteten jetzt wie Galeerensklaven gegen Wind und Wellen an (Abb. 277). Mit jeder Schlagwelle erhielt ich eine kalte Dusche und wurde bis auf die Haut durchnäßt. Es leckte und tropfte von meiner Mütze, und meine Brille leistete mir schlechte Dienste. Notizbücher, Decken und sonstige Sachen waren wie ins Wasser getaucht. Endlich aber erreichten wir doch die Insel; hier war der Wellenschlag geringer. Noch unmittelbar am Ufer betrug die Tiefe 34 Meter. Ganz erschöpft von der Anstrengung vertäuten wir das Boot. Es wurde ganz aufs Ufer hinaufgezogen, damit es uns nicht forttriebe, in welchem Falle unsere Lage höchst bedenklich gewesen wäre.
Die kleine Insel hat die Gestalt eines Sattels; sie besteht aus zwei Bergkuppen mit einer flachen Einsenkung in der Mitte, einer Landenge, die nur 300 Meter breit ist. Ich ging über die Enge nach dem Westufer, gegen welches die Wellen mit erschreckender Wut anstürmten. Welche Freude haben wir jetzt an der Sonne, die uns von dem glänzend türkisblauen Himmel herab mit ihrem goldenen Lichte überflutet, während der Wind über den launenhaften See hinfährt und die Wellen zum wilden Tanze auffordert.
Nachdem wir uns mit unserem unfreiwilligen Gefängnisse bekannt gemacht hatten, wurde das Lager aufgeschlagen (Abb. 278); wir breiteten mein provisorisches Bett am Ufer aus, das Boot schützte einigermaßen gegen den Wind, eine Filzdecke diente als Sonnendach. Infolge einer glücklichen Eingebung hatte ich Lektüre mitgenommen. Kutschuk schnarchte schon. Der Wind heulte in den Felsen; ich sehnte mich danach, ihn schwächer werden und verstummen zu hören. Um 3 Uhr wußten wir nichts Besseres anzufangen, als Feuer anzumachen und Tee zu bereiten. Jappkak und[S. 295] Argol waren in Menge vorhanden. Kutschuk ging von Zeit zu Zeit über die Enge, um sich nach dem Sturme umzusehen, kam aber stets mit dem Bescheide wieder, daß es undenkbar sei, bei solchem Wetter mit dem Boote hinauszugehen. Mit Hilfe des Fernglases sehen wir auf dem nördlichen Seeufer mehrere große Herden und Zelte.
Es ging gegen Abend. Der Wind flaute nicht ab; immer noch hörte man den See gegen das Westufer der Insel branden, wo die Wellen unter der Peitsche des Sturmes ihre Sklavenarbeit ausführen. Sie haben das Recht, soviel sie wollen gegen diese heiligen Ufer zu schlagen, an denen wir nur wie Zugvögel vorbeistreichen dürfen. Als wir nach Süden gingen, hinderten uns die Tibeter, jetzt, da wir uns nach Westen wenden, hindert uns der Sturm. Ich hatte unserem lärmenden Gefolge entgehen und mich in Einsamkeit der Stille der Natur erfreuen wollen; jetzt wollte ich viel lieber zu ihm zurückkehren, als auf dieser kleinen Felseninsel gefesselt sein. Es gehörte die Geduld eines Engels dazu, hier untätig und gebunden zu liegen, während das Tagesgestirn seinen Lauf nach Westen fortsetzte. Wie mir zum Hohne ging die Sonne klar unter, tiefe Schatten senkten sich auf das Lager herab, während das Ostufer noch in Licht getränkt lag. Doch bald kletterten die Schatten auch die Berge hinauf, deren Gipfel eine Weile scharlachrot leuchteten. Als auch ihre Glut erloschen war, stieg die Nacht blaukalt und rein aus dem Osten auf. Wie gern hätten wir heute so wie gestern die Uferfeuer lodern sehen, doch heute Abend war es dunkel und still, und nirgends war ein Feuer zu erblicken. Der Halbmond war die einzige Laterne, die uns in unserem Gefängnisse gewährt wurde, das wir so gern verlassen hätten, das aber trotzdem in seiner Weise friedlich und reizend war.
Vielleicht legte sich der Sturm über Nacht. Wir legten uns früh schlafen, und Kutschuk hatte Befehl, mich ein paar Stunden nach Mitternacht zu wecken. Um 4 Uhr rüttelte er mich wach. Die Sterne funkelten hell, aber der Wind war noch ebenso heftig. Trotzdem standen wir auf. Bald flammte das Feuer und erhellte das steinige Ufer. Es waren beinahe −5 Grad, und der heiße Tee schmeckte gut. Oft pflegte der Morgen ganz windstill zu sein. Unser Plan war jetzt, nach dem Südufer hinüberzurudern, wo wir unter den Felsen leidlichen Schutz finden mußten und uns schlimmstenfalls von einer Landspitze zur anderen schieben konnten. Wir hatten genug von dieser Robinsonade und sehnten uns nach der Sonne. Stumm und nachdenklich saßen wir während des Wartens am Ufer. Endlich graute im Osten der Tag, und die Bergkämme hoben sich schwarz auf dem immer helleren Hintergrunde ab. Auf einmal ging die Sonne wie eine blendende Feuerkugel auf.
[S. 296]
Statt abzunehmen, nahm der Sturm an Heftigkeit noch zu. O welch himmlischer Geduld bedurften wir jetzt, wenn auch dieser Tag verloren gehen sollte, während die Karawane ihren Weg nach dem unbekannten Westen fortsetzte! Ein richtiger Passatwind wehte gleichmäßig und stark, ohne einen Augenblick schwächer zu werden, und leichte, weiße Wölkchen segelten zeitweise über den See hin. Der Tschargut-tso zieht sich langgestreckt von Osten nach Westen. Ich beschäftigte mich, nachdem ich mit der mitgebrachten Lektüre fertig war, damit, eine Karte des Sees zu zeichnen und darüber nachzudenken, wie günstig oder ungünstig die verschiedenen Windrichtungen für uns gewesen wären. Neun verschiedene Fälle waren denkbar. Am besten wäre östlicher Wind gewesen, doch auch solcher aus Nordosten und Südosten hätte uns geholfen. Windstille wäre beinahe ebensogut gewesen. Hätte Südwind oder Südwestwind geherrscht, so hätte das Südufer uns Deckung geboten, bei Nord oder Nordwest hätten wir unter dem Nordufer Schutz gefunden. Aber von allen diesen Fällen war natürlich keiner eingetreten, nur der neunte, westlicher Wind, für uns der direkte Gegenwind und die einzige Richtung, die uns das Aufbrechen unmöglich machte.
Auch dieser Tag war verloren. Wir verträumten die Zeit an unserem Ufer; von dem anderen her ertönte es wie das Donnern eines riesenhaften Wasserfalles, die Wellen gingen meterhoch, wir waren an unseren Felsen festgeschmiedet. Ich machte eine Kartenaufnahme von der Insel, während Kutschuk ganze Haufen Brennmaterial einsammelte; es war das einzige, womit er sich die Zeit vertreiben konnte. Nachher „versammelten wir uns zum Mittagessen“; mein Schutzzelt mußte mit Steinen verankert werden, damit es nicht fortflog. Dann gehe ich nach dem Südwestufer, wo die Felsen steil in den See hinabstürzen. Dort sitze ich und höre mit Genuß dem lärmenden Spiele der Wellen zu; ich schließe die Augen, um besser träumen zu können, aber in jedem Wellenschlage liegt wie ein Hohngelächter die Frage: „Was hast du in diesem heiligen Lande zu suchen?!“ Ich gehe dann nach dem nördlichen Berge, um Abschied von der Sonne zu nehmen. Als die neue Nacht hereinbricht, lassen wir uns an einem gewaltigen Lagerfeuer nieder und setzen unser dolce far niente fort.
Um 6½ Uhr schien die Heftigkeit des Windes abzunehmen, und die Hoffnung erwachte wieder. Um 7 Uhr ließ sich deutlich erkennen, daß die Windgeschwindigkeit abgenommen hatte, aber die dichter gewordenen Wolken schwebten mit derselben gräßlichen Eile unter dem Monde durch, der gleich einer silbernen Muschel über ihnen segelte.

Mit steigender Spannung beobachteten wir die Himmelszeichen und gingen wieder nach dem Westufer, aber der See sah noch immer ebenso aufgeregt aus, und wir mußten weiter warten. Direkt nach Westen hatte[S. 297] ich die Richtung nach der nächsten kleinen Felseninsel eingepeilt, und wir hofften noch vor Monduntergang dorthin zu gelangen; später würde es pechfinster werden. Nach und nach flaute der Wind ab, und wir packten unsere Sachen zusammen. Als wir im Begriff waren, das Boot ins Wasser zu setzen, schmerzte es mich beinahe, diese kleine Insel, die uns eine Freistatt gegeben und auf der ich zwei friedvolle Tage zugebracht hatte, auf ewig verlassen zu müssen.
Wir schieben unser Fahrzeug in die Nacht hinaus und streichen vor dem Winde gedeckt am Ostufer entlang. Die südliche Klippe der Insel ragt wie ein rabenschwarzes Gespenst aus den Wellen empor; ihre Wände sind von dem bleichen Mondlichte schwach beleuchtet. Als wir die Spitze umschifft hatten, kam uns der Wellengang direkt entgegen; aber jetzt war er nicht gefährlich, und die Jolle schaukelte sanft und leicht. Von der nächstgelegenen kleinen Felseninsel, unserem nächsten Ziele, war keine Spur zu erblicken; sie verschwamm mit den Gebirgen im Westen, aber ich wußte, daß sie von uns in West zu Süd lag, und gab Kutschuk dementsprechende Anweisungen beim Rudern. Selbst wenn das Wetter so ruhig und gut ist wie jetzt, ist es nicht gerade gemütlich, mitten in der Nacht auf einem unbekannten See zu schaukeln. Alles ist schwarz und undeutlich, man erhält keinen Begriff von den Umrissen der Ufer; nur die zurückgelegte Linie, ihre Zeiten, Tiefen und Geschwindigkeiten sind ebenso sicher zu bestimmen wie bei Tageslicht. Das Wasser ist schwarz wie Tinte, nur das Silber der Mondstraße tanzt auf den sich zur Ruhe legenden Wellen; der Himmel ist dunkelblau, die Wolken segeln stumm und düster wie Schatten und eilfertig wie Pilger nach Osten, doch am schwärzesten ist der Gebirgsrahmen ringsumher.
Das Boot war schwer belastet und ging tief, denn wir hatten so viel Brennmaterial mitgenommen, wie wir nur hatten unterbringen können. In meiner vorderen Boothälfte, wo ich weich und warm saß, hatte ich es ausgezeichnet. Die Lotleine mit ihren Fünfmeterknoten lag auf der Backbordreling bereit. Die Laterne beleuchtete Uhr, Kompaß, Geschwindigkeitsmesser und Marschroute, ich rauche und führe meine Beobachtungen in schönster Ruhe aus. Die größte Tiefe beträgt 37,5 Meter; sie liegt dicht bei der ersten Insel, dann hebt sich der Seeboden langsam nach der zweiten. Die wichtigsten Vorgebirge auf beiden Seiten waren passiert; es konnte nicht mehr weit nach der kleinen Insel sein. Stundenlang glitten wir weiter, ohne daß sie sich zeigte; doch es war kaum möglich, daß wir an ihr vorbeikommen konnten, ohne sie zu sehen. Erst als wir nur noch eine Minute vom Ufer entfernt waren, tauchte sie aus der Dunkelheit auf. Ich glaubte, wir näherten uns einem Gipfel, der zu dem westlich vom See[S. 298] liegenden Berge gehörte; aber der Gipfel wuchs in wenigen Minuten, und das Boot schrammte gegen das Ufer. So täuscht man sich beim Rudern im Dunkeln, selbst wenn Mondschein herrscht. Das Schifflein wurde an Land gezogen, und wir gingen sofort zur Ruhe.
Wir hatten die Absicht, bei Tagesanbruch gleich weiterzufahren; doch schon vorher teilte mir Kutschuk mit, es gehe wieder ein so heftiger Wind, daß an ein Weiterrudern nicht zu denken sei. Mir blieb nichts weiter übrig, als die Insel gründlicher in Augenschein zu nehmen. Sie bildet beinahe ein rechtwinkeliges Dreieck mit der Hypotenuse nach Nordwesten; das längste Ufer ist nur 330 Meter lang. Der südliche Teil der Insel wird von einer roten Konglomeratschicht gebildet, und die Ufer sind mit Blöcken von demselben Materiale dicht bedeckt. Die größte Höhe beträgt nicht mehr als 15 Meter; einige Steinmale sind dort errichtet (Abb. 279).
Um 12½ Uhr war es völlig windstill, aber im Westen stiegen schwarze Wolken mit Regendraperien auf. Ein neuer Sturm war im Anzug. Wir hatten das schwierigste Becken des Sees vor uns. Was gebot uns die Klugheit zu tun? Der Proviant ging zu Ende. Ich hatte stundenlang am Strande gesessen und mir, wie ein Kind, den Sand durch die Finger gleiten lassen. Auf den im Wasser liegenden, von tausendjährigen, unermüdlichen Wellen glattgeschliffenen Blöcken hatte ich Sandfestungen erbaut, um zu sehen, wie lange sie den Überschwemmungen der Wellen würden widerstehen können. Nie habe ich eine Seefahrt unter so ungünstigen Verhältnissen gemacht wie diesmal. Alle Unwetter des ganzen Landes schienen unbedingt erst über den Tschargut-tso ziehen zu müssen, oder das Tal, in dem der See liegt, mußte eine Abflußrinne für alles derartige Teufelszeug sein!
Um 2 Uhr hatten wir alles eingepackt, da aber brach der Sturm los, und es war nur gut, daß wir die Insel noch nicht verlassen hatten. Es regnete eine Weile, und die Wellen rauschten gegen die kleine Klippe. Im Süden ging eine zweite Bö über das Land und färbte alle Berge weiß. Nachdem wir eine Stunde gewartet hatten, hörte der Sturm auf einmal auf, und der Seegang legte sich schnell, nur weich abgerundete Dünungen krümmten seine Oberfläche, die Sonne näherte sich dem Horizont, und der Tschargut-tso gewährte einen herrlichen Anblick. Bei solchem Wetter konnte kein Risiko dabei sein, quer über den offenen See zu steuern; aber wir hielten doch Ausguck auf einige Landspitzen im Süden, die uns im Notfall hätten als Schutz dienen können. Kutschuk ruderte scharf, und ich peilte von Zeit zu Zeit. Die größte Tiefe betrug fast 48 Meter.
[S. 299]
Die schützenden Landspitzen hatten wir hinter uns zurückgelassen, als es wieder im Westen dunkel zu werden begann; der Donner grollte dumpf über den südlichen Bergen, wo es in Strömen regnete oder schneite, und über das nördliche Ufer, das jetzt in weiter Ferne lag, zog ebenfalls ein Unwetter hin. Über dem See herrschte einstweilen noch klares Wetter, und die Sonne ging in leichten Wolken unter. Doch über den senkrecht abstürzenden Felsen des südlichen Ufers, nach denen wir jetzt hinsteuern, erhebt sich eine stahlblaue, drohende Wolkenwand. Indessen ist es andauernd ruhig, und die Wolke scheint stillzustehen und sich ihres Inhalts nur auf einer Stelle zu entladen. So gut sollte es uns aber nicht werden. Unter den Wolken werden die unzweideutigen Anzeichen eines herannahenden Sturmes sichtbar. Die Wolken werden auf der unteren Seite hell brandgelb, als würden sie von einer Feuersbrunst beleuchtet, und wenn man diesen Farbenton sieht, weiß man sofort, was es zu bedeuten hat. Ich suchte mit dem Fernglase die Ufer ab, aber jetzt gab es innerhalb Sehweite keine rettende Bucht. Am klügsten wäre es gewesen, wenn wir uns von dem Sturme nach der kleinen Felseninsel hätten zurücktreiben lassen, denn mit dem Wellengange kann die Jolle die höchsten Wogen vertragen. Aber unser Proviant war beinahe zu Ende, und es galt, ein Ufer zu erreichen, von dem aus wir die Karawane aufsuchen konnten. Es blieb uns also nichts weiter übrig, als gegen den Wind aufzuhalten und zu versuchen, unter den Felsen des südlichen Ufers in Schutz zu kommen.
Zuerst sausten einige kalte Windstöße über den See, und dann brauste der Sturm herab wie der Habicht auf eine wehrlose Taube. Vorbei ist es mit Lotungen und Peilungen! Faßt die Ruder fester, jetzt gilt es das Leben! Es knackt und knarrt in dem Boote, und dieses klatscht mit dem Boden auf die ihm entgegenkommenden Wellen, die wie Kobolde zum Angriffe stürmen. Im nächsten Augenblick kann sein Rumpf mit einem Knalle zerspringen. Doch es gibt ein Maximum für die Wellenhöhe in Seen von dieser Größe, und dieses Maximum hat die Jolle bisher immer aushalten können. Nie habe ich so verzweifelt gearbeitet wie jetzt; wir ruderten mit langsamen, gleichmäßigen Schlägen und gewannen jedesmal ein paar Zentimeter; ich hatte mehrere Tage nachher noch große Blasen an den Händen. Der Sturm wurde zwischen den Felsen der Ufer eingepreßt und nahm an Heftigkeit zu. Drauflos, Kutschuk! Das Ufer kommt uns näher, es ist gar nicht gefährlich! Da schlägt ein Wellenkamm über die Steuerbordreling in das Boot, und das Wasser plätschert und rauscht von dem Rollen, eine neue Welle schlägt hinein, wir bekommen recht kalte Duschen von dem Spritzwasser, wir rudern mit so festen Griffen, daß uns die Knöchel weiß[S. 300] werden, wir tragen das Boot auf den Ruderblättern durch die Wellen! Lange kann es auf diese Weise nicht mehr fortgehen, das Boot ist halb voll Wasser, und die Wellen brechen noch immer über den Vordersteven herein — bald müssen wir sinken!
„Halte deine Rettungsboje bereit, Kutschuk, ich habe die meine!“ —
„Nein, wir können noch nach jenem Vorgebirge hingelangen, ja Allah!“ —
Und wir arbeiteten uns dorthin! Es war ein Wunder, daß wir nicht Schiffbruch litten; auf keiner von allen meinen Seefahrten in Asien bin ich einer Katastrophe so nahe gewesen!
Sobald wir unter dem Vorgebirge vor dem Winde geschützt waren, wurden die Wellen niedriger, und wir beruhigten uns und erreichten im letzten Augenblick am dunkeln Abend das Ufer. Ja, hat man nur ein sicheres Boot, so ist es keine Kunst, im Dunkeln über einen stürmischen See zu kommen, aber mit einer Zeugjolle ist es etwas anderes, und die Fahrt wird nicht gemütlicher, wenn der Wind die Sturmwolken zerreißt und der Mond den Wellenschaum versilbert, der weiß und kristallhell über unerforschten Tiefen glänzt, die bereit sind, uns in ihre kalten Arme zu schließen.
Sobald wir gelandet waren, hörte der Wind auf. Statt dessen fing es an stark zu regnen, und es regnete die ganze Nacht. Wir richteten das Boot wie ein Kutschenverdeck auf, zündeten Feuer an, trockneten unsere Kleider und schliefen dann gut, da wir von der sowohl körperlich wie seelisch kolossalen Anstrengung sehr ermüdet waren.
Am Morgen des 24. September hatten wir nur noch ein Stückchen Brot zum Frühstück. Bei gutem Wetter ruderten wir westwärts über den See weiter, der bald schmäler wurde und ein Ende nahm. Wir fuhren in eine trompetenförmige Flußmündung hinein, und nach knapp einem Kilometer befanden wir uns wieder auf einem gewaltigen See. Die Gesandten hatten ihn Addan-tso genannt, aber die Nomaden, die wir am Ufer trafen, sagten Nagma-tso. Fern im Norden zeigten sich einige Reiter. Wir hofften, daß es unsere Späher sein würden, aber sie verschwanden bald wieder und hatten das Boot augenscheinlich nicht gesehen. Wir beabsichtigten jedoch, schräg über den See nach dem ziemlich naheliegenden Nordufer zu fahren.
Ich habe soviel von unseren abenteuerlichen Seefahrten gesprochen, daß ich nur noch hinzufügen will, daß der dritte Sturm uns auf dem Addan-tso überfiel und uns buchstäblich gegen das nächste Land schleuderte, wobei sich das Boot mit Wasser füllte, so daß wir ins Wasser springen und retten mußten, was sich retten ließ. Glücklicherweise regnete es nicht.[S. 301] Wir breiteten unsere Sachen in dem starken Wind auf der Erde zum Trocknen aus, zogen die Kleider aus und hielten sie in den Wind, nachdem wir sie erst tüchtig ausgerungen hatten, dann lagen wir dort mehrere Stunden still. Schließlich wurde ich so hungrig, daß ich nach dem nächsten schwarzen Nomadenzelte ging; ich war aber noch nicht weit gekommen, als Kutschuk mich zurückrief und auf den kurzen Flußarm, den wir heraufgefahren waren, zeigte. Dort erschienen zwei Reiter mit drei Packpferden. Sie hatten uns gesehen und ritten gerade auf uns zu. Es waren Tscherdon und Ördek, die uns seit zwei Tagen längs des Ufers des Addan-tso suchten und gleich den anderen in größter Unruhe geschwebt hatten. Nach einer Weile kamen Tschernoff und der Lama, die uns an den Ufern des Tschargut-tso hatten suchen wollen. Sirkin war schon gestern dort gewesen und hatte in dem alten Lager am Ostufer des Sees Umschau gehalten. Sie hatten das Schlimmste befürchtet und bereits überlegt, was sie tun sollten, wenn ich nicht wiederkäme. Einige Bootstrümmer und unsere Sachen wollten sie jedoch erst finden, ehe sie die Gegend ohne ihren Chef verließen.
Tscherdon hatte mehrere Abenteuer gehabt. Mehreremal schienen uns Reiterpatrouillen zu suchen, und an einer Stelle standen 8 Soldatenzelte, um den Weg nach Lhasa zu sperren.
Wir ritten über einen Paß nach dem großen Lager; mehrere Reiterhaufen begegneten mir und geleiteten mich dorthin, artig grüßend, indem sie die Zunge herausstreckten. Das Lager lag in einem Längentale, durch welches wahrscheinlich auch Littledale gezogen war; ich wollte künftig seine Route nach Möglichkeit vermeiden. Alles war ruhig, aber dem alten Muhammed Tokta ging es schlechter. Ein Kamel war tot. Einer der Tibeter war gestorben. Wir ritten an der Leiche vorbei, die auf die Erde geworfen worden und von Geiern und Raben entsetzlich zugerichtet war; viel mehr als das Gerippe war nicht mehr davon übrig. Hladsche Tsering lud mich in sein Zelt ein und empfing mich wie einen Sieger. Unter der blauen Decke glänzten die Götterbilder matt durch einen Weihrauchschleier, und wieder gab es ein üppiges Gastmahl.
Diese Seefahrt war die letzte, die ich in Tibet machte, und das Boot sollte nachher nur noch auf einigen Flüssen benutzt werden. Ich bewahre den Tagen, die ich auf dem Selling-tso, Nakktsong-tso, Tschargut-tso und Addan-tso verlebte, ein ganz besonderes Andenken, denn sie waren für mich eine unvergeßliche Unterbrechung der langen, einförmigen Karawanenmärsche. Die Untersuchungen können nur als vorläufig betrachtet werden, aber sie gaben mir doch einen sehr wertvollen Überblick über die Hydrographie dieser wunderbar schönen Seeregion. Wenn die Wasserspiegel hier um etwa 50 Meter gehoben würden, so würde eine echte, an Norwegens und[S. 302] Schottlands Küsten erinnernde Fjordlandschaft entstehen. Wahrscheinlich ist auch dieses Land einst mit Eis bedeckt gewesen, obgleich man vergebens nach Gletscherspuren, Schrammen, Moränen oder erratischen Blöcken sucht. Die Gesteine sind verwittert, und alle Spuren fortgetragen, vernichtet. Der Addan-tso ist der höchste und größte See dieses Gebietes. Mehrere Flüsse von den angrenzenden Gebirgen, besonders von den hohen Schneeketten, die im Süden sichtbar sind, ergießen sich in ihn. Der Addan-tso entleert sein überflüssiges Wasser in den Tschargut-tso, und dieser hat in dem Jaggju-rappga-Flusse einen Abfluß nach dem Selling-tso. Weiter kommt das Wasser nicht; es bleibt im Selling-tso, wo es verdunstet, und daher ist auch nur dieser See salzig. In welchem Verhältnis der Nakktsong-tso zum Selling-tso steht, ist mir nicht ganz klar geworden. Möglicherweise existiert ein unterirdischer Abfluß, vielleicht aber ergießt er sich auch in einen weiter südlich liegenden See, den zu sehen uns nicht vergönnt war.
Am 25. September sollten wir uns von unseren Freunden Hladsche Tsering und Junduk Tsering, mit denen wir seit dem 12. zusammengewesen waren, trennen. Sie schickten mir jeder eine Haddik und ließen mir dabei eine gute und glückliche Reise wünschen. Dann erschienen sie selbst und versicherten, daß alles, was wir an Proviant, Führern und Lasttieren brauchten, uns dem Befehle des Dalai-Lama gemäß zur Verfügung gestellt werden würde. Als die Karawane marschfertig war, machte ich ihnen schnell einen Abschiedsbesuch und überreichte ihnen verschiedene Geschenke, wie Revolver, Messer, Kompasse und Zeugstoffe. Ich versicherte, daß ich nicht versuchen würde, nach Lhasa vorzudringen, und bat sie, den Dalai-Lama von mir zu grüßen; aber ich erklärte auch, daß ich dem Wege, den die Eskorte einschlage, nicht folgen würde. Ich sagte ihnen ein für allemal, daß die beiden Offiziere, die unsere künftige Eskorte auf dem Wege nach Westen anführen sollten, sich zu hüten hätten, mir gegenüber den Herrn spielen zu wollen, sondern mich jeden Morgen zu fragen hätten, wohin ich zu gehen wünschte. Andernfalls würden wir sie in zwei von unseren Kisten sperren und sie auf diese Weise mit in unsere Heimat nehmen.
Hladsche Tsering erwiderte, daß er und sein Amtsbruder Junduk Tsering mit einigen hundert Mann Kavallerie noch 20 Tage an dem Orte, wo wir uns trennten, zu bleiben gedächten (Abb. 280). Ich sah sehr wohl ein, daß dies nur eine List war, um uns davon abzuschrecken, schnell wieder umzukehren, sobald die beiden abgezogen waren, und antwortete daher, daß ich die Absicht habe, nur einige Tagereisen westwärts bis an den nächsten Süßwassersee zu gehen und dort zu bleiben, bis er vollständig zugefroren sei. Er klärte mich darüber auf, daß sie ohne Ungelegenheit ein ganzes Jahr in der Gegend lagern könnten. Als ich ihm vorschlug, daß[S. 303] wir, da wir ja beiderseits so viel Zeit hätten, einander denn doch lieber Gesellschaft leisten könnten, löste sich das Übertrumpfen in allgemeine Heiterkeit auf. Hladsche Tsering saß in seinem Zelte und aß Klops. Junduk Tsering war in dem seinen von Sekretären und ganzen Haufen von Papieren umgeben. Er verfaßte einen ausführlichen Bericht an den Dewaschung in Lhasa und schickte Briefe an die Häuptlinge im Westen auf dem ganzen Wege bis nach Ladak.
Unser Weg lief nach Westen durch ein 30 Kilometer breites Längental, das sowohl im Süden wie im Norden von ansehnlichen Bergketten begrenzt ward. Das Wetter war unfreundlich, kalt und windig, die Weide schlecht; trotzdem zählten wir 32 schwarze Zelte oder ungefähr 150 Einwohner auf 27 Kilometer. Sicherlich sind die Täler im Süden dichter, die nordwärts gelegenen spärlicher bevölkert; in der letzteren Richtung hört das Land überdies bald auf, bewohnbar zu sein. Mit uns ritten jetzt nur 22 Mann unter einem Anführer namens Jamdu Tsering, der bald mein ganz besonderer Freund wurde. Den Platz, an dem wir uns im Lager Nr. 89 niederließen, nannte er Schalung, und einen See, der sich im Westen zeigte, Daggtse-tso; ein Fluß, der sich in den westlichen Teil dieses Sees ergießt, heißt Boggtsang-sangpo. Da letzterer Name auf Nain Singhs und Littledales Karten vorkommt, kann man annehmen, daß auch die übrigen richtig sind. Sonst habe ich nur eine äußerst geringe Anzahl der Namen, die Littledale anführt, wiederfinden können.
[S. 304]
Am 26. September ritten wir nach der Stelle, wo sich der Boggtsang-sangpo in den See ergießt. Der Fluß teilt sich in mehrere Arme, und an den Ufern ist die Weide so reichlich, daß wir hier einen Tag rasten müssen. Wir hatten jetzt nur noch 22 Kamele, die alle sehr erschöpft waren. Die Pferde sind in schlechtem Zustand. Jetzt sahen wir nur 16 Zelte auf 28½ Kilometer, aber ziemlich große Schafherden. Die Gegend ist ziemlich reich an Kulanen, Antilopen, Rebhühnern, Hasen und Gänsen, und die Jäger versahen uns mit Fleisch in Menge. Der See ist viel kleiner als die vorhergehenden, aber stark salzig. Ringförmige Wälle an den Ufern verkünden, daß auch der Daggtse-tso im Austrocknen begriffen ist. An einer Stelle standen sieben solcher alten Uferwälle deutlich ausgeprägt übereinander.




Während der folgenden Tagemärsche hielten wir uns in der unmittelbaren Nähe des Boggtsang-sangpo (Abb. 281). An einem Punkte, wo wir den Fluß kreuzten, hatte ihn auch Littledale überschritten. Captain Bowers Route, die wir am Nakktsong-tso und Tschargut-tso gestreift hatten, liegt nun eine ziemliche Strecke nördlich von unserem Wege, und wir berühren sie nicht mehr. Nain Singhs Weg läuft einstweilen noch südlich von unserer Straße. Dadurch, daß ich jetzt dem Laufe dieses Flusses folgte, konnte ich die Routen der drei Reisenden, die vor mir diese Teile von Tibet besucht hatten, vermeiden. Es würde unsere Landeskenntnis vermehren, wenn ich andere Gegenden aufsuchte. Oft war es jedoch unmöglich zu entscheiden, ob ich mit Littledales Weg in Kollision war oder nicht. Die Karte dieses ausgezeichneten, unermüdlichen Reisenden ist leider in zu kleinem Maßstabe ausgeführt, als daß man sich mit ihrer Hilfe in dem Terrain zurechtfinden könnte. Bei den Anforderungen, die ich an meine Karte stellte, betrachtete ich die Landesteile, die meine Vorgänger durchreist hatten und in denen ich es nicht vermeiden konnte, ihre Routen zu kreuzen oder sogar auf kurzen Strecken ebenfalls zu benutzen, als unerforschtes Land. Auf Littledales[S. 305] Karte findet man z. B. weder den Nakktsong-tso noch den Tschargut-tso, auf der von Bower allerdings diese beiden Seen, aber nicht den Selling-tso. Bower reiste zwischen dem Nakktsong-tso und dem Tschargut-tso durch, aber er erforschte nicht das Verhältnis, in welchem die verschiedenen Seen zueinander stehen; der Addan-tso ist auf seiner Karte gar nicht angegeben, ebensowenig ein Abfluß des Tschargut-tso. Er hat geglaubt, daß der Jaggju-rappga ein Fluß sei, der sich in den Tschargut-tso ergießt, obwohl das Wasser aus dem See strömt. Es ist weder meine Aufgabe noch meine Absicht, das vorhandene Kartenmaterial über Innerasien in dieser Arbeit zu kritisieren, ich will nur erklären, weshalb ich Grund hatte, manchen Landesteil, den auf der Karte eine rote Linie durchzieht, als eine terra incognita zu betrachten. Der Zweck einer Reise durch unbekanntes Land ist doch, daß man vor allem eine Karte desselben vorzeigen kann, und eine solche ist zwecklos, wenn sie nicht vollkommen zuverlässig ist. Was haben die großen Strapazen und Kosten, die mit einer solchen Reise verbunden sind, sonst für einen Nutzen? Littledales und Bowers Reisen sind übrigens bewundernswerte Beweise von Kraft und Ausdauer. Von den drei Karten aber ist Nain Singhs die beste, obwohl sie einer Revision sehr bedarf. —
Die erste Tagereise längs des Boggtsang-sangpo ging durch ziemlich gutes Weideland; hier und dort zeigten sich Nomadenlager. Das Wetter war herrlich, obgleich die Nachtkälte bis auf −8 Grad fiel. Es war ganz windstill, keine Wolke sichtbar; solches Wetter würde uns auf dem Tschargut-tso gefallen haben. Wenn man, wie wir, nach Westen reitet, wird die linke Seite des Gesichtes so von der Sonne angegriffen, daß die Haut stückweise abblättert, während die andere eisig kalt ist. Der linke Fuß hat es schön warm, indes der rechte im Schatten beinahe erfriert.
Am 29. September legten wir 29 Kilometer zurück und lagerten am Ufer des Flusses im Lager Nr. 92 unmittelbar neben seinen brausenden Wirbeln (Abb. 282, 283). In der Dämmerung langten die Tibeter an und schlugen ihre Zelte uns gerade gegenüber am rechten Ufer auf.
Am folgenden Tag marschierten wir auf dem südlichen Ufer. Der Fluß macht viele Krümmungen und hat ein scharf ausgeprägtes Bett. Das südlich von seinem Tale liegende Gebirge heißt Nangra. Schagdur hatte sich ein paar Stunden lang nicht sehen lassen; als er uns aber einholte, schwenkte er triumphierend ein Bündel prächtiger Fische in der Luft. Sobald wir das Lager aufgeschlagen hatten, wurde das Boot zusammengesetzt, und die Lopmänner fischten mit dem Schleppnetz in den Flußbiegungen (Abb. 286). Die Angler hatten jedoch mehr Glück.
Drei Tage Marsch und den vierten Rast ist jetzt unter gewöhnlichen Verhältnissen die Regel. Infolgedessen war der 1. Oktober ein Rasttag;[S. 306] er wurde von den meisten zum Fischfang benutzt. Schagdur hat das größte Fischglück; er angelte 18 Stück und schoß außerdem zur Abwechslung eine Antilope. Turdu Bai steht den ganzen Tag wie ein alter, in der Sommerfrische befindlicher Onkel mit seiner Angelrute in der Hand am Ufer und hat dabei die unerschütterliche Geduld des echten Anglers. Er schmunzelte ordentlich, als er mir seinen Fang zeigte. Der Lama las heilige Schriften. Jamdu Tsering und Tsering Daschi (Abb. 284), die Anführer unserer Leibwache, baten mich, ihnen eines unserer Schafe zu überlassen, da sie nichts mehr zu essen hätten, beim nächsten Zeltlager sollten wir Ersatz dafür erhalten. Ihre Bitte wurde ihnen mit um so größerer Bereitwilligkeit gewährt, als sie uns schon viele Freundlichkeiten erwiesen hatten.
2. Oktober. In der Nacht hatten wir −11 Grad; der Winter naht sich, wir müssen uns beeilen, nach Ladak zu kommen. Der Tagemarsch führte nach Westsüdwest, auf dem Südufer des Boggtsang-sangpo, und zum vierten Male lagerten wir an diesem Flusse (Abb. 285). Die Breite betrug hier nur 6 Meter, aber die Tiefe war groß. Die Zelte sind kaum aufgeschlagen, als die Angelruten schon wieder in voller Tätigkeit sind. Während dieser Tage lebten wir hauptsächlich von Fischen, ich fast ausschließlich.
Am 3. Oktober folgten wir dem Flusse zum letzten Male und ließen ihn nachher links liegen. Ich hätte gar zu gern einen südlicheren Weg eingeschlagen, aber das Land war zu gebirgig für die Kamele. Heute tröstete ich mich überdies mit der Aussicht, den Berg kennenzulernen, den Littledale den „Vulkan Tongo“ nennt, von dem mir aber gesagt wurde, daß er Erenak-tschimmo heiße. Von unserem Lager Nr. 95 aus gesehen, glich er an Gestalt einem regelrechten Vulkankegel; aber von dem heutigen Passe sah man, daß er, wie alle anderen Kämme hier in der Gegend, eine nicht unbedeutende Ausdehnung nach Westen hatte. Die Karawane mußte ihre eigene Straße mit den Tibetern ziehen, während wir, nämlich ich, der Lama und Tschernoff, nach dem Berge hinaufritten. Über einige Konglomeratplatten gelangen wir an einen Bach am Fuße des Berges, wo ein einsames Nomadenzelt aufgeschlagen war. Wir ritten so hoch hinauf, als unsere Pferde es aushalten konnten, und gingen dann zu Fuß weiter. Bald hatten wir jedoch genug vom Klettern und rasteten eine gute Weile. An einigen Stellen trat anstehendes Gestein zutage, das aus Granit, kristallinischem Schiefer und Porphyr bestand, während verschiedene andere Gesteinarten durch lose Stücke vertreten waren. Ein Vulkan ist dieser Berg nicht und ist es auch nie gewesen; er ist nur ein Glied in den parallelen Ketten, die, von dem hohen Aussichtspunkte betrachtet, die ganze Landschaft als ein unentwirrbares Durcheinander von Kämmen und Rücken erscheinen lassen, in welchem wir[S. 307] nur die dominierenden Schneegipfel und die Täler, durch welche wir vom Daggtse-tso an gezogen sind, wiedererkennen. Herrlich und friedvoll war es dort oben mitten in den Wolken und Winden, fern von der Karawane und ihren kleinen Intrigen; ich wäre gern ein paar Tage dort geblieben.
Im östlichen Giebel des dritten der kleinen krenelierten Kämme gibt es eine runde Grotte mit einem äußeren und einem inneren Raume, die eine Mauer aus Steinplatten trennt. Der Eingang der Grotte ist ungefähr 3 Meter hoch. Nach der dicken Rußschicht an der Decke zu urteilen, ist die Grotte lange Zeit bewohnt gewesen; der Felsboden in ihrem Inneren ist mit Schafmist bedeckt. Wir saßen eine Weile in der Grotte und genossen die malerische Aussicht durch ihre Öffnung — das ganze Tal glänzte im Sonnenschein, während wir uns bei Windstille im kühlen Schatten befanden. Auf verschiedenen Steinplatten sind die Worte „Om mani padme hum“ eingehauen. Vielleicht hat ein Eremit, der sein Leben den Göttern des Berges geweiht, hier seinen Wohnsitz gehabt.
Dann ritten wir weiter nach einem ziemlich bequemen Passe hinauf. Unterwegs fanden wir Hamra Kul in einer Rinne. Er hätte tot sein können, so regungslos lag er auf der Seite. Ich trat an ihn heran und betrachtete ihn; er jammerte und versicherte, keinen Schritt mehr gehen zu können. Er wurde einstweilen liegengelassen, denn ich wußte ganz genau, wo ihn der Schuh drückte. Gestern war er nämlich von seinem Posten als Führer der Pferdekarawane abgesetzt worden, weil er sich wiederholt hatte Nachlässigkeiten zuschulden kommen lassen, und Mollah Schah war zu seinem Nachfolger ernannt worden.
Jenseits des Passes (5014 Meter) hatten sich die Tibeter niedergelassen, die nun kamen, um mir ihr Bedauern darüber auszudrücken, daß wir nicht auf sie hätten hören wollen, als sie gesagt, weiter fort gebe es keine Weide. Ich konnte es nicht ändern und ritt in der Dunkelheit nach dem Lager, das in einer Gegend namens Tschuring aufgeschlagen war. Hier wußte Mollah Schah, der in Littledales Diensten gewesen war, Bescheid, und zu noch größerer Gewißheit fanden wir ein Eselhufeisen, das von keiner anderen als des Engländers Karawane stammen konnte.
Der 5. Oktober, an dem wir 24 Kilometer nach Westen ritten, war einer der schlimmsten Tage, deren ich mich erinnern kann. Nachts hatten wir −13,7 Grad gehabt, und der Bach am Lager war zugefroren, so daß ich wiederholt durch das helle Krachen der Eisscheiben geweckt wurde. Bei dem Kohlenbecken in der Jurte spürt man die Kälte nicht, aber bei direktem Gegenwind und halbem Sturm war es grimmig kalt auf dem Ritte. Man erlahmt, wird durchkältet und ist schließlich arbeitsunfähig. Die Sonne stand fast den ganzen Tag am Himmel, aber der Wind neutralisiert ihre[S. 308] Wirkung. Sowohl die Unseren wie die Tibeter gingen meistens zu Fuß, um nicht zu erfrieren. Mir war es eine außerordentliche Anstrengung, in einer solchen Höhe gegen solchen Wind zu Fuß zu gehen. Wenn ich das Gefühl in den Händen verliere, raste ich daher eine Weile in der Schlucht mit dem Rücken gegen den Wind und rauche eine Pfeife. Einigermaßen aufgetaut, hole ich die Karawane zu Pferde ein, bin dann aber schon wieder für eine neue Rast reif. Das wird ein netter Winter werden, dachten wir, wenn schon der Herbst so eisig kalt ist! Am traurigsten ist es jedoch, daß es mit allen unseren Kamelen und Pferden beinahe gleichzeitig zu Ende geht. Eines der jungen Kamele aus Tscharchlik blieb heute schon zu Anfang des Marsches zurück. Ich wollte es töten lassen; aber nachdem es uns gelungen war, es wieder auf die Beine zu bringen, führte ich es selbst, bis es sich wieder hinlegte. Der Packsattel wurde ihm abgenommen und aufgetrennt, und es fraß das Strohpolster mit gutem Appetit. Sein ganzer Körper gewährte einen traurigen Anblick, nur Haut und Knochen, und doch will man die Tiere nicht eher opfern, als bis man sie nicht mehr dazu bewegen kann, auch nur einen Fuß vorzusetzen. Man hofft stets, an einen Weideplatz zu gelangen, wo die Müden ihre erschöpften Kräfte wiedergewinnen können. Nachdem ich einen Mann bei ihm zurückgelassen hatte, ritt ich weiter, doch nur, um bald zwei Kamele zu überholen, die ebenfalls mit ihren Führern zurückgeblieben waren. Eines von ihnen hatte die dumme Gewohnheit, bei jedem Schritt mit dem linken Vorderfuße gegen den rechten zu schlagen, wodurch eine Wunde entstanden war, die nie ruhig heilen konnte, sondern beständig blutete. Die Wunde mußte täglich nachgesehen, ausgewaschen und verbunden werden.
Später überholten wir zwei zurückgebliebene Pferde, die Kutschuk führte. Das eine von ihnen war dasjenige, welches ich geritten hatte, als ich vor mehr als zwei Jahren Kaschgar verließ, also der älteste Veteran unter den Pferden. Das andere war einer von Kamba Bombos Schimmeln. Mein Reitpferd, auf dem ich von Tscharchlik aufgebrochen war und das wir schon ein paarmal für verloren gehalten hatten, kam noch immer mit, wenn auch mit Mühe und Not.
Die Krankenliste ist gegenwärtig größer als je. Hamra Kul, der gestern zurückblieb, wurde von einigen freundlichen Tibetern geholt. Mit Muhammed Tokta geht es in alter Weise, d. h. er muß auf seinem Pferde angebunden werden und lehnt dort vornüber gebeugt, still und geduldig, gegen ein Kissen. Almas hat Augenschmerzen und behauptet, fast blind zu sein; nachdem er aber ein wenig Kokain und eine dunkle Brille bekommen, ist er bedeutend munterer. Bei solchem Wind muß man indessen ganz besonders eingerichtete Augen haben, wenn sie einem nicht wehtun sollen.[S. 309] Nach dem heutigen Tagemarsche braucht man eine gute Stunde, ehe man wieder arbeitsfähig ist. Ich glaube nicht, daß das Erfrieren so schlimm ist; man erstarrt zur Gefühllosigkeit ohne nennenswerte Schmerzen. Am Abend wurde auch Chodai Kullu krank gemeldet; er hatte Fieberschauer und Kopfschmerzen, weshalb er Chinin bekam. Bald steht die halbe Karawane auf der Krankenliste.
Ich ließ mir Jamdu Tsering rufen und sagte ihm, es werde jetzt wirklich Zeit, daß er uns die vom Dalai-Lama zugesagten Yake besorge; er versprach, die Sache bald ins Reine zu bringen.
Im Laufe des Tages ritten wir an dem Flusse hinauf, der sich weiter östlich in den Boggtsang-sangpo ergießt. Hier und dort sehen wir Schafhürden, die einfach aus einer halbkreisförmigen Steinmauer bestehen, deren höchster Teil dem hier vorherrschenden Westwinde zugekehrt ist. Die grauen Mauern stechen scharf ab gegen den Boden im Innern, der mit Mist bedeckt ist.
In der Gegend von Setscha (5048 Meter) mußten wir an einem nicht unbedeutenden Flusse Halt machen; Ahmed, Islam, Hamra Kul, der Mollah, Tschernoff, drei Kamele und zwei Pferde waren zurückgeblieben. Sie langten erst lange nach Dunkelwerden an. Das erste Kamel hatte getötet werden müssen, das zweite sollte morgen geholt werden, nur das dritte war noch mitgekommen. Ein Pferd war gestorben, das Kaschgarpferd lag am folgenden Morgen, 6. Oktober, tot beim Lager, ein drittes brach auf dem Wege nach dem nächsten Rastorte zusammen. Die Karawane verkleinert sich nur allzu schnell!
Die Nachtkälte sank auf −14,9 Grad, und das Eis des Flusses trug. Ein ganz kurzer Tagemarsch wurde gemacht, um einen Platz mit besserer, wenn auch erbärmlicher Weide zu erreichen. Wenn wir so langsam vorwärtsschreiten, können wir kaum hoffen, vor Weihnachten nach Ladak zu gelangen. In dem Lager Nr. 98, wo wir Yake erhalten sollten, wurden im Laufe des Tages alle unsere Sachen umgepackt. Alle Lasten wurden auseinandergenommen und zu kleineren Ballen verschnürt, denn der Yak ist einer Kamellast nicht gewachsen.
Schon um 9 Uhr abends hatten wir −10,6 Grad und nachts −17,9 Grad. Der Winter hatte schon seinen Einzug gehalten, und sein Regiment würde nun volle sieben Monate dauern!
Unter dem Vorwand, nach Weide zu suchen, eigentlich aber um nicht denselben Weg wie Littledale gehen zu müssen, brach ich am Morgen des 7. Oktober nach einer südlicheren Richtung auf und nahm Tschernoff, Li Loje, den Lama und Kutschuk, 4 Maulesel, 5 Pferde und Proviant mit. Über Nacht waren 18 vortreffliche Yake angelangt; sie mußten die Lasten[S. 310] übernehmen (Abb. 287), und die meisten unserer Tiere, vor allem die erschöpften, wurden mit Arbeit verschont. Schagdur wurde zum Befehlshaber ernannt und hatte das Recht, überall, wo gute Weide war, einige Tage zu bleiben. Die Kranken waren in Besserung; nur für die Genesung des alten Muhammed Tokta war nicht viel Hoffnung vorhanden, er blieb aber in bewundernswerter Weise guten Mutes.
Als wir uns in Gang setzen wollten, stürmten eine Menge Tibeter herbei und ergriffen unsere Pferde und Lasttiere bei den Zügeln und Halftern; sie könnten uns unter keiner Bedingung nach Süden reiten lassen, denn dann würden sie alle geköpft werden. Ich ließ ihnen durch den Lama sagen, wenn sie die Tiere nicht sofort losließen, würden wir zu den Revolvern greifen, was für sie entschieden sehr unangenehme Folgen haben könnte. Sie zogen sich zurück, folgten uns aber noch eine Strecke weit zu Fuß und versicherten, daß es hierzulande nach Süden hin weder Weide noch gangbare Wege gebe. Als wir schließlich nicht mehr antworteten, kehrten sie um.
Über einen nicht sehr hohen Paß in der nächsten Kette gelangten wir an den Oberlauf des Tschuring. Der Fluß war hier teilweise zugefroren. Tschernoff stach fünf mittelgroße Fische mit seinem Säbel, fiel jedoch in seinem Eifer dabei ins Wasser. Auf dem Passe erschien jetzt eine Schar von 12 Tibetern, die den steilen Abhang hinunterjagten, uns bald einholten und uns mit ihrem ewigen Schellengeklingel und Waffengerassel folgten. Tsering Daschi führte die Schar; die übrige Mannschaft blieb unter Jamdu Tsering bei der Karawane. Wir ritten an einigen Zelten vorbei, deren Bewohner bestürzt herauseilten, um diese außergewöhnliche Gesellschaft zu betrachten. Tsering Daschi zeigte nach einem Passe im Nordwesten, dem „einzig möglichen“, aber wir ließen uns nichts weismachen, sondern gingen flußaufwärts weiter. Ein Schimmel, der schon müde war, zwang uns Lager zu schlagen, und wir beschäftigten uns dann mit ergiebigem Fischfang. Abends traf noch eine Reiterschar ein, und wir hörten, wie sich die Männer eifrig miteinander berieten.
Bei Tagesanbruch erhielt unser Gefolge wieder Verstärkung, und jetzt erschien auch der alte Jamdu Tsering. Die Tibeter hatten keine Zelte mitgenommen und hockten frierend unter freiem Himmel. Der alte Herr sah bedauernswert aus; er war die Nacht durch geritten und war durchgefroren, niedergeschlagen und betrübt über die Sorgen, die wir ihm machten. Er bat mich, doch um Gottes willen wieder zu der Karawane zurückzukehren, und sagte, als nichts half, er habe seine Soldaten die Lasten von den Yaken nehmen lassen — sie dürften uns nicht helfen, wenn wir uns ihrem Willen nicht fügten. Dies war entschieden gelogen, andernfalls hätte mir Schagdur einen Kurier geschickt.
[S. 311]
Als wir talaufwärts nach Süden weiterritten, erklärte Jamdu Tsering, daß er jetzt wirklich zurückreiten und uns die Yake nehmen werde. „Tut das“, sagte ich, „nehmt euch aber vor den Kosaken in acht!“ Es wimmelte um uns her wieder von Soldaten und Reitern; eine neue Mobilmachung war in Szene gesetzt worden. Der gute Jamdu Tsering hatte so viel zu bedenken, daß er gar nicht wußte, wo ihm der Kopf stand.
Während des Rittes sahen wir noch mehrere Nomadenzelte im Tale. Sind die Bewohner gar zu zudringlich, so braucht nur ein Soldat eine Handbewegung zu machen, und sie verschwinden. Merkwürdig, wie dies halbwilde Volk zusammenhält! Eine Art Freimaurerei scheint unter ihnen zu herrschen; sie sind den Göttern und der Obrigkeit in blindem Gehorsam untertan und würden sich durch kein Gold erkaufen lassen. Es würde uns nicht gelingen, jemand zu überreden, uns einen Weg nach Süden zu zeigen. Man denke, ein Land, in dem es keinen einzigen Verräter gibt!
Am Ufer des Dschandin-tso, des Quellsees des Tschuring, wurde das Lager Nr. 100 aufgeschlagen. Der See war leicht überfroren, aber der Wind zertrümmerte nachher den Eisspiegel.
Am 9. Oktober lag der See nach einer kalten Nacht wieder eisbedeckt da. Nur sechs Tibeter waren noch bei uns geblieben. Sie erkundigten sich höflich nach unseren Absichten, und ich deutete nach Westsüdwest, wo sich ein Tal öffnete. Die Tagereise führte uns durch dieses, und sobald wir jene Richtung eingeschlagen hatten, verschwanden drei Reiter, um Jamdu Tsering Bescheid zu bringen. Der Paß, der jetzt überschritten wurde, hatte eine bedeutende Höhe, und von seinem Kamme hat man die großartigste Aussicht über diese gigantischen, majestätischen Gebirgsgegenden. Gerade im Westen erhebt sich, ganz mit ewigem Schnee bedeckt, der gewaltige Gebirgsstock Schah-gandschum. Er bildet drei Dome, von denen der mittelste der höchste ist, und hatte in der völlig klaren, reinen Luft eine herrliche Wirkung; man sehnt sich förmlich nach seiner friedlichen Freistatt.
In der Gegend Amrik-wa ließen wir uns zwischen den Höhlen der Murmeltiere nieder. Der Wind heulte um das Zelt, es war so kalt, wie in dem ärgsten Eiskeller, man ist wie zerschlagen von der Kälte.
Der folgende Tag war von demselben trostlosen Pfeifen und Stöhnen des Windes begleitet. Der Himmel ist leuchtend blau wie der edelste Türkis; aber dennoch hält der unermüdliche Passatwind an, der von allem Ungemach hier im Lande das ärgste ist. Unser Weg geht zwischen dunkeln wilden Felsen über mehrere unbedeutende Pässe nach Westnordwesten. Hier gibt es viele Kulane, Antilopen und Wölfe. Das Tal wird schließlich offener, und der Boden senkt sich langsam nach Nordwesten. Auf der linken Seite zeigen sich fünf Zelte. Wir rasten unter einem einzelnen Berge,[S. 312] um geschützt zu sein, aber über seinem Gipfel toben und brausen die Windstöße wie wirbelnde Wasserfälle. Einige Ketten sind mit Schnee bedeckt, und der Wind bläst den Schnee von ihren Kämmen, daß er weißen Puderwolken oder in der Sonne blendend weiß erscheinenden Kometenschweifen gleicht.
11. Oktober. Der Zustand der Pferde erlaubte keine weiteren Abstecher nach Süden. Wir waren in viel zu hohe Regionen geraten und mußten uns wieder mit den Unsrigen vereinen. Wir ritten daher über ein sehr offenes, weites Tal nach Nordwesten, wobei der herrliche Schah-gandschum links von unserem Wege in unserer unmittelbaren Nähe sich frei erhob. Der Koloß gewährte mit seinem ewigen Schnee und seinen vier rudimentären Gletschern einen wundervollen Anblick. Littledale nennt ihn Shakkanjorm; er ging hier durch ein nördlicheres Tal.
Auf halbem Wege trafen wir Jamdu Tsering, der uns durch seine Kuriere die ganze Zeit über im Auge behalten hatte. So seltsam es auch klingen mag, wir freuten uns beide aufrichtig, einander wiederzusehen, und begrüßten uns auf das freundlichste. Er könne nun selbst sehen, sagte ich, daß ich mit meiner Reise nach Süden keine bösen Absichten gehabt habe, wogegen er beteuerte, es habe ihm nur leid getan, daß ich unnötigerweise über eine ganze Reihe von Pässen klettern sollte, und er sei ganz entsetzlich besorgt gewesen, daß dies mich angreifen würde!
In einem Quertale ritten wir nach Nordwesten weiter. Der Lagerplatz der großen Karawane lag an einem Quellbache, der klein, aber tief, klar und fischreich war, so daß ich zum Mittagsessen wieder Fische erhielt (Abb. 288). Alle befanden sich gut, außer unserem Alten, dessen ganzer Körper aufgedunsen war. Ich versuchte, ihn auf die zweckmäßigste Weise zu behandeln; er erklärte jedoch, er wolle gar nicht geheilt werden, er habe nur den Wunsch gehabt, mich noch einmal wiederzusehen und dann zu sterben! Armer Mann!
In diesem Lager, Nr. 103 (4860 Meter), trennten wir uns am 13. von Jamdu Tsering und Tsering Daschi, die nur beauftragt waren, uns bis hierher an die Grenze zu bringen, und nun baten, ihnen zu bescheinigen, daß sie ihren Dienst gut verrichtet hätten und ich mit ihnen zufrieden gewesen sei. Man sieht daraus, daß sie Befehl erhalten hatten, höflich zu sein. Der Lama mußte das Zeugnis aufsetzen. Hier in der Gegend soll die Grenze zwischen Nakktsong und der nächsten Provinz sein, deren Name, Bomba, auch auf Littledales Karte angegeben ist. Ein neuer Häuptling, Jarwo Tsering, sollte von nun an für unsere Weiterbeförderung sorgen.
Jamdu und sein Kamerad ließen sich nicht mehr sehen, weshalb ich die Revolver und Messer, die ich ihnen zu schenken gedacht hatte, behalten[S. 313] konnte. Die alten Yakbesitzer waren abgelohnt worden und mit ihren Tieren abgezogen, aber es waren uns neue versprochen worden. Anfangs mußten wir jedoch allein für unser Gepäck sorgen. In dem reizenden Tale Ramlung stellten sich die neuen Yake ein, begleitet von ihren Besitzern und unseren beiden alten Reisegefährten, die augenscheinlich nicht um ihre Geschenke kommen wollten. Nach Osten hat man von hier eine weite Aussicht; bei Sonnenuntergang waren die in der Ferne verschwimmenden Kämme wie von einem Steppenbrande beleuchtet. Scharf gezeichnet stehen die schwarzen und weißblauen Zelte der Tibeter im Vordergrund zwischen dem hohen, harten, gelben Grase, in dem die Männer ihre Pferde von Zeit zu Zeit nach einer anderen Stelle führen. Im Zenith ist der Himmel rosig, am östlichen Horizont dunkelblau; letzteres ist der Widerschein von den Gegenden, in denen schon Nacht herrscht. Wir hatten nicht mehr als 16 Kilometer zurückgelegt; es kam sehr selten vor, daß wir unter solchen Verhältnissen mehr als 20 Kilometer marschieren konnten.
Am 14. Oktober zogen wir mit 30 neuen Begleitern und 22 Yaken ab, die für ein Tsos täglich pro Yak gemietet waren. 8 Tsos wurden uns hier für 1 Liang chinesischen Silbers gegeben, wobei wir natürlich übervorteilt wurden. Die Tibeter versuchten sichtlich, die Länge der Tagereisen möglichst abzukürzen, aber es gelang ihnen nicht, ich bestimmte stets die Lagerplätze. Das Wasser fängt jedoch an, immer seltener zu werden, und manchmal war es unmöglich, ohne die Hilfe der Tibeter Quellen zu finden. Schagdur, der stets fürsorglich war, verschaffte uns sowohl süße wie sauere Milch aus einem Zelte, das er in einer Schlucht entdeckte. Das Terrain senkt sich langsam nach Norden, und manchmal kann man in dieser Richtung bis zu sechs parallele Bergketten hintereinander zählen. Wir zogen hier auf einem südlicheren Wege als Littledale. An der Scholungquelle erwartete uns am Abend des 15. eine neue Reihe von Yaken, und auch am folgenden Tage wuchsen neue Trabanten wie mit einem Zauberschlage aus der Erde. Die bisherigen Yakleute machten Schwierigkeiten und wollten durchaus mit Tsos von Lhasa bezahlt werden, denn chinesisches Silbergeld war ihnen fremd. Als ich ihnen jedoch erklärte, daß sie in solchem Falle gar nichts bekämen, wurden sie fügsamer.
Tscherdons Pferd starb, und von den anderen können nur noch wenige ihre Reiter tragen. Vier Mann reiten Maulesel, die viel zäher und ausdauernder sind als Pferde. Muhammed Toktas Füße waren so geschwollen, daß die Stiefel heruntergeschnitten und die Füße mit Filz umwickelt werden mußten. Auf der ganzen Tagereise sahen wir keinen Tropfen Wasser; das Gras ist erbärmlich, und das Land immer spärlicher bewohnt. Doch werden stets so viele Schafe, als wir brauchen, für uns bereitgehalten.
[S. 314]
Am 18. Oktober machten wir eine interessante, 20 Kilometer lange Reise nach Südwesten. Vom Lager ritten wir nach dem Abhang der Kette, die unser Längental im Süden begrenzte, hinauf. Die Tibeter nahmen mit allen Yaken und unserem Gepäck den Weg durch eine Schlucht und erklärten, daß wir über einen leichten Paß müßten. Ja, für die Yake mochte er nicht schwer sein, aber für die Kamele war er sicherlich mörderisch. Wir zogen daher längs des Fußes des Gebirges über zahllose Rinnen weiter. Von dem Vorsprunge, wo wir nach Süden abbiegen, wird jetzt in unserer Nähe der Salzsee Lakkor-tso sichtbar. Littledale zog in ziemlicher Entfernung nach Norden hin an diesem See vorüber; er machte die sehr richtige Beobachtung, daß die meisten der tibetischen Salzseen im Austrocknen begriffen sind. Dies fällt bei dem Lakkor-tso besonders auf. Längs seiner Ufer erstrecken sich alte Uferlinien, die sich zu bedeutender Höhe über den Seespiegel erheben. An flachen, langsam abfallenden Uferstrecken bilden sie Wälle, hinter denen oft Lagunen stehen. Die Ufer sind kreideweiß von Salz, das, trocken und pulverisiert, vom Winde in weiße Wolken aufgewirbelt wird, die Wasserdampf oder stäubendem Mehle gleichen. Während des weiteren Marsches nach Süden nach dem heutigen Lager am Flusse Somme-sangpo, der westwärts dem See zuströmt, gingen wir oft über Buchten, die jetzt ausgetrocknet, aber von mächtigen Wällen eingefaßt und mit Pyramiden und Kegeln angefüllt waren, die aus entschieden vom Winde ausgemeißelten Salzablagerungen bestanden.
Bei dem Lager war die Weide gut. Im Süden zieht sich noch immer eine wilde, gewaltige Bergkette hin, die uns, soweit wir sehen können, noch mehrere Tage den Übergang mit Kamelen schwerlich erlauben wird.
Der Hund Hamra mußte erschossen werden, weil er uns nachts nie ruhig schlafen ließ. Hatte er keine Tibeter anzubellen, so bellte er unsere eigenen Nachtwachen und die Karawanentiere an. Zwei Pferde starben; seltsamerweise gebaren in derselben Nacht zwei Kamelweibchen zu früh Füllen. Turdu Bai glaubte, dies sei der Kälte, −15,4 Grad, und dem Umstande zuzuschreiben, daß sie außer der Zeit kaltes Wasser getrunken hatten. Die Mütter befanden sich jedoch vorzüglich und durften am 19. ausruhen. Auch an diesem Lagerplatze erhielten wir neue Wächter und 40 Yake. Schon um 9 Uhr waren es fast −10 Grad; man konnte den Fluß zufrieren hören, denn es klang und knallte in den neugebildeten Eisscheiben.
[S. 315]
Am 20. Oktober begann der Passatwind um 9½ Uhr. Ich nenne diesen Wind mit Vorliebe so, denn er weht mit staunenerregender Regelmäßigkeit. Nach Mittag schwoll er zum Sturme, einem vollständigen Wüstensturme, an und jagte so dichte Wolken von Sand, Staub und Salz vor sich her, daß die Landschaft oft völlig verschwand. Dennoch war es ein prächtiger Anblick, wie diese kreideweißen Wolken von dem Westufer des Lakkor-tso über den See und von dem östlichen Ufer landeinwärts wirbelten, während die ebenso weißen Wogen gegen den Strand tosten. Als wir an diesem entlangzogen und der Wind mit besonderem Nachdruck uns von der Seite packte, schwankten die Kamele wie Trunkene, und die Reiter hatten Mühe, sich im Sattel zu halten. Zwei wichtige klimatische Charakterzüge haben wir gefunden: die Regenzeit tritt im Spätsommer ein und dauert den Vorherbst hindurch, und ihr folgt, nach einem kurzen Zwischenraum von schönen Tagen, eine Periode mit vorherrschendem Westwind, die den Spätherbst und Winter charakterisiert.
Dann und wann fliegt eine Filzdecke, ein Sack oder sonst ein Gegenstand von einem Kamele und muß wieder festgebunden werden. Ich muß den Deckel meines Marschroutenbuchs gegen den Wind halten, damit mir die Blätter nicht zerrissen werden, und wie gewöhnlich ist man von der Kälte durchfroren. Heute blieb eines der Pferde aus Lhasa liegen und mußte getötet werden. Der Schimmel aber, den wir auf dem Rückzuge nach dem Hauptquartier für verloren hielten, kommt noch immer mit. Die übrigen Tiere hielten sich aufrecht, obwohl es mehrere Todeskandidaten unter ihnen gab.
Wir gehen flußabwärts nach Westen und haben auf beiden Seiten sehr hohe Bergketten. Am Endpunkt der rechten Kette schwenkt der Fluß nach Norden ab und ergießt sich in den See, an dem hier ein Salzfeld mit gewaltigen Hügeln weiß wie Mehl glänzt. Bald darauf befinden wir uns unten auf dem ziemlich steilen Ufer und halten uns auf einer hohen Terrasse, bis wir an einen neuen Fluß gelangen, der von Südsüdosten[S. 316] kommt und sich ebenfalls in den See ergießt. An seinem linken Ufer wurde Halt gemacht (Abb. 289). Alle Berge in der Nähe waren scharf gezeichnet mit horizontalen Linien, die bei gewissen Beleuchtungen wie schwarze Bänder aussahen. Ich beschloß, am nächsten Morgen zu messen, wie hoch die oberste Wasserlinie über dem jetzigen Seespiegel lag.
Während des Marsches ereignete sich ein eigentümliches Abenteuer. Der alte Muhammed Tokta blieb zurück, aber niemand achtete darauf. Hamra Kul, der mit einigen müden Pferden langsam hinter der Karawane herzog, fand ihn in einer Grube, wo sich der Alte, wie er ganz vergnügt erklärte, des Reitens müde, hatte vom Pferde fallen lassen, welches sicherlich nichts dagegen gehabt und sich nachher zu der Karawane gesellt hatte. Hamra Kul nahm den Alten auf einem seiner Pferde mit, und im Lager wurde er wie gewöhnlich weich in Decken und Pelze gebettet. Abends machte ich ihm meinen gewöhnlichen Krankenbesuch, um mich nach seinem Befinden zu erkundigen und mich zu überzeugen, daß es ihm an nichts fehle. Manchmal pflegte er eine kleine Dosis Sulfonal zu erhalten, um schlafen zu können. Diesmal sollte er jedoch einen langen, tiefen Schlaf tun, ohne vorher ein Schlafmittel einzunehmen. Er antwortete auf alle Fragen und wollte am liebsten Milch haben, weshalb ich den anderen sagte, sie sollten ihm alle noch vorhandene Milch bringen, von der er auch eine große Schale voll austrank. Als ich ihn nach seinem Befinden fragte, lächelte er freundlich. Die Sonne war jedoch noch nicht wieder aufgegangen, als er schon steif und kalt war. Keiner hatte gemerkt, wann sein letzter Lebensfunke in der Morgenkälte erlosch. Mollah Schah, der die letzte Nachtwache hatte, war fortgegangen, um Brennmaterial zu sammeln. Der Tod hatte den alten Kameltreiber im Schlafe überrascht; seine Augen waren fest geschlossen, und er lag noch ganz in derselben Lage wie am Abend vorher.
Dieser Todesfall brachte für die Übrigen ein Gefühl der Erleichterung mit sich, denn auf Besserung hatte keiner mehr gehofft, seitdem der Körper des Kranken angeschwollen war und eine häßliche, dunkle Farbe angenommen hatte. Ihm selbst war das Leben während seiner viermonatigen Krankheit nur eine drückende Last gewesen, und der Tod war hier als Erlöser erschienen. Er war ein redlicher, ehrlicher Mensch, und ich hörte nie, daß jemand unfreundlich gegen ihn war, obgleich er wider seinen Willen seinen Kameraden zur Last war; alle hatten ihn gern, weil er selbst freundlich und stets guter Laune war und von seiner Krankheit nie viel Aufhebens machte. Noch die letzten Abende hatte er trotz aller Verbote versucht, sich aufzurichten und zu grüßen, wenn ich ihn besuchte.
Die übrigen Muselmänner trafen sofort Anstalten zur Beerdigung,[S. 317] und noch ehe ich mit der Todesnachricht geweckt wurde, gähnte schon finster und unheimlich das Grab, das ihn in seine kalten Arme schließen sollte. Aus den Boothälften wurde ein provisorisches Zelt errichtet, in dem die Leiche gewaschen wurde. Sodann wurden ihr die Kleider und der Pelz des Alten wieder angelegt und sie auf einer Kamelleiter zu Grabe getragen, wo dieselbe Zeremonie wie bei Kalpets Leichenbegängnis stattfand. Muhammed Tokta war der vierte, der auf dieser anstrengenden Reise im innersten Asien und Tibet zugrunde ging; es war ein großer Verlust!
Die beiden Kranken, die jetzt auf der Liste standen, Almas und Ahmed, fühlten sich nach diesem neuen Begräbnisse durchaus nicht besser; dem ersteren war das ganze Gesicht geschwollen, und ich war seinetwegen lange in Unruhe, ehe er sich wieder erholte.
Diese unheimliche Krankheit, die bei den drei in Tibet gestorbenen Männern mit ungefähr gleichen Symptomen auftrat, hat ihre Ursache nicht in falscher Ernährung. Wir hatten Nahrung vollauf, und kräftige obendrein. An frischem Fleisch litten wir in Tibet nie Mangel, besonders seitdem wir bewohnte Gegenden erreicht hatten, wo wir von den Einwohnern stets Schafe und Fett erhielten. Daß die Jagd auf Yake, Kulane und Antilopen immer guten Ertrag gab, habe ich bereits erwähnt. Dazu hatten wir jetzt auch angenehme Abwechslung durch süße und saure Milch, Butter und Fische, und von dem aus Tscharchlik mitgenommenen Proviant von Reis, Mehl und Talkan war noch im Überfluß da; er war auf zehn Monate berechnet, und wir waren erst 5½ unterwegs. Der Vorrat mußte bis Ladak reichen; daß er nicht 10 Monate reichen konnte, beruhte darauf, daß wir die Kamele, wenn sie anfingen hinzuschwinden, mit Brot und Reis zu retten suchten, was auch den Vorteil hatte, daß die Lasten kleiner wurden und die Karawane sich leichter bewegen konnte. Bevor wir durch die Yake Entsatz erhielten, war es sogar notwendig gewesen, möglichst viel vom Proviant zu verzehren; denn wir hätten ihn sonst, wenn uns ein Tier nach dem andern starb, schließlich wegwerfen müssen.
Diese Krankheit rührt von der Luftverdünnung her. Die Atmosphäre hat hier nur die halbe Dichte wie am Meer, und das Blut saugt nicht die genügende Menge Sauerstoff ein, um das Leben aufrechtzuerhalten. Wir leben unter abnormen Verhältnissen. Unser Körper und seine Atmungs- und Kreislauforgane sind nicht für sie gebaut. In den Funktionen dieser Organe treten Störungen ein, und der, welcher schon an und für sich nicht gesund und kräftig ist, hat natürlich noch größere Aussicht zugrunde zu gehen. Das Herz arbeitet hier unter Hochdruck, und wenn seine Muskeln und Gewebe nicht hinreichend stark sind, vermag es nicht, das Blut in die peripherischen Teile zu treiben. Ein hervorragender[S. 318] schwedischer Arzt hat mir erklärt, daß dies die Ursache ist, weshalb die Füße und Beine bei meinen Leuten buchstäblich hinschwanden, und er war der Ansicht, daß die Kranken sich vielleicht hätten retten lassen, wenn es möglich gewesen wäre, sie beständig in horizontaler Lage, die Füße sogar etwas höher als den Kopf, zu halten. Auf einer Karawanenreise ist es natürlich sehr schwer, die Kranken genügend zu pflegen; man müßte vor allem an einem Orte bleiben, bis sie völlig wiederhergestellt wären. Doch in einem Lande wie Tibet ist dies sehr oft unmöglich, wenn nicht die ganze Karawane in Gefahr geraten soll. Es bleibt einem keine andere Wahl, als die Kranken mitzuschleppen, und es ist klar, daß eine solche Anstrengung und Unruhe für ihre absterbenden Kräfte zu groß ist.
Die Yake waren schon früh aufgebrochen, von ihren zu Fuß gehenden, pfeifenden Treibern und einem Kosaken eskortiert. Darauf folgten, von einigen Muselmännern geführt, die kranken Kamele und Pferde, alle ohne irgendeine Last. Nachdem die Beerdigung vorüber war, verließen die übrigen das düstere Lager und nahmen, wie gewöhnlich, meine Instrumentkisten auf einigen noch tüchtigen Kamelen mit. Besonders weit war es nicht mehr bis Ladak, gegen 800 Kilometer, aber bei den Tagemärschen, die wir machten, erschien die Entfernung endlos. Insofern war allerdings das langsame Tempo vorteilhaft, als ich Zeit hatte, das durchreiste Land gründlicher zu erforschen, mehrere astronomische Punkte festzustellen und mit dem Kochthermometer öfter die Höhe zu bestimmen.
Ich brach mit Schagdur und Sirkin nach dem Abhange des im Westen des Lagers liegenden Berge auf. Die Höhe der alten Uferlinien über dem jetzigen See sollte mit dem Nivellierspiegel gemessen werden. Die Höhe des Spiegels über dem Boden betrug 1,5 Meter, und die Entfernungen zwischen den gemessenen Punkten verkürzten sich beinahe beständig, so daß die Linie, auf deren Einzelheiten ich jetzt nicht eingehen kann, eine Parabel bildete.
Während des heutigen Tagemarsches sowohl wie später bei mehreren andern Gelegenheiten konnte ich feststellen, daß die nach Westen abfallenden Bergseiten stets energischer entwickelte Uferlinien haben als die nach Osten abfallenden, auf denen die Linien sehr oft sogar ganz fehlen. Auf den Nord- und Südabhängen sind sie einigermaßen deutlich. Da dies die Regel ist, fragt man sich: was war die Ursache? Natürlich dasselbe, was noch heute die Ursache ist, der Westpassat. Dieser treibt die Wogen nach den Ostufern, wo der Wellenschlag eine sehr kräftige Brandung erzeugt, während die Westufer vor dem Winde geschützt liegen.
Das Resultat der Nivellierung ergab, daß die höchste Uferlinie nicht weniger als 133 Meter über dem jetzigen Seespiegel lag, dieser also um diesen ungeheuren Betrag gesunken war. Sein Areal hat sich dementsprechend[S. 319] verkleinert, und wir ritten mehrere Tagereisen weit auf einstigem Seeboden.
Über einen kleinen, weichen Paß gelangten wir an noch einen Salzsee, der genau dieselben Eigenschaften wie der Lakkor-tso, ebenso grünes Wasser und ebenso weiße Ufer hat, aber bedeutend kleiner ist. Sein ganzer westlicher Teil ist trocken gelegt, und dort glänzen außerordentlich umfangreiche Salzablagerungen weiß wie Schnee. Wir gingen am Ufer entlang, mußten aber bald wieder über einen Paß.
Unter dem Passe rastete Hamra Kul mit zwei verendeten Pferden; mit dem einen kam er abends noch ins Lager, aber das zweite, einen Apfelschimmel aus Korla, ließ ich sofort töten, denn es konnte nicht mehr auf den Beinen stehen. Es hatte einen seltsamen Blick, als es seinen langwierigen, harten Dienst beendete. Es schloß nach dem tiefen Stiche in den Hals die Augen und lag ganz still. Als aber der Blutstrahl versiegte und die Mattigkeit und Ruhe des Todes folgte, öffnete es wieder die Augen, wie um zum letzten Male von diesem elenden Leben und seinen mageren Weiden Abschied zu nehmen. Dabei blickte das linke Auge gerade in die Sonne, die sich darin widerspiegelte, so daß es wie der klarste Edelstein glänzte. Es hatte den Anschein, als existierten wir, seine Henker, nicht mehr für das sterbende Tier, sondern nur noch die Sonne. Man fühlt in solchen Augenblicken eine drückende Beklemmung, und ich hatte unsägliches Mitleid mit diesen geduldigen, wehrlosen Tieren, die ich nur mitgeschleppt hatte, um meine unbezwingliche Sehnsucht, das Unbekannte zu erforschen, zu befriedigen. Man stellt maßlose Anforderungen an diese armen Tiere. Und was gibt man ihnen dafür? Nichts; nicht einmal das, was sie als treue Diener des Menschen entschieden mit Recht beanspruchen können: genügende Kost, d. h. Futter, Weide und Wasser, gut und reichlich bemessen. Man lockt sie gleichsam mit falschen Vorspiegelungen: „Eilt fort von diesen unerträglichen, blutdürstigen Bremsen und Mücken, von der Hitze und den Sandstürmen in der Wüste, kommt mit nach den hohen, frischen Bergen, nach ihren Gletscherflüssen, frischen Quellen und saftigen Weiden!“ Und sie kommen, aber was finden sie? Eine Einöde ohne Gras, eine Luft, die für ihre Lungen nicht ausreicht, und ein Land, für dessen Natur nur Yake, Kulane und Antilopen geschaffen sind. Eine Reise durch Tibet ist eine Kette von Leiden für Menschen und Tiere. Jeden Tag umgeben uns Leiden und Jammer, und wir können uns nicht froh fühlen. Man möchte weinen, wenn man all dieses Elend sieht, aber man stumpft auch dagegen ab. Wie gern würde man, wenn man es nur könnte, diesen unglücklichen, unschuldigen, unterdrückten Sklaven die Freiheit wiedergeben, sie nach ewig grünenden Weideplätzen und sprudelnden Quellen führen und[S. 320] sie das Leben genießen lassen, das für sie jetzt nur — eine mörderische Plage ist und klaffende Wunden hinterläßt, Wunden, die nicht geheilt werden können. Nach all der Sterblichkeit in der Karawane, deren Zeuge ich gewesen war, hoffte ich jetzt, daß wenigstens einige unserer Tiere Ladak erreichen würden, damit ich sie dort mit Fürsorge überhäufen, die Pferde wiehern hören und die Augen der Kamele vor Freude glänzen sehen könnte. Von den 45 Pferden und Mauleseln waren jetzt nur noch 11 übrig!
Die Abende werden kalt. Kutschuk, der im Küchenzelt residiert, nimmt an Popularität zu, wenn er ein gewaltiges Argolfeuer unterhält, denn jeder holt sich bei ihm Kohlen für sein Zelt. Hoch stand der glänzende Mond am Himmel, schwarz und düster lagen die Berge im Schatten, kreideweiß breitete sich der verschwimmende See in der Nacht aus; ein Fremdling, der um diese Stunde an das Seeufer kommen würde, würde darauf schwören können, daß die Salzfelder Eis und Schnee seien.
22. Oktober. Es ist vorteilhaft, kurze Tagereisen zu machen, aber so kurz wie heute brauchten sie doch nicht zu sein! Wir hatten kaum 5 Kilometer zurückgelegt, als die Führer an einer Stelle mit gutem Grase Halt machten und uns rieten, ja hierzubleiben, da wir während der nächsten drei Tagemärsche überhaupt keine Weide finden würden. Ferner würden im Laufe des Tages oder der Nacht die von ihnen ausgeschickten Reiter mit einer neuen Eskorte von Yaken und Schafen ankommen. Alle diese Gründe waren so stichhaltig, daß wir blieben; ich ließ ihnen aber sagen, sie sollten sich nicht einbilden, daß bei der Abrechnung über die Yakmiete der heutige Marsch für eine ganze Tagereise gerechnet werde. Sie waren so liebenswürdig zu antworten, daß sie dies meinem Gutdünken überließen.
Der Weg führte über die weißen Felder mit ihren 3 Meter hohen Pyramiden und Tischen. Selbst sehr gute Augen konnten hier die Reflexe ohne dunkle Brille nicht ertragen. Das Gebirge im Südwesten heißt Marmi-gotsong, hinter ihm liegt ein Kloster, Marmi-gombo. Von Zeit zu Zeit hörten wir langgezogene Trompetenstöße von dort.
Ein voller Sturm herrschte an diesem und am nächsten Tage. Mein Pferd arbeitet und müht sich ab, um diese dünne Luft zu durchdringen, die dennoch so ungeheuren Widerstand leistet. In der Jurte stellte ich stets meine Kisten an die Windseite, um die Zugluft abzuschwächen, aber ganze Haufen von Staub und Abfällen wehten durch die Zeltöffnung herein. Unsere Straße führte nach Nordwesten, aber noch befanden wir uns südlich von Littledales Route. Auch im Lager Nr. 112, am Flusse Schaggué-tschu, hörten wir von Süden her Posaunenstöße, den Tönen eines Nebelhorns vergleichbar. Ich hätte zu gern die Tempel besucht, aber die Tibeter[S. 321] wollten nichts davon hören, und die Pässe im Süden waren für unsere Tiere auch zu schwierig.


Am 24. hatten wir auf beiden Seiten wilde, felsige Bergketten mit großartigen, phantastischen Perspektiven. Gleich hinter einem flachen Passe (4820 Meter) lagerten wir an einem kleinen Tümpel namens Oman-tso. Wir sind hier in der Provinz Sagget-sang, die von dem Senkorstamme bewohnt wird, ein Name, den wir auch bei Littledale finden. Von den drei heute zurückgebliebenen Kamelen erreichte eines noch spät das Lager, das zweite blieb auf dem Passe liegen, und das dritte starb.
Die Kälte ging bis auf −18,8 Grad herunter. Schon beim Aufbruch (am 25.) mußte ein Pferd totgestochen werden. Sechs Kamele sind kränklich und ziehen mit der Yakkarawane. Almas, dem es noch immer schlecht ging, ritt auf dem ersten von ihnen. Wir holten sie bald ein und sahen, wie eines streikte und mit zwei Männern zurückgelassen wurde; sie versuchten, es zum Weitergehen zu bewegen. Als es sich aber in der Lage ausstreckte, die die Kamele beim Sterben einnehmen, wurde es mit dem Messer getötet. Noch eines blieb mit einem Wärter zurück, und dann wieder eines. Später wurde das Dromedar auf einem Platze, wo Gras wuchs, zurückgelassen, damit die Nachzügler es mitnehmen könnten. Almas führte schließlich nur noch ein Kamel, die Mutter des kleinen Füllens, das in Tscharchlik geboren war. Die Liebe zu ihrem Jungen scheint ihre Kräfte aufrechtzuhalten. Das Junge gehört zu den Allergesundesten, weil es mit Brot gefüttert wird; es saugt jetzt nur noch selten an dem versiegenden Euter der Mutter. Wir haben jetzt nur noch 18 Kamele, 21 liegen tot auf unserer Straße. Alle vier Kosaken reiten auf Mauleseln, auf Pferden nur ich, Turdu Bai, Mollah Schah, Li Loje und Turdu Ahun, Hamra Kuls sechzehnjähriger Sohn, welcher der Diener der Muhammedaner ist. Die übrigen Leute reiten gelegentlich auf Kamelen, sonst gehen sie zu Fuß.
Diese so geschwächte Karawane zog zwischen den gigantischen Felsen weiter, die versteinerten, verzauberten Ritterburgen glichen. Alle Ketten biegen nach Nordwesten ab, ganz wie der Himalaja und der Kwen-lun auf denselben Meridianen. Auch heute lagerten wir im Lager Nr. 104 unter einem Passe an einem zugefrorenen kleinen See, dem Bondschin-tso (Abb. 290, 291, 292). Der Anführer unserer jetzigen Trabanten, Dawo Tsering, ist ein sehr netter, lustiger alter Herr, der nicht begreifen konnte, was er für Nutzen davon haben würde, wenn er uns hinters Licht führte.
Der Tod setzt seine Verheerungen in der Karawane fort. Ein Kamel wurde am Morgen geopfert, drei andere blieben während des Marsches zurück. Turdu Bai blieb bis 10 Uhr abends bei ihnen und sollte sich[S. 322] am nächsten Morgen nach ihnen umsehen; konnten sie dann nicht mitkommen, so hatte er Befehl, sie zu töten; den einen Trost haben wir wenigstens, daß wir ihnen ihr Grab in einer großartigen Natur bereiten.
Am 26. ritten also Turdu Bai und Sirkin zu den Kamelen zurück. Als wir die beiden Reiter im nächsten Lager ankommen sahen, wußten wir sofort, wie es stand. Das Dromedar hatte noch an der Stelle gelegen, wo es abends zurückgelassen worden war; es hatte auch nicht den geringsten Versuch gemacht, sich zu erheben. Es hatte geweint, und lange Eiszapfen hingen ihm unter den Augen. Sowohl dieses wie die beiden anderen Kamele mußten getötet werden.
27. Oktober. Das Wetter ist immerfort klar, und der Westwind dauert an, wenn auch bisweilen mit etwas abgeschwächter Kraft. Das Terrain war gut und eben; alle Kamele konnten den Marsch machen, ein paar Pferde aber nur mit Mühe und Not. Einige von den Kamelen haben wunde Füße und tragen Strümpfe von Kulanleder. Das Land öffnet sich wieder, dann und wann stoßen wir auf Nomaden. Dawo Tsering reitet neben mir und erteilt mir mit größter Offenheit Auskunft. Manchmal sagt er mit geradezu schulmeisterlicher Würde: „Schreibt jetzt auf, daß der Berg da so heißt.“ Er hat den Lama heimlich gefragt, was ich von ihm halte.
Nachdem wir auf einer kürzeren Strecke mit Littledales Route in Berührung gewesen waren, verließen wir sie jetzt wieder. Der englische Reisende ging von hier auf einem südlicheren Wege nach Rudok und dann längs des Südufers des Panggong-tso nach Leh. Im Nordwesten zeigt sich der See Daddap-tso. Das Lager Nr. 106 wurde am Westufer des zugefrorenen Süßwassersees Oman-tso aufgeschlagen.
Am 28. Oktober ging es den ganzen Tag in einem Längentale bergauf und bergab, bis wir schließlich einen Paß erreichten, von dem die Aussicht nach Westen hin prachtvoll war; eine ganz neue Welt breitete sich in dieser Richtung aus, alles Alte lag wie ein zugeschlagenes Buch hinter uns.
Die Landschaft wird besonders von dem runden See Perutse-tso oder Jim-tso beherrscht. Die Karawane ist so weit vor mir, daß sie nicht mehr zu sehen ist; ich bin, durch meine Arbeit aufgehalten, wie gewöhnlich der letzte. Wir reiten durch einen Gürtel von Balgunsträuchern auf meterhohen Kegeln — hier würden wir in der Kälte wenigstens ordentliche Feuer haben können.
Unser Lager am Perutse-tso war das beste, das wir seit dem Lager am Tscharchlik-su, beim Antritt unserer Reise durch Tibet, gehabt hatten. Das Gras war hoch, weich und üppig, obwohl gefroren, und vorzügliches[S. 323] Brennholz und Wasser gab es in Menge. Große lodernde Lagerfeuer machten den Platz hell, gemütlich und warm; es war auch nötig, denn in dieser Nacht sank die Temperatur auf −20,1 Grad. Alle Kamele, außer der jungen Mutter, erreichten das Lager. Diese wurde am Ufer zurückgelassen, nachdem ich eine ganze Weile versucht hatte, sie wieder auf die Beine zu bringen, und sie das Strohpolster ihres Packsattels hatte fressen lassen. Schon am selben Abend, als sie abgeholt werden sollte, war sie tot und steifgefroren. Jetzt hatten wir nur noch 14 Kamele! Im Lager starb ein Pferd; es hatte beinahe den Anschein, als habe sein leerer Magen das gute Gras nicht vertragen können. Dawo Tsering nahm hier Abschied und erklärte, es sei ihm nicht erlaubt, Geschenke anzunehmen.
Wir waren jetzt neun Tage marschiert, ohne einen Tag zu rasten — die Weide war zu schlecht dazu gewesen; hier aber blieben wir dafür in Wind und Kälte vier Tage liegen, während derer sich die Tiere schließlich erholten. Meine Zeit wurde von verschiedenen Nacharbeiten in Anspruch genommen. Unsere neuen Begleiter verkauften uns für 4 Liang drei kleine Beutel Gerste aus Ladak, natürlich viel zu teuer; aber unsere Tiere bedurften des Korns, und in einer Stunde war es verzehrt. Der neue Anführer erzählte uns, daß er Tadschinurmongole und einige Tagereisen südlich vom Kukku-nor geboren, aber von seinen Eltern auf der Wallfahrt nach Lhasa an ein kinderloses tangutisches Ehepaar verkauft worden sei. Wieviel sie für ihn bekommen hatten, wußte er nicht, aber der Lama sagte uns, daß 20 Liang der stehende Preis und ein derartiger Handel nichts Ungewöhnliches sei. Es kommt auch vor, daß die Tanguten Kinder an die Mongolen verkaufen. Unser Begleiter war, als er verkauft wurde, fünf Jahr alt gewesen und natürlich ein echter Tibeter geworden; er erinnerte sich auch nicht eines einzigen mongolischen Wortes mehr. Die Tanguten gehören zu demselben Stamme wie die Tibeter und haben dieselbe Sprache wie diese.
Nach der Rast waren wir imstande, auf gutem, ebenem Boden 25,8 Kilometer zurückzulegen. Dennoch waren wir noch nicht weit gekommen, als ein Pferd stürzte und getötet werden mußte.
Es herrscht eine schneidende Kälte, und im Sattel, wo man dem längs des Bodens hinstreichenden Winde ausgesetzt ist, erstarrt man beinahe. Alle Muselmänner reiten jetzt auf Kamelen, alle Lasten, außer den Instrumentkisten, werden von Yaken getragen. Ich bin der einzige, der ein Pferd reitet, aber dieses wird auch besonders mit Brot und Reis gefüttert. Die übrigen Pferde werden ohne Sattel hinter der Karawane hergeführt.
Der Fluß Ombo-sangpo war ganz zugefroren, aber das Eis hielt nicht; nachdem einige von den Pferden und Yaken der Tibeter auf der[S. 324] Eisdecke ausgeglitten und gestolpert waren, brachen die übrigen ein, und es mußte ein Kanal für die Kamele ausgehauen werden.
Die Nacht im Lager Nr. 108 war sternenklar und windstill (−15,4 Grad). Sogar Sterne fünfter Größe waren am Horizont noch deutlich erkennbar, während diejenigen erster Größe wie Fackeln glänzten. Manchmal hört man die vermutlich hungernden und frierenden Wölfe heulen.
Am Morgen des 3. November stellte es sich heraus, daß alle Kamele bis auf zwei nach den üppigen Weiden des Perutse-tso zurückgekehrt waren; ihr Einfangen verursachte großen Zeitverlust. Sodann zogen wir nach Westen über sehr deutliche, schöne Uferterrassen, welche die frühere Ausdehnung des Sees Luma-ring-tso zeigen. Über umfangreiche Salzfelder erreichen wir endlich den See, einen unbedeutenden kleinen Salztümpel, dessen Nordufer wir folgen. Hinter einer schmalen Landenge taucht noch ein See auf, der Tsolla-ring-tso (Abb. 293), an dessen Ufer wir lagern. Im allgemeinen sind die Ufer sumpfig (Abb. 294) und selbst bei der jetzt herrschenden Kälte tückisch. Der Luma-ring-tso ist auf Nain Singhs Karte ganz verkehrt gezeichnet; letzterer gibt ihm eine Länge von 55 Kilometer statt der tatsächlichen 5½, aber er hat den See nicht gesehen, denn sein Weg liegt weit nördlich davon, und es ist nicht wahrscheinlich, daß der Luma-ring-tso seit 1873, in welchem Jahr der berühmte Pundit seine denkwürdige, verdienstvolle Reise machte, so bedeutend eingeschrumpft ist. Auf dem gefährlichen Sumpfufer wurden die Kamele nachts angebunden. Ein paar Pferde sanken nachts ein, und als wir sie am Morgen mit knapper Not wieder herausgezogen hatten, sahen sie wie Lehmstatuen aus. Trotz der ihnen neulich vergönnten Ruhetage stand es mit vielen von den letzten Pferden schlecht. Der Schimmel, der den Marsch gegen Lhasa mitgemacht hatte und der am 19. August schon aufgegeben gewesen war, aber trotzdem bis jetzt ausgehalten hatte, stürzte heute. Ich wollte ihn gerade töten lassen, als der tibetische Häuptling herbeieilte und ihn sich, so wie er war, ausbat, wozu ich gern meine Zustimmung gab.

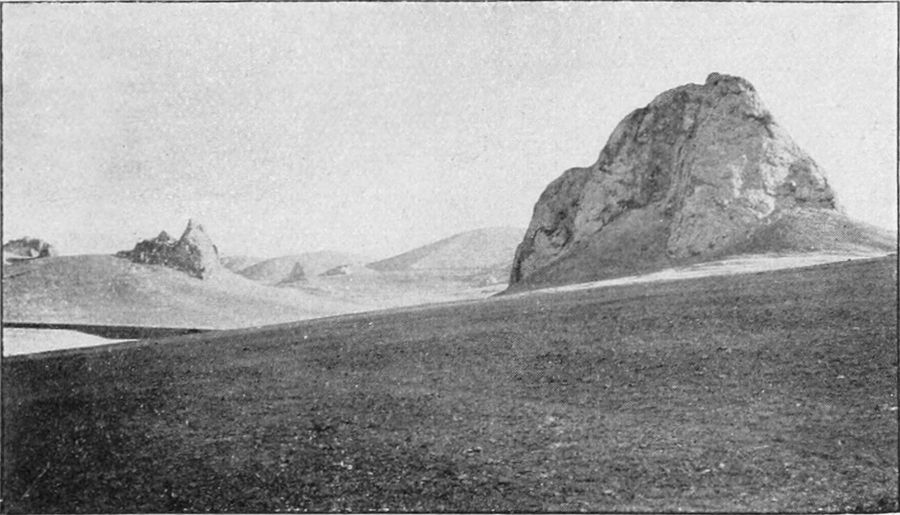

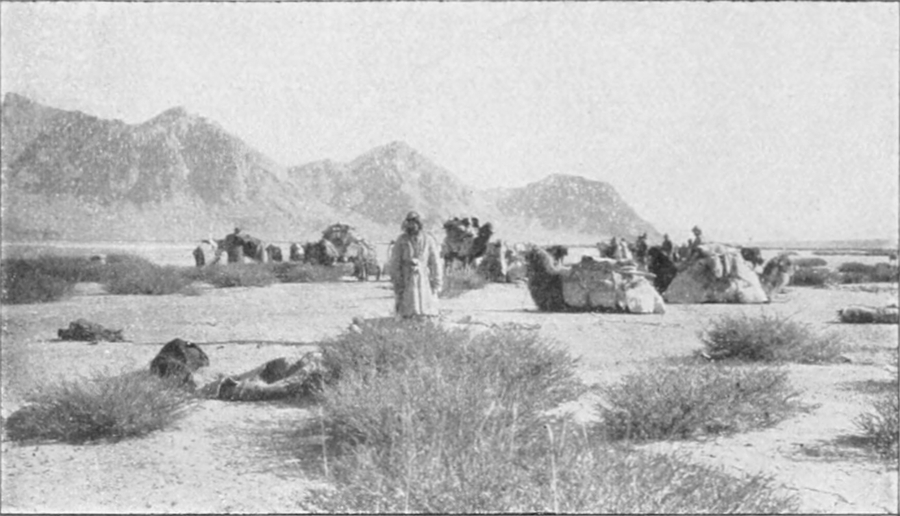


Wir wußten, daß wir heute die Grenze von Rudok erreichen würden. Am Westende des Sees standen bereits 7 Zelte, und eine Menge Leute war dort zu sehen. Ein dreister alter Mann kündigte uns an, daß wir hierzubleiben hätten. In einem benachbarten Tale sei das Gras gut, und dort weideten auch ihre eigenen Pferde und Yake. Wir lagerten in der Nähe der Tibeter, und der Lama begab sich sofort zu ihnen, um Erkundigungen einzuziehen. Als er zurückkam, war er ganz aufgeregt; der Gouverneur von Rudok war ein rechter Grobian gewesen und hatte erklärt, daß er uns ohne Paß vom Dalai-Lama nimmermehr durch sein Gebiet ziehen lassen werde. Ich schickte zu diesem Bombo, der beim Dewaschung[S. 325] besonders gut angeschrieben sein soll und Oberaufseher des Tschokk-dschalung war, wo er im Sommer residierte; im Winter wohnte er in der Stadt Rudok. Tschokk-dschalung ist ein Goldfeld, das einige Tagereisen südwestlich der Gegend liegt, in der wir uns befanden. Im Winter sollen sich dort nur einige zwanzig Menschen aufhalten, im Sommer aber 300 und darüber, die von allen Seiten, sogar von Lhasa, dorthinkommen, um Gold zu suchen. Tschokk-dschalung gilt für den höchstgelegenen ständig bewohnten Ort der Erde.
Mit großem Gefolge und arroganter Sicherheit in seinem Auftreten kam er in seinem schönsten Paradeanzug, sobald er meine Aufforderung erhalten hatte; ich bat ihn, auf einer Filzmatte vor meinem Zelte Platz zu nehmen. Ich selbst blieb drinnen neben meinem Kohlenbecken sitzen. Der Bombo schien zuerst unschlüssig, wie er sich zu der zweideutigen Artigkeit verhalten sollte, setzte sich aber schließlich doch und forderte mir den Paß vom Dalai-Lama ab. Ich antwortete ihm, daß wir diesen Herrn nie gesehen hätten und folglich auch keinen Paß von ihm haben könnten.
„Ich habe nichts von euch gehört“, entgegnete er, „weiß nicht, wer ihr seid, habe kein Schreiben aus Lhasa erhalten, bin nie beauftragt worden, euch mit Yaken zu versorgen, aber ich weiß, daß es Europäern ein für allemal verboten ist, durch Rudok zu reisen.“
„Wenn ihr ein hoher Beamter seid, müßt ihr wissen, daß ihr verpflichtet seid, uns für die Reise nach Ladak zur Verfügung zu stehen.“
„Verdächtigen Personen gegenüber, die keinen Paß haben, bin ich zu gar nichts verpflichtet; doch wenn ihr wollt, werde ich nach Lhasa schreiben, und ihr müßt hier 2½ Monate warten, bis die Antwort da ist.“
„Das paßt uns außerordentlich gut“, erwiderte ich, „unsere Tiere sind erschöpft und bedürfen der Ruhe. Schreibt nur nach Lhasa, wir haben Zeit zu warten.“
„Gut, ihr begreift, daß ich den Kopf verliere, wenn ich euch durch meine Provinz ziehen lasse.“
Er war außerordentlich bestimmt, ruhig und würdevoll in seinem Auftreten, obgleich etwas unverschämt, wenn man ihn mit unseren Freunden in der Nähe von Lhasa vergleicht. Die Kosaken waren so außer sich, daß sie vor Wut schäumten, — fast alle sehnten sich jetzt nach Hause oder wenigstens von diesen kalten winterlichen Bergen fort. Ich beruhigte jedoch ihre aufgeregten Gemüter, denn ich sah nur zu wohl ein, daß ich nicht das geringste Recht hatte, Rudok den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Es waren schon wieder über hundert gut bewaffnete Krieger versammelt. Der Zustand unserer Karawane erlaubte auch keine Umgehung der Provinz auf einem nördlichen Wege, und mir war dies auch ganz lieb, da ich nicht[S. 326] Nain Singhs, Bowers und Deasys Routen oder die noch nördlicher liegenden Wege Malcolms und Wellbys berühren wollte. Ebensowenig hatte ich Lust, den größeren Teil des Gepäckes, der Zelte, des Proviants und das Boot zu verbrennen, wie Captain Deasy es einmal in einer schwierigen Lage tun mußte.
Dagegen sprach mich die Wartezeit von zweieinhalb Monaten sehr an. Ich war müde und matt von Arbeit und Weststürmen und bedurfte der Ruhe. Ich hielt mit den Kosaken Kriegsrat und entwarf einen ganzen Überwinterungsplan. Wir wollten nach ein paar Tagen nach den üppigeren Weiden des Perutse-tso zurückkehren und dort ein befestigtes Lager anlegen. Mir würde es in der interessanten Gegend nicht an Beschäftigung fehlen, und meine Leute sollten sich im Anfang die Zeit damit vertreiben, daß sie aus Erdschollen eine hohe Mauer rings um das Zeltlager und das Gepäck errichteten. Von demselben Material wollten wir einen Aussichtsturm bauen, und die Festung sollte mit einem Graben umgeben werden. Nachher wollten wir ruhen, jagen, Ausflüge machen, unsere Tiere pflegen, um im Frühling direkt nach Süden zu ziehen. Ich segnete den Bombo, der mich zu einer neuen Kraftanstrengung in Tibet beinahe zwang, obwohl ich im Grunde von diesem schwer zugänglichen Lande mehr als genug hatte.
Am folgenden Morgen kündigte ich dem Gouverneur an, daß wir wieder ostwärts ziehen würden; er hatte nichts dagegen einzuwenden. Doch der Tadschinurmann erklärte, er habe Befehl, uns bis an die Grenze von Rudok zu bringen, aber nicht, uns wieder zurückzuführen. Die Sache würde sich jedoch leicht arrangieren lassen; waren wir erst am Perutse-tso angelangt, so konnten wir sowohl die Yake wie die Pferde mit Beschlag belegen und die Männer gefangenhalten. Mit frischen Pferden würden wir leicht und bequem operieren können.
Der Bombo kam jedoch auf andere Gedanken und teilte uns mit, daß er uns Yake und Proviant besorgen werde, wenn wir versprächen, nicht nach der Stadt Rudok zu gehen, was zu tun gar nicht in meiner Absicht lag, da Littledale diesen südlicheren Weg gegangen war.
So wurde der ganze Festungsplan hinfällig, und wir durften uns dem Ende unserer Mühsale wieder nähern.
[S. 327]
Nachdem alles Entbehrliche ausgesondert worden und den Tibetern geschenkt war, zogen wir am 6. November nördlich um einen Paß (4858 Meter) herum, auf dessen anderer Seite uns Quellen und Weiden zum Lagern einluden. Das kleine Kamelfüllen, unser aller Liebling, schwand seit dem Tode der Mutter hin, kam aber doch bis ins Lager mit, wo es sich an Brot und Teig sattfressen und Milch trinken durfte. Es wurde nachts gut eingewickelt neben das Feuer gelegt und marschierte den ganzen Tag gut.
Am 7. war das Wetter herrlich, und der ewige Wind war in seiner Höhle im fernen Westen geblieben. Statt seiner bereiteten uns die Tibeter Verdruß und schalten den Lama einen Heidenhund, der mit „solchen Russen“ umherstreife. Der Lama war so erbittert, daß er sie rechts und links mit der Peitsche traktierte, und ich ließ ihnen sagen, daß wir sie, wenn sie sich noch einmal mausig machten, auf die Kamele binden würden, bis sie seekrank und höflich würden (Abb. 295).
Den ganzen Tag sahen wir keinen Tropfen Wasser, keine Menschen, höchstens Spuren von alten Lagerplätzen. Endlich erreichten wir jedoch die Quelle Tsebu, wo wir Halt machten. Tiefes Schweigen herrschte in dieser Nacht, und die Luft war so ruhig, daß man einen schwach siedenden Laut von der Nachtkälte, die sich in der Erde festbohrt, zu vernehmen glaubte. Nur einige Wölfe störten mit ihrem langgezogenen, melancholischen Klagegeheul den Frieden. Die Tritte der Nachtwache hallten auf dem steinharten Erdboden wieder.
Während der nächsten beiden Tage ritten wir an dem See vorbei, an dessen Ufern sich überall Gänse und Enten aufhielten, über einen kleineren Paß nach dem tief in das Geröllbett eingeschnittenen Flusse Rawur-sangpo, der von Quellen gespeist wird und in dem großen Längentale, das wir jetzt vor uns hatten, verschwindet. Unser Anführer erzählte, daß beim Aru-tso, der zirka vier Tagereisen nach Norden liegt und von Bowers[S. 328] Reise her bekannt ist, Räuber aus Amdo, Nakktschu und Nakktsong umherzustreifen pflegten. Eine Bande von fünf Personen sei im vorigen Jahre am Rawur-sangpo ergriffen und auf Befehl des Gouverneurs von Rudok getötet worden. Andere Bewohner gebe es in jener Richtung nicht. Der Berichterstatter war ein lustiger alter Herr, der singend neben mir zu reiten pflegte und oft zum großen Vergnügen der Unsrigen das Gurgeln der Kamele nachahmte.
10. November. Das Thermometer zeigt −26,5 Grad. Man wacht bisweilen auf, deckt sich fester zu und rollt sich wieder wie ein Knäuel zusammen. Ich pflege nachts einen eisernen Becher mit Tee neben mir stehen zu haben, kann ihn aber jetzt nicht benutzen, denn der Inhalt ist bis auf den Grund gefroren. Das Tintenfaß muß jedesmal, wenn es gebraucht werden soll, erst am Feuer aufgetaut werden.
32,2 Kilometer! Das war eine Kraftprobe, die wir sehr lange nicht fertig gebracht haben! Schon nach 10 Kilometern wollten die Tibeter rasten, weil wir gerade neue Leute und neue Yake trafen; man kann es ihnen nicht verdenken, daß sie möglichst schnell nach ihren warmen Zelten zurückkehren wollten — sie trugen ja keine Hosen! Doch wir ritten weiter, indem wir Tscherdon, drei Muselmänner und alle Tibeter bis auf vier zur Bedeckung der Yakkarawane zurückließen. Wir durchschritten ein ebenes Tal; der Tag verging, es dämmerte und wurde dunkel; Wasser sahen wir nicht. Schließlich begegnete uns Schagdur, der zum Rekognoszieren vorausgeritten war, mit einem kleinen Sacke voller Eisstücke. Er hatte einen zugefrorenen Bach gefunden, nach welchem wir uns jetzt begaben. Am 12. ritten wir an einem kleinen, mit dickem Eise bedeckten See vorbei, an dessen westlichem Ende die Tibeter ihre Zelte aufschlugen, weil nach Westen hin zwei Tagereisen weit kein Wasser zu finden sei. Wir füllten daher vier Säcke mit klarem Eise und zogen dann trotz ihrer lebhaften Proteste weiter. An einer Bergreihe einige Kilometer nördlich vom See zeigten sich einige Pferde und ihre Besitzer, die sich in einer Schlucht versteckten, als wir am Ufer vorbeizogen. Die Tibeter behaupteten, es seien Räuber, und rieten uns, auf sie zu schießen. Eine Weile darauf sahen wir zwei von ihnen an einem Feuer sitzen; es waren friedfertige, gutmütige Yakjäger, die eine Orongoantilope geschossen hatten. Eine Stunde, nachdem wir das Lager aufgeschlagen hatten, kam die Yakkarawane mit ihrem pfeifenden und singenden Gefolge nebst Schagdur, der in lebhafter, scherzender Unterhaltung mit den Tibetern war. In überraschend kurzer Zeit hatte dieser tüchtige Kosak ziemlich fließend tibetisch sprechen gelernt. Als wir am Tage darauf am Ufer eines laut rauschenden Flusses lagerten, hatten wir richtig zwei Tage lang kein Wasser gesehen. Oft genug hätten wir[S. 329] ohne die Anweisungen der Tibeter hinsichtlich dieses unentbehrlichen Stoffes in Verlegenheit geraten können.
Während der Nacht knackte es angenehm im Eisrande, und der rieselnde Ton des Wassers war für unsere Ohren ein nachgerade ungewohntes Geräusch. Welch ein Unterschied gegen die Gegend um Lhasa während der Regenzeit; dort waren wir eigentlich immerfort durch Sümpfe geritten, hier mußte man erst lange nach Wasser suchen.
Nachdem wir am 14. den Raga-sangpo hinaufgeritten waren und ihn schließlich linker Hand hatten liegen lassen, wollten die Tibeter wie gewöhnlich nach einem kurzen Tagemarsch Halt machen; es würde ihnen den Kopf kosten, wenn sie weiter gingen, als ihnen befohlen sei, und hier sollten neue Yake anlangen. Ich ließ die Kosaken die Yakkarawane übernehmen und die Tiere mit uns nach dem heutigen Lagerplatze, der in einer Talmündung lag, treiben. Die Männer kamen ganz artig mit und schlugen ihre Zelte in unserer Nähe auf. In der Gegend lagerten Nomaden, und während der zwei Ruhetage, die wir uns hier gönnten, hatten wir Gelegenheit, unseren Proviant durch Schafe und Milch zu verstärken.
Am 17. ging es nach Nordwesten in dem Tale aufwärts; es verengte sich zu einem schmalen, malerischen Gange und führte schließlich auf einen Paß mit einem gefrorenen Tümpel (Abb. 296). Schon um 9 Uhr hatten wir im Lager Nr. 129 −18,6 Grad und nachts −24,4 Grad. Es war bitterkalt und unwirtlich in diesem öden Gebirge!
Das kleine Kameljunge erreichte das Lager Nr. 130 (5060 Meter) nicht mehr, es brach unterwegs zusammen und mußte getötet werden. Seit seine Mutter gestorben war, gedieh es nicht mehr; es fehlte uns allen. Zu den widerstandsfähigsten Tieren gehören die beiden Schafe. Wanka, der Leithammel, der uns seit mehr als zwei Jahren begleitet, und ein weißes Schaf aus Abdall. Niemand wäre imstande, sie zu schlachten; die Muselmänner, die sie als Reisegefährten betrachten, würden, glaube ich, lieber verhungern.
Bei dem Lager Jam-garawo wuchsen vortreffliche, dürre Jappkakpflanzen, die uns bei der Kälte sehr willkommen waren. In der Nacht ging die Temperatur auf −26,5 Grad herunter! Am meisten sind die Nachtwachen, welche die weidenden Tiere bewachen, zu bedauern; ihre Pelze genügen bei solcher Kälte nicht. Hier konnte man wenigstens die ganze Nacht ein Feuer im Freien unterhalten. Während des ganzen Tags weht ein mörderischer Wind, der durch Mark und Bein dringt, denn −4 Grad ist die größte Wärme. Man muß unbedingt dann und wann eine Strecke zu Fuß gehen, obgleich Herz und Lungen dieser Anstrengung nur gewachsen sind, wenn es bergab geht. Ein Pferd blieb im Lager zurück, die übrigen[S. 330] leisten jetzt nichts mehr und sind nur eine Last, aber man hofft immer noch, sie retten zu können.
Welch ein Gewirr von Bergen! Im Süden haben wir noch immer die mächtige Kette, die uns vom Nakktsong-tso an treu begleitet und uns die Aussicht auf das verbotene Land der heiligen Bücher versperrt hat. Ringsumher breitet sich eine Welt von großartigen Bergketten aus, große Schneefelder sind aber ziemlich selten, und vom Himmel fällt nicht eine einzige Flocke. Wir sehnen uns förmlich nach einem ehrlichen Schneefall; wir sind des ewigen Windes und des beständig klaren Himmels gründlich überdrüssig. Wir hatten bis Leh noch 400 Kilometer. Alle sehnten sich dorthin, besonders ich, denn ich hoffte, noch vor Weihnachten ein Telegramm nach Stockholm senden zu können.
In der Nacht auf den 21. November sank die Kälte auf −28,2 Grad. Wir marschierten 28,1 Kilometer nach einer Gegend, die reich an herrlichem Brennmaterial, aber wasserlos war. Daher mußte mit Yaken aus einiger Entfernung Eis geholt werden, das über dem Feuer geschmolzen wurde. In der Nacht heulten ein Dutzend Wölfe um unser Lager Nr. 133 (Abb. 297), und die Hunde stimmten mit ein; es war ein ohrenzerreißendes Konzert.
23. November. Wieder blieb ein Kamel liegen; nur 13 sind noch übrig, ein Drittel der Zahl, die wir aus Tscharchlik mitnahmen. Es war einer der Veteranen von Kaschgar und hatte mich durch die Tschertschenwüste und beide Male nach Altimisch-bulak begleitet. Unser Weg läuft zwischen Nain Sings und Bowers Routen. Bei Tsangar-schar öffnet sich das Tal, dem wir gefolgt sind; an mehreren Stellen erblicken wir Zelte und Herden, und eine neue Eskorte und neue Yake sollten uns von hier weitergeleiten. Der Anführer war ein alter braver Mann. Er versprach uns nach dem Panggong-tso und dann an dessen Nordufer entlangzuführen, und ich stellte ihm einen Revolver in Aussicht, wenn er möglichst wenig lüge.
„Ich bin ein viel zu alter Mann, um zu lügen“, sagte er.
Die folgenden Tage zogen wir an dem fischreichen Tsangar-schar-Flusse abwärts. Schagdur und Tschernoff zeichneten sich besonders beim Fischfang aus und überraschten mich alle Augenblicke mit ganzen Bündeln von großen, prachtvollen, steinhart gefrorenen Fischen. Das Tal ist anfänglich ziemlich offen (Abb. 298), verengt sich aber allmählich zwischen malerischen Felsen und mächtigen Geröllterrassen (Abb. 299, 301). Der Fluß ist meistens mit dickem Eise bedeckt. An einer Stelle erweitert er sich zu einem See, der das Tal füllt und nur auf der Nordseite einen Uferstreifen freiläßt, der für die Kamele gerade breit genug ist. Gleich[S. 331] unterhalb des Sees war der Fluß wieder eisfrei. Hier rasteten wir am 26. November in einer an prächtiger Strauchvegetation reichen Gegend; andere Weide als die dürren Zweige gab es nicht. Mein Zelt stand unmittelbar an dem rauschenden Strome; ich liebe es, dem klangvollen, munteren Rauschen des fließenden Wassers zu lauschen.
Ein schönes Bild bot sich uns am Abend gerade im Süden dar, wo der hoch und klar am Himmel stehende Mond den mächtigen Bergast beleuchtete, dessen Einzelheiten wir bei Tage infolge blendenden Sonnenscheins und intensiver Schatten nur undeutlich hatten unterscheiden können. Jetzt glänzten seine kleinen, unten spitz zulaufenden dreieckigen Schneefelder kreideweiß, und das kühne, imposante Relief der Felsen trat klar und scharf hervor.
Eines von Kamba Bombos Pferden war so ungeschickt, in den Fluß zu stürzen, und konnte nur mit Mühe wieder herausgezogen werden. Ich ließ es an einem großen Feuer trocknen und dann in Decken wickeln, aber ein paar Stunden darauf lag es tot am Feuer.
Am folgenden Morgen wurde mir gemeldet, Li Lojes Pferd sei über Nacht gestorben. Steinhart und angeschwollen lag es zwischen den Zelten. Wir hatten geglaubt, daß, wenn überhaupt eines der Pferde Leh erreichen würde, es dieses sei, obgleich sein Besitzer, wie er mir jetzt im Vertrauen mitteilte, es nicht bezahlt hatte. Nun ging es wieder weiter, immerfort flußabwärts. Unweit des nächsten Lagerplatzes stürzte Turdu Bais alter Rappe; eine gelbe Flüssigkeit strömte ihm aus den Nüstern, und nach einer Weile war er tot. Während des Marsches verschied auch das letzte unserer tibetischen Pferde, ohne daß es totgestochen zu werden brauchte. Vier Pferde auf einmal! Jetzt ist sowohl von allen unseren Tscharchlikpferden wie auch von denjenigen, die wir unterwegs geschenkt erhalten oder gekauft haben, nur ein einziges übrig, der große Schimmel, den ich noch reite.
Es ist eine recht ernste Sache, eine große Karawane in Tibet zusammenzuhalten; es ist nicht ganz so leicht, wie man glaubt, in diesem Lande zu reisen, und ein Vergnügen ist es auch nicht. Man erkauft die Tage und Meilen mit dem Leben von Menschen, Pferden und Kamelen, und es hat auch eine symbolische Bedeutung, daß der zurückgelegte Weg auf der Karte rot punktiert ist: er hat Blut gekostet. Wie viele Tränen und Blutströme hatte dieser karge Boden aufgesogen, und wie viele Seufzer und Jammerrufe waren von unserer Karawane ausgestoßen worden, ohne von diesen kalten, kahlen Felswänden ein Echo als Antwort zu erhalten. Ein rotes Kreuz an jedem Punkte, wo in unserer Karawane ein Leben erloschen war, würde zum Verfolgen unserer Wanderung durch Asien genügen.
[S. 332]
Ihr, die ihr mit eurer großen Weisheit und eurem unerprobten Mute — jenem Mute, der vor dem Kaminfeuer in einem zugfreien, warmen Zimmer glänzt — eine solche Reise und ihre Resultate beurteilt, ihr mögt es selbst einmal versuchen! Ihr braucht dazu gar nicht erst nach Tibet zu gehen; nein, geht nur im Winter bei eurem eigenen Gute einige Meilen auf ungebahnten Wegen, schlaft bei 30 Grad Kälte in einem erbärmlichen Zelte und hört dabei die Wölfe in der Wildnis um euch herum heulen. Das ist freilich noch nicht dasselbe wie Tibet und ein Leben, wie ich es zweieinhalb Jahre geführt habe, aber ihr werdet auch dadurch schon vorsichtiger in eurem Urteil werden. Ich gehe lieber zehnmal durch die Gobiwüste als einmal zur Winterszeit durch Tibet. Man kann sich keinen Begriff davon machen, was dies kostet; es ist eine wahre „via dolorosa“!
Im Vergleich mit diesen großen Schwierigkeiten sind die kleinen Ärgernisse, die in einer aus so verschiedenen Elementen zusammengesetzten Karawane nicht ausbleiben können, reine Bagatellen. Daß Muselmänner, Tibeter, Mongolen, Burjaten und Christen während einer so langen Zeit stets in schönster Eintracht leben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hier geschah es zum Beispiel, daß Li Loje und Ördek in einer Nacht, als sie die Wache hatten, in das Zelt der Tibeter gegangen waren, um dort Opium zu rauchen. Am Morgen beschwerten sich die Tibeter, daß ihnen nach dem Fortgehen der beiden eine Stange Opium im Werte von 10 Liang gefehlt habe und Ördek und Li Loje sie ihnen gestohlen hätten. Der Lama sträubte sich lange, mich mit dieser Klatscherei zu belästigen, tat es aber schließlich, da ihm keine Ruhe gelassen wurde. Ich ließ die Kleider und Sachen der beiden Verdächtigten sofort von Tschernoff und Schagdur untersuchen, aber Opium fand sich bei ihnen nicht, und die Kläger wurden als Lügner zur Tür hinausgeworfen. Nun aber waren Ördek und Li Loje wütend auf den Lama, der ihrer Meinung nach geklatscht hatte, und wollten sich an ihm rächen. Dies geschah dadurch, daß sie Sirkin einredeten, der Lama habe sie dazu bestechen und überreden wollen, mir vorzulügen, daß Sirkin durch Mißhandlungen Kalpets Tod hervorgerufen habe. Sirkin war über diese ungerechte Beschuldigung ganz außer sich und teilte mir sofort mit, was er gehört hatte. Eine solche verwickelte Geschichte mit Ruhe und Selbstbeherrschung zu untersuchen und dann das Urteil zu fällen, wenn einem in der Morgenkälte die Zähne klappern, ist weder leicht noch angenehm. In den meisten Fällen ist natürlich einer unzufrieden. Jetzt, da alles glücklich überstanden ist, wundere ich mich beinahe selbst darüber, daß es mir gelang, alle diese Schwierigkeiten zu besiegen und die Trümmer der Karawane wie nach einem großen Siege aus dem Lande unserer Sorgen herauszuführen und in die Gegenden zu[S. 333] bringen, deren Gewässer nach den warmen Küsten des Indischen Ozeans strömen. —

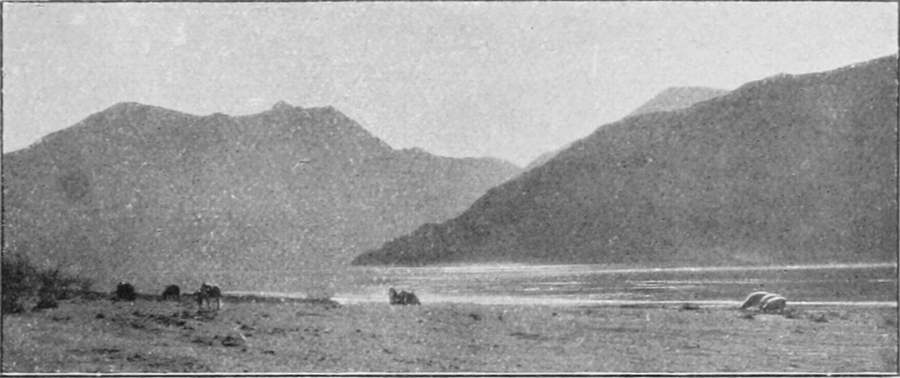
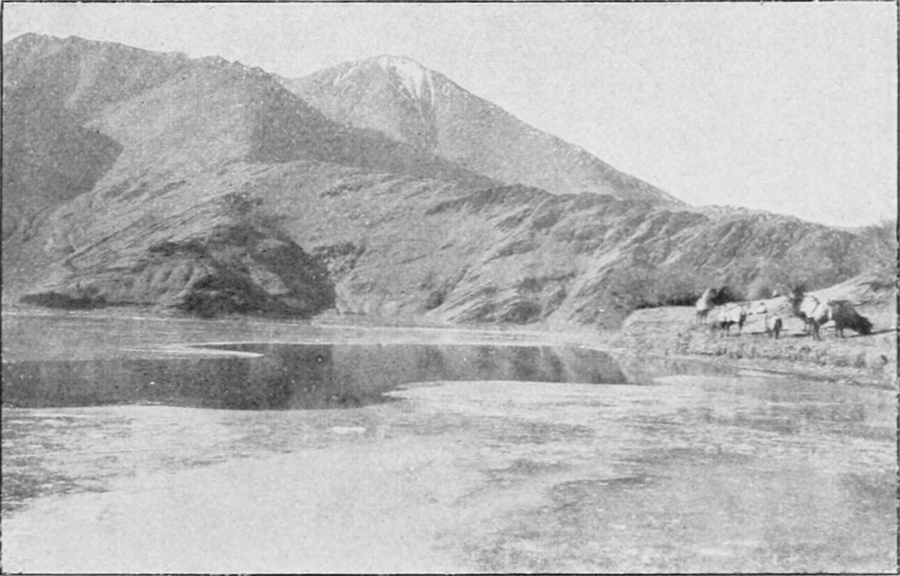

Am 27. (4379 Meter) und 28. hatten wir, als wir dem Laufe des Tsangar-schar abwärts folgten, immerfort das schöne Gefühl, uns tieferliegenden Gegenden zu nähern. Während des Marsches wird Fischfang getrieben, und Tschernoff und Schagdur wollen es einander darin zuvortun. Sie bedienen sich ihrer Säbel sowie tibetischer Speere und harpunieren ihre Opfer. Einmal nahm Schagdur ein gründliches Bad in dem eiskalten Wasser; er wagte sich im Eifer zu weit hinaus, und sein Maulesel stürzte. Ich war glücklicherweise in der Nähe und zündete ein loderndes Feuer in dem Gesträuche an, woran er sich wärmen und seine Kleider trocknen mußte; sonst wäre er, kühn und abgehärtet wie er war, einfach weitergeritten, als sei nichts vorgefallen.
Die Felsenmauer, die wir bisher auf unserer linken Seite gehabt haben, hört schließlich auf, und der Fluß macht einen scharfen Bogen nach Süden. Gerade hier liegt auf dem linken Ufer das Tempeldorf Noh, auch Odschang genannt (Abb. 302). Dort erhebt sich ein malerischer kleiner Tempel in Rot und Weiß, mit zwiebelförmigen Kuppeln, Flaggen, vergoldeten Spitzen und anderen Zieraten. Die viereckigen Häuser mit flachen Dächern sind wie gewöhnlich von weißgetünchten Mauern umgeben, die oben eine rote Kante haben; auch sie sind mit Fahnenstangen und Wimpeln geschmückt. Die Fußböden sind mit Filzteppichen belegt, in der Decke ist ein Loch zum Entweichen des Rauches, große Holzvorräte aus dem Gesträuchwalde liegen für den Winter bereit. Unsere Tibeter hatten uns schon unterwegs mitgeteilt, daß man hier kein Holz anrühren dürfe, da es dem Lama gehöre. Jetzt lag Noh vom Sonnenscheine überflutet vor uns und gewährte, mit der mächtigen Bergwand als Hintergrund, einen ungewöhnlich malerischen Anblick.
Auf dem rechten Ufer treten Geröllterrassen dicht an den Fluß heran. Nicht ohne Schwierigkeit lotsen wir die Kamele über sie hinüber, damit die Tiere nicht in das kalte, tiefe Wasser zu tauchen brauchen. Unsere Richtung führt nach Westen an der Basis der Felsen entlang, wo Quellen von +15,9 Grad entspringen. Nachdem wir einen kleineren Paß mit einer fahnengeschmückten Steinpyramide passiert haben, öffnet sich nach Süden und Westen eine großartige Aussicht über den See Tso-ngombo (blauer See). Im Süden glänzen mehrere pyramidenförmige Schneegipfel, und nach Westen dehnt sich der bizarre See mit seinen Buchten, Landspitzen, Inseln und steil abfallenden felsigen Ufern aus. Die Breite beträgt nur wenige Kilometer. Auf einem ganz ebenen Uferstreifen mit etwas Weide schlugen wir das Lager Nr. 138 (Abb. 300) auf. Kaum einen Kilometer vom[S. 334] Ufer liegt eine kleine Felseninsel, die reich an gutem Brennholz ist; ganze Stapel davon wurden über das Eis nach unserem Lager geschleppt. Die Tibeter verbrachten die Nacht auf der Insel, wo sie Schutz und Wärme hatten, und ihre großen Feuer warfen abends rotglänzende Reflexe über das spiegelblanke Eis. In diesem verursachte die Spannung unaufhörliche Knalle und Pfiffe; es klang wie ein sich im Kreise drehendes Nebelhorn.
Während des folgenden Tages, der der Ruhe gewidmet wurde, maß ich die Tiefen zwischen dem Ufer und der Insel, wobei sich ergab, daß die größte 6,35 Meter betrug. Unser Offizier teilte mir mit, daß er beauftragt sei, von hier einen Kurier nach Leh zu senden, damit wir an der Grenze von Tibet und Kaschmir vorfänden, was wir brauchten. Ich nahm die Gelegenheit wahr, einen Brief an den englischen „Joint Commissioner“ für Ladak mitzuschicken, in welchem ich um Entsatz an Yaken, Pferden und Proviant bat. Der arme Reiter verschwand auf seinem langhaarigen Pferdchen in der Nacht; als wir nachher den Weg sahen, den er in der Dunkelheit geritten war, tat er mir doppelt leid.
Am Todestage Karls XII. machten wir einen interessanten Marsch am Nordufer des Tso-ngombo entlang. Hinter der Insel hat der See ein Ende und geht in einen ganz kurzen Fluß mit offenem Wasser über, der sich bald in ein neues zugefrorenes Becken ergießt; es dauert nicht lange, so nimmt auch dieser zweite See ein Ende, und wir reiten wieder an einem Flusse entlang. Dieser ist so gerade und regelmäßig wie ein gegrabener Kanal, zirka 12 Meter breit und höchstens 3 Meter tief. Das Wasser fließt außerordentlich langsam, ist klar wie Kristall und schillert grün wie Smaragd. Auf dem Grunde gedeihen üppige Wasserpflanzen, und in Vertiefungen zeigen sich ganze Scharen von schwarzrückigen Fischen, die, den Kopf nach der Strömung gerichtet, regungslos und faul im Wasser schweben und zu grübeln scheinen. Das Ganze war ein großartiges Schauspiel; die Kosaken waren sofort wieder mit ihren Angelruten bei der Hand.
Nachdem der Fluß durch ein mittelgroßes und ein sehr kleines Becken geströmt ist, ergießt er sich schließlich in einen vierten See, der größer als die anderen ist und sich weit nach Westen und Nordwesten erstreckt; er war völlig eisfrei und vom Winde aufgeregt. Wahrscheinlich liegt es an seiner Tiefe, daß er trotz der windstillen, kalten Nächte noch nicht zugefroren ist. Das Ufer ist dicht mit Blöcken und steilen Schuttkegeln bedeckt und sehr beschwerlich für die Kamele (Abb. 303). Auf der Ebene Bal, wo wir in der Nähe einer tiefen Schlucht lagerten, gab es jetzt kein Gras, aber wir hatten Stroh und Gerste von den Tibetern gekauft, und die Tiere waren gut versorgt (Abb. 304, 305). Von Roh bis Bal waren wir dieselbe Straße gezogen wie Nain Singh; hier aber trennten sich unsere Wege[S. 335] wieder. Unterwegs waren wir einer Karawane von 200 mit Getreide aus Ladak beladenen Schafen begegnet. Es machte Spaß zu sehen, wie ordentlich sie marschieren und wie leicht sie zu regieren sind; sie kommen an den steilsten Felswänden vorwärts, trotzdem sie ziemlich schwere Lasten tragen. An der Grenze wird eine Art Tauschhandel betrieben; für 100 mit Salz beladene Schafe erhalten die Tibeter 80 Schafslasten Gerste.
Die Kälte sank auf −20,9 Grad, und in der Nacht überfiel uns ein sehr heftiger Nordsturm. Der Rest des Strohvorrats wurde rettungslos fortgeweht.
1. Dezember. Heute mußte ein Kamel getötet werden; es ist um so bitterer, jetzt von den letzten Veteranen scheiden zu müssen, da ihre Rettung so nahe ist. Wir folgen über oft sehr beschwerliche Schutterrassen treu allen Biegungen und Buchten des Ufers. Der See ist lang und schmal und gleicht einem norwegischen Fjord; beständig entrollen sich neue, bewunderungswürdige Perspektiven vor uns, die Landschaft glänzt in großartiger Schönheit, es ist ein zwischen oft jähen, stets malerisch gestalteten Felsmassen eingeschlossener Fluß. Hier und dort erhebt sich ein dominierender Schneegipfel. Einige von unseren Leuten gehen voraus, um scharfkantige Steine zu entfernen und Gruben auszufüllen. Wildenten leben hier in ungeheurer Menge; es klingt wie das Brausen eines herannahenden Sturmwindes, wenn ihre Scharen, sobald wir uns nähern, seewärts fliegen und mit solcher Wucht auf das Wasser niederschlagen, daß weißer Schaum hoch aufspritzt. Der See ist überall offen; nur in geschützten Buchten liegt hier und da ein kleines Band von zertrümmertem, vom Winde hierhergetriebenem und wieder zusammengefrorenem Eise mit dünnen, höchstens eine Nacht alten Eishäuten zwischen den Schollen.
Nun zeigt sich ein ebener Uferstreifen von weichem Erdreich, und die Berge treten zurück. Ein hier stehendes, einsames Zelt dürfte für längere Zeit aufgeschlagen sein, denn es ist mit großen Holzstapeln umzäunt. Bald darauf stehen wir an einem Felsvorsprung, der direkt in den See hinunterfällt und die erste schwere Stelle bildet, vor der man uns gewarnt hat. Wir lagerten daher unmittelbar an der Felswand, und die Kamele wurden nach der Weide zurückgeführt. Schon am Abend wurde das Gepäck von unseren Leuten über die Spitze gebracht und am folgenden Morgen die Tiere an ihr vorbeigeführt. Unterhalb der Spitze liegt ein meterbreiter Sandstreifen im Wasser. Wenn hier ein Kamel fallen sollte, so konnte es zwar in die Tiefe hinabgleiten, brauchte aber darum noch nicht verloren zu sein. An der Felsbasis haben die Uferwellen einen Eisrand gebildet, der erst weggehauen wurde; dann wurden die Maulesel, die Pferde und Kamele glücklich an der Landspitze vorbeigeführt und auf der anderen Seite in[S. 336] gewöhnlicher Ordnung beladen. Die Yake zogen es vor, über die gefährlichen Felsplatten zu klettern. Zwei kranke Kamele blieben auf der Weide zurück. Islam und Li Loje hatten Befehl, mit ihnen wenn irgend möglich unserer Spur zu folgen, andernfalls sollten sie sie töten.
Am Morgen unmittelbar vor Sonnenaufgang zeigte sich am gegenüberliegenden Strande im Südosten ein eigentümliches Phänomen. Der See „rauchte“; kreideweiße, dichte Wolken von Wasserdampf breiteten sich wie ein Schleier über die Wasserfläche. Entweder hat dies seinen Grund in heißen Quellen, oder es beruht darauf, daß der See mehr erwärmt ist als die Luft. Die Kälte war auf −18,3 Grad gesunken, und die Temperatur des Wassers war ein paar Grad über Null. Gleich nach Sonnenaufgang zerstreute sich der Nebel.
Die Breite des Tso-ngombo wechselt natürlich je nach der Konfiguration der ihn umgebenden Bergketten. Wo zwei gegenüberliegende Felsvorsprünge sich einander nähern, ist er am schmalsten. Auf einem steilabfallenden Geröllkegel hatten wir viel Mühe, weil die Instrumentkisten zwischen den Blöcken nicht durchkonnten, sondern abgeladen und getragen werden mußten. Die Kamele wurden einzeln geführt und von allen Leuten gestützt; gähnende Gruben waren ausgefüllt und hinderliche Felsblöcke mit vereinten Kräften in den See gewälzt worden.
Das Lager Nr. 141 schlugen wir neben einem Karawanenlager auf, das aus zwei schwarzen, mit den Schaflasten und Holzstapeln umgebenen Zelten bestand. Ich maß hier die Höhe zweier alter Uferlinien; die höhere lag 19,5 Meter, die tiefere 6,5 Meter über dem gegenwärtigen Wasserspiegel.
Am 3. Dezember wurde Tschernoff beauftragt, die Tiefen einer von mir vorher festgestellten Linie quer über den See zu loten. Die Tiefe betrug genau 30 Meter. Ich selbst ritt mit Tscherdon am Ufer, während die Karawane nach Westen weiterzog. Nun aber gebot ein 500 Meter breiter, zugefrorener Sund dem Boote Halt; hier erwartete ich Tschernoff. Man hatte uns gesagt, daß der Karawane heute ein absolut unüberwindliches Hindernis in den Weg treten werde, eine glatte, sehr steile Felswand, die jäh ins Wasser abstürze. Als wir daher jetzt den kleinen Sund zugefroren fanden, hofften wir nach dem Südufer des Sees hinübergelangen und so das Hindernis umgehen zu können. Wir gingen hinüber und schlugen Waken in das Eis, teils um seine Dicke (13,4–15,2 Zentimeter) zu messen, teils um die Tiefen zu loten (Maximaltiefe 29,36 Meter). Wir setzten unsere Untersuchungen auf dem Südufer fort, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, aber der Sicherheit halber schickte ich Ördek weiter. Mittlerweile hatte die Karawane Halt machen müssen. Ördek hatte Befehl erhalten,[S. 337] ein Feuer anzuzünden, sobald er an eine Stelle gelangte, wo ein Vordringen der Kamele unmöglich war. Als wir nachher zur Karawane zurückritten, sahen wir nicht weniger als drei Feuer am Südufer, das letzte dem neuen Lager gerade gegenüber. Es blieb also nur das Nordufer. Ördek wurde mit dem Boote von Tschernoff geholt, der eine neue Lotungslinie (Maximum 29,70 Meter) machte, die zeigte, daß der See auf seiner ganzen Länge in der Mitte eine zirka 30 Meter tiefe Rinne hat.


Die unpassierbare Stelle wurde von Turdu Bai untersucht, der keine Möglichkeit sah, die Kamele mit heilen Knochen hinüberzubringen. Da aber die ganze Gegend außerordentlich reich an festem, dürrem Gesträuch und Buschholz war, beschloß ich, die schwere Passage mittelst einer durch unsere Kamelleitern und Zeltstangen zusammengehaltenen und mit Seilen umwundenen Fähre zu passieren. Sie würde stark genug sein, um ein Kamel zu befördern. Es mußte gelingen, denn ich hatte keine Lust nach Bal zurückzukehren und von dort in Nain Singhs Spur nach Niagsu zu gehen. Es war doch zu ärgerlich, daß der See gerade um dieses Vorgebirge herum nicht zugefroren war. Turdu Bai erklärte, daß das Wasser offen sei.
Nachts hörte man förmlich, wie sich bei −20 Grad Eis bildete, und am nächsten Morgen waren große Flächen, die gestern noch offen gewesen, mit einer feinen Eisschicht bedeckt. So viele Leute, als sich entbehren ließen, mußten vorausgehen und Material zu der Fähre sammeln. Ein gewaltiger Stapel lag bereit, als wir am Anfang des Bergpfades anlangten. Auch hier hatte sich jetzt eine 3 Zentimeter dicke Eisbrücke über die Tiefen gespannt, und der See war querüber bis an das rechte Ufer überfroren. Sobald das Lager aufgeschlagen war, gingen Sirkin und zwei von den anderen hinauf, um sich den schwierigen Weg anzusehen. Ihre Meinungen waren geteilt, aber Sirkin war der Ansicht, daß es mit großer Vorsicht gehen müsse, die Kamele einzeln hinüberzubringen. Ich mußte mich selbst überzeugen und fand den Pfad einfach lebensgefährlich. Der schwarze Schiefer fällt hier mit glatten Platten 43 Grad steil nach Westsüdwest zum See ab. Ein Riß in der Bergwand gibt aber eine Stütze für die Schieferplatten, die hier hingelegt worden sind, damit die Tiere nicht abrutschen. Auf der äußeren Seite wurden diese Platten von oft 2 Meter hohen Stämmen und Säulen gestützt, die mir jedoch nicht danach aussahen, das Gewicht eines Kamels tragen zu können. Manchmal geht es im Zickzack halsbrecherische Stufen hinab. Vielleicht hätten einige unserer müden Kamele dieses Akrobatenstück fertig gebracht, die meisten aber wären sicherlich vom Schwindel ergriffen worden und in den Abgrund gestürzt.
[S. 338]
Nein, entweder mußten wir eine Fähre bauen und das dünne Eis aufbrechen, oder wir mußten warten, bis das Eis uns trug. Da wir noch um 1 Uhr −4,5 Grad hatten, hoffte ich auf den letzteren Ausweg. Um 6 Uhr war das Eis schon 5,2 Zentimeter dick. Die Kosaken bauten einen improvisierten Schlitten aus Kamelleitern, Zeltstangen, Holz und Tauen und bedeckten das Ganze mit Filzdecken. Es war Schagdurs kluger Vorschlag, die Kamele auf dieser Vorrichtung an dem Felsen vorbeizuziehen, wenn das Eis nicht stark genug sein sollte, daß sie darauf gehen könnten.
Der Sturm heulte an den Wänden und durch die Büsche und sauste wie in einem nordischen Walde. Das Eis nahm an Stärke zu; auf einer Stelle, die man vormittags nur mit großer Vorsicht hatte passieren können, standen jetzt drei Mann nebeneinander. Jetzt sollte auch die Fähre probiert werden. Sie wurde mit so vielen Männern, als dem Gewichte eines Kamels entsprachen, belastet und von einigen um das Vorgebirge herumgezogen (Abb. 306). Sobald es anfing zu knacken, sprang der Lama ab, dann ich, darauf Tokta Ahun, je nachdem das Eis schwächer wurde. Jeder neue Deserteur rief unter den sitzenbleibenden Helden die größte Heiterkeit hervor. Das Eis ist kristallhell, ohne eine Blase. Man scheint über einer stillen Wasserfläche zu schweben, und durch die Eisdecke sieht man Fische zwischen den Wasserpflanzen hin und her huschen. Manchmal klingt es, als würden auf dem Eise Schüsse abgefeuert, und man glaubt, die Kugeln pfeifen und den immer schwächer werdenden, ersterbenden Schall in der Ferne verhallen zu hören.
Wir mußten noch den folgenden Tag warten, um dem Eise Zeit zum Stärkerwerden zu lassen. Mit großem Interesse wurde das Thermometer beobachtet. Nachts zeigte es −19,1 Grad, am 5. morgens um 7 Uhr −11,1 Grad, um 1 Uhr −5,1 Grad, um 9 Uhr −8,9 Grad und in der nächsten Nacht −20,9 Grad. Ich stand eine Stunde vor Sonnenaufgang auf, um eine astronomische Ortsbestimmung zu machen. Sodann wurde unser ganzes Gepäck, außer meinen Sachen und der Küche, auf dem Schlitten nach dem jenseits des hinderlichen Vorgebirges liegenden Ufer gebracht (Abb. 307). Das Eis war 2 Zentimeter dicker geworden. Auch die Tibeter siedelten dorthin über, zogen jedoch den gefährlichen Felsenpfad vor, wo sie indessen die Yake vorsichtig treiben mußten, damit diese einander nicht in den Abgrund drängten. Diese Tiere gehen mit unglaublicher Sicherheit; sie können wohl ausgleiten, verlieren aber nie den Boden unter den Füßen (Abb. 308).
Währenddessen lotete Tschernoff im See, und mit Benutzung seiner Waken maß ich nachher die in verschiedenen Tiefen herrschenden Temperaturen. Die Untersuchung ergab, daß in der Nähe des Südufers warme[S. 339] Quellen vom Seegrunde aufsteigen müssen. Die größte Tiefe war 21,55 Meter. Die Exkursion wurde in einer Boothälfte gemacht, die Ördek und Chodai Kullu zogen. Letzterer brach schließlich ein, hielt sich aber noch im letzten Augenblick am Bootrande fest.
Noch ein Kamel blieb am 6. Dezember am Ufer des „Blauen Sees“ liegen. Wir hatten jetzt nur noch zehn. Alle Muselmänner müssen zu Fuß gehen, aber die Tagemärsche sind auch nur kurz.
Auf dem Eise um das hinderliche Vorgebirge herum wurden 28 Säcke Sand ausgestreut, um für die Kamele einen Fußweg zu bilden. Ihre Überführung fand vor Sonnenaufgang statt, damit nicht unter der Einwirkung der Sonne das jetzt 9,9 Zentimeter dicke Eis schwächer würde. Alles ging glücklich, nur aus einigen Rissen quoll Wasser heraus. Das zurückgebliebene Gepäck wurde auf den Schlitten genommen; dann zogen wir nach Westen weiter, um gefährliche Landspitzen herum, über kleine Flugsandfelder hinweg und an regelmäßig abgerundeten Buchten entlang. Ich ging den ganzen Tag zu Fuß, denn mein Pferd war jetzt auch schwach geworden. Der See ist hier vollständig eisfrei; er friert augenscheinlich von Osten nach Westen zu (Abb. 309).
Jetzt verschmälerte sich der Tso-ngombo wieder und ging schließlich in den Fluß Adschi-tsonjak über, der das süße Wasser des ersteren dem salzigen Panggong-tso zuführt. Wir lagerten am Anfange des Flusses, und zwar auf seinem rechten, nördlichen Ufer. Wir hatten den großen, außerordentlich fesselnden See mit seinen hinreißenden Perspektiven hinter uns. Besonders an windstillen Tagen und Abenden bietet die großartige Natur mit ihren gigantischen Dimensionen und ihrer vollendeten, fast märchenhaften Schönheit ein unvergeßliches Schauspiel. Die steilen Felsen treten wie Kulissen aus dem Ufer heraus, und die gewaltigen Berggestalten spiegeln sich in der blanken Wasserfläche oder dem ebenso reinen, blendenden, glitzernden Eise.
[S. 340]
Dem Lager Nr. 144, das gerade hundert Tagereisen vom großen Hauptquartier lag, fehlte es ebenfalls nicht an Bedeutung. Hier sollten wir, wie man uns gesagt hatte, neue Yake aus Ladak bekommen; da diese aber noch nicht da waren und die Tibeter nach Hause zurückkehren wollten, mußten wir aufpassen, daß sie uns nicht durchbrannten. Drei Rasttage zwischen den beiden Seen sollten den Kamelen wohltun und auch meinen Arbeiten förderlich sein.
Am 7. Dezember tobte ein grauenhafter Sturm, und Wolken von Sand regneten auf uns herab. Tschernoff, der den westlichen Teil des Sees auf vier Linien lotete (Maximaltiefe 31,76 Meter), konnte sich kaum ans Land retten. Am 9. sollten wir aufbrechen, aber es stellte sich heraus, daß alle Yake durchgebrannt waren und ein neuer Sturm alle ihre Spuren im Sande verwischt hatte. Nach vielem Suchen fanden wir sie schließlich wieder, doch erst, als der Tag zur Neige ging. Ihr Führer, Loppsen, erklärte sich bereit, mit uns längs des Nordufers des Panggong-tso weiterzuziehen und bei uns zu bleiben, bis wir aus Ladak Entsatz erhielten. Es war hohe Zeit, daß wir Verstärkung bekamen; unsere Vorräte an Reis, Mehl und Talkan waren seit mehreren Tagen zu Ende, und wir lebten ausschließlich von Fleisch. In einem benachbarten Zeltdorfe erstanden wir sieben Schafe. Dort waren einige Hunde, mit denen sich Jolldasch sehr anfreundete. Daß er Prügel bekam, wenn er auskniff, machte ihm jetzt keinen Eindruck mehr; wenn er nicht fortlaufen sollte, mußte er angebunden werden. Bei dem Lager wurde die höchste noch sichtbare Terrasse gemessen; sie lag 54 Meter über dem Flusse! Die beiden Seen haben einstmals entschieden zusammengehangen und befinden sich, gleich allen anderen Seen Tibets, im Zustande der Austrocknung.

Am 10. Dezember zog die Karawane am nördlichen Ufer des Panggong-tso weiter, während ich mit Ördek den Flußarm hinabruderte. Die[S. 341] Temperatur war auf −25,7 Grad heruntergegangen; es mußte an warmen Quellen liegen, daß das Wasser nicht gefroren war. Der Fluß erweitert sich nach unten; in einer Biegung lag eine Nacht altes Eis, dünn wie Papier, aber trotzdem hinderlich für das Boot. Weiter abwärts war der Eisgürtel so stark, daß er, als wir ihn zur Abkürzung des Weges benutzten, sowohl uns wie das Boot trug. Doch schließlich legte uns das Eis ein unüberwindliches Hindernis in den Weg; wir schleppten das Boot nach der weiten trompetenförmigen Mündung, die an den Ausfluß des Satschu-sangpo in den Selling-tso erinnert. Hier erwartete man uns mit einem Kamele, auf welches das Boot geladen wurde.
Wir begaben uns nach dem Gebirge im Norden, das aus grünem Schiefer besteht und an dessen Basis mehrere Quellen entspringen. Der See liegt offen vor uns, nur in ruhigen Buchten schaukelt auf der Dünung eine dünne Eisschicht. Die Gestalt des Ufers ist genau dieselbe wie beim Tso-ngombo; es ist noch immer dasselbe Längental, in dem wir ziehen, und wir marschieren immer noch auf derselben absoluten Höhe, oder, wie das langsame Strömen des Flusses zeigt, nur eine Kleinigkeit tiefer. Dieselben Bergarme laufen in Vorgebirge aus, und zwischen diesen liegen dieselben kleinen, dreieckigen oder halbmondförmigen Talflächen, auf denen die Buschvegetation immer mehr abnimmt. Überall, wo Schuttkegel steil in den See fallen, sind die aus dem Wasser schauenden Steine mit einer Kruste von weißem, blasigem Eise überzogen. Der See ist aufgeregt, die Wogen schlagen gegen das Ufer, und das Spritzwasser gefriert sofort auf den vom Nachtfrost durchkälteten Steinblöcken. Auf einer flachen Halbinsel namens Siriap, wo das Gebüsch noch in Menge wuchs, fanden wir die Unsrigen im besten Wohlsein vor (Abb. 310).
11. Dezember. Das Wetter war heute so schön und windstill, daß ich meinen beiden besten Seeleuten, Tschernoff und Ördek, den Auftrag geben konnte, über den Panggong-tso nach einem Vorgebirge im Südwesten zu rudern, um die Tiefen zu messen. Sie nahmen für den Fall, daß sie das nächste Lager vor Eintritt der Dunkelheit nicht mehr erreichten, Proviant für einen Tag mit. Wir zogen längs dieser eigentümlichen, girlandenförmigen Uferlinie, welche die Länge des Weges beinahe verdoppelt, nach Westen weiter. Bei jedem Ausläufer von dem Hauptkamme der nördlichen Kette entsteht eine in den See vorspringende Halbinsel oder ein Vorgebirge. Auf der Ostseite gehen wir nach Süden, auf der Westseite nach Norden, ja, manchmal müssen wir sogar nach Nordost und Südost marschieren. Einige Stellen sind für die Kamele sehr beschwerlich und müssen erst mit Spaten und Brechstangen bearbeitet werden. An einer Stelle ist der Weg auf der Uferterrasse so schmal, daß nur Schafe dort durchkommen[S. 342] können; glücklicherweise war der See hier nicht zu tief, so daß die Kamele im Wasser gehen konnten.
Bei dem heutigen Lagerplatze gab es nur einen Brunnen, dessen Wasser nicht viel besser als dasjenige des Sees war, weshalb wir es vorzogen, Eisschollen von den Ufersteinen loszubrechen. In der Dämmerung stellte sich heraus, daß die Kamele zurückgelaufen waren. Auf der schmalen Uferterrasse waren sie aber stehengeblieben; sie mußten ganz vergessen haben, daß sie hier eine Strecke im Wasser gegangen waren. Sie sehnten sich nach den schönen Weideplätzen am Tso-ngombo zurück. Nachher wurden sie festgebunden und mit Gerste traktiert, die wir in reichlicher Menge mit hatten und die von den Yaken getragen wurde. Im Süden war auf dem andern Ufer Tschernoffs Feuer zu sehen. Ein Felsen gewährte uns Schutz, aber man hörte an dem Rauschen des Sees, daß ein heftiger Wind ging; die Wellen schlugen mit solchem Getöse an das Ufer, daß die Kosaken mich nicht hörten, als ich sie rief.
Am 12. Dezember lag die ganze Gegend in undurchdringlichen Schneesturm gehüllt da, und vom Südufer war keine Spur zu sehen. Die Temperatur war nicht unter −7,5 Grad heruntergegangen. Starker Seegang herrschte, denn in diesem Längentale wird der Wind wie in eine Rinne eingepreßt und fegt ungehindert über den See hin. Im Laufe des Tages sahen wir jedoch zu unserer Freude, daß die Jolle noch auf derselben Stelle lag und die Ruderer sich nicht auf waghalsige Abenteuer begeben hatten.
Unser Tagemarsch war nicht lang, aber beschwerlicher als alle andern, die wir bisher am Nordufer dieses endlosen Seenzwillingspaares zurückgelegt hatten. Ein mächtiger, nach Süden zeigender Felsausläufer fällt mit senkrechten Wänden in den See; über seinen Kamm führt ein Pfad, der von den Karawanen benutzt wird. Aber für Kamele ist er nicht bestimmt. Eine Weile rasteten wir am Fuße des Berges, während Sirkin das Ufer, das zu überschreiten sogar für Menschen, auch wenn sie kletterten, unmöglich war, untersuchte und Schagdur nach dem Kamme hinaufritt. Er erklärte ihn für grauenhaft, aber vielleicht passierbar. Die Yakkarawane kletterte mit großer Sicherheit hinauf. Als sie den Kamm erreicht hatte, wurden fünfzehn Yake abgeladen, die meine Kisten, alle Zelte und allerlei sonstige Sachen holen mußten, womit sie den Weg nach dem Lager auf der andern Seite fortsetzten, während sie den Rest nachts abholten.
Unterdessen stellten wir mit Spaten und Brechstangen einen Zickzackweg für die Kamele her, die außerordentlich langsam einzeln hinaufgeführt und geschoben wurden; es dauerte stundenlang, obgleich die relative Höhe keine 200 Meter betrug. Von dem Passe, auf dem eine kleine, mit Fähnchen geschmückte Steinpyramide steht, haben wir eine entzückende Aussicht über[S. 343] den ganzen Panggong-tso und im Süden auf die schneebedeckte Welt von Bergen, die eine Grenzmauer bilden, hinter welcher das Flußgebiet des Indus liegt. Doch wir blieben keine Minute länger droben, als unumgänglich nötig war. Ein durch Mark und Bein dringender Westwind sauste über den Paß hin. Man mußte breitbeinig stehen, wenn man nicht umgeweht werden wollte, und wenn man seine Aufzeichnungen macht, muß man dem Winde den Rücken kehren und sich sputen, damit man fertig wird, ehe einem die Hände vor Kälte steif sind. Dann eilt man abwärts in der Hoffnung, hinter einem Vorsprunge Schutz zu finden, sieht sich aber enttäuscht, denn der ganze Westabhang ist dem Sturme ausgesetzt. Und was für ein Abstieg! Manchmal muß ich kriechen und mich mit den Händen halten, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Turdu Bai war mit zwei Kamelen vorausgegangen. Ich begegnete ihm jetzt; ganz ratlos war er umgekehrt. Nach langem Suchen fanden wir jedoch eine Stelle, wo man einen Weg herstellen konnte. Dies erforderte aber lange Zeit und ließ sich heute nicht mehr fertigbringen. Es dämmerte schon, und Turdu Bai und einige der andern mußten die Nacht über mit allen Kamelen auf halber Höhe des Berges bleiben. Im Lager war jedoch alles in Ordnung, und früh am nächsten Morgen trafen auch die Kamele dort ein.
Am folgenden Tag ging es an diesem endlosen Ufer weiter. Die Yake waren weit voraus, sie sehnten sich nach Gras. Die Ruderer konnten nicht wieder nach unserem Ufer zurückkehren, aber wir sahen sie durch das Fernglas und brauchten ihretwegen nicht besorgt zu sein. In dem Lager Serdse, das auf der Grenze zwischen Tibet und Kaschmir liegt, erwartete uns eine große, freudige Überraschung. Hier trafen wir die Entsatzkarawane, die uns auf Befehl des Wesir Wesarat, des Statthalters des Maharadscha von Kaschmir in Ladak, entgegengeschickt worden war. Sie war zuerst nach Mann gegangen, einem Dorfe auf dem Südufer des Sees, Serdse gegenüber. Als wir dort nicht erschienen waren, war sie umgekehrt, um uns auf dem Nordufer zu suchen. Unsere Lage veränderte sich mit einem Schlage; 12 Pferde und 30 Yake standen uns zur Verfügung; Schafe, Mehl, Reis, Dörrobst, Milch, Zucker, Gerste für unsere Tiere; konnte man mehr verlangen? Meine Karawane, mit der es Matthäi am letzten war, wurde auf einmal restauriert. Wir brauchten uns nicht länger Entbehrungen aufzuerlegen, die lange Leidenszeit war jetzt vorbei, und ich selbst empfand die Unterstützung wie einen warmen Hauch von Indien, wie einen Gruß aus gastfreundlichen Gegenden, ja, wie eine Umarmung von meinem eigenen Heim.
Führer dieser neuen Karawane waren zwei Männer aus Ladak: Anmar Dschu, der fließend Persisch sprach und mit dem ich mich daher unterhalten[S. 344] konnte, und Gulang Hiraman, ein klassischer, gemütlicher Herr, der vor eitel Wohlwollen glänzte; die übrigen Leute waren ebenfalls Ladakis, nur einer war ein Hindu (Abb. 311, 312). Die letzten Tibeter erhielten jetzt ihren Abschied und gute Bezahlung, sowie alles, was wir an „altem Gerümpel“, Kasserollen, Tassen, Kannen und Kleidern entbehren konnten, ja sogar einen Revolver. Nicht ohne Wehmut sah ich sie fortziehen, denn sie hatten uns auf vortreffliche Weise gedient, waren ehrlich und freundlich gewesen und hatten unsertwegen viel Arbeit und Mühe gehabt. Jetzt sollte die Schlinge, die mich so lange an Tibet gefesselt hatte, zerrissen werden. Alle unsere Erinnerungen an seine unwirtlichen Täler, alle unsere Verluste und Leiden würden künftig in versöhnendem Lichte vor unserem geistigen Auge stehen. Die harten Schicksale und Schwierigkeiten, die wir zu bekämpfen und zu besiegen gehabt hatten, würden wir mit der Zeit vergessen. Die Erinnerung haftet mit Vorliebe an den fröhlichen Ereignissen, und das Böse, das uns trifft, erscheint nicht mehr so schlimm, wenn die zeitliche und räumliche Entfernung zunimmt. Als die Sonne an diesem Abend unterging und die dunkle Nacht im Osten heraufzog, schien sie mir das Land des Dalai-Lama mit all seinen Geheimnissen und seinen noch ungelösten Rätseln verschlungen zu haben. Doch in meinen Brieftaschen und Tagebüchern barg ich einen Schatz, der die Bitterkeit des Abschieds milderte und der über bisher noch völlig unbekannte Gegenden Tibets Licht verbreiten sollte.
Die Führer der Entsatzkarawane überraschten mich dadurch, daß sie mir jeder eine Silberrupie schenkten. Trotz der etwas lächerlichen Situation begriff ich, daß das Geschenk freundlich gemeint war, und steckte das Geld in die Tasche — in der Absicht, es mit Zinsen zurückzugeben.
Wir lagerten zusammen an der Quelle, die unmittelbar am Ufer Blasen werfend aus der Erde sprudelte und +16,2 Grad Temperatur bei −6 Grad Lufttemperatur hatte; das Wasser dampfte und fühlte sich lauwarm an. Tausend Fragen über die Verhältnisse in Ladak, Kaschmir und Indien kreuzten einander, und es wurde spät, ehe wir uns schlafen legten. Auf einer vorspringenden Landspitze wurde als Signal für Tschernoff ein gewaltiges Feuer unterhalten. Am folgenden Tage kam er gesund und munter an, nachdem er zwei Linien gelotet und eine Maximaltiefe von 47,5 Meter gefunden hatte. Nach Leh, wohin wir noch acht Tagereisen haben sollten, schickte ich Briefe durch einen besonderen Kurier.

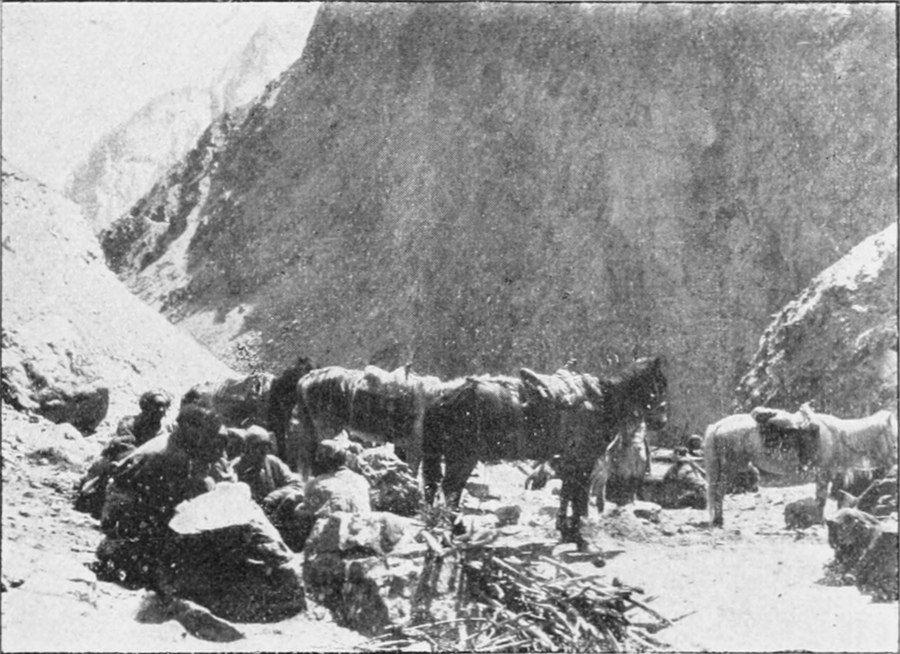
Bevor ich jetzt zum 15. Dezember übergehe, muß ich erzählen, was aus Jolldasch wurde, meinem Hunde aus Osch, der die ganze Zeit über mein Zeltkamerad gewesen war. Er brachte die Nacht wie gewöhnlich auf den Filzdecken zu meinen Füßen zu; bei Sonnenaufgang sprang er auf,[S. 345] schüttelte sich und lief hinaus. Er pflegte bis zum Aufbrechen der Karawane vor dem Zelte in der Sonne zu liegen. Diesmal aber lief er über die Berge nach Osten und kam nicht wieder. Chodai Kullu sah ihn in rasender Eile längs der gestrigen Spur zurücklaufen, als sei er von der Sonne hypnotisiert oder habe alle Mächte der Finsternis hinter sich. Daß er in dem Zeltdorfe zwischen den Seen intime Bekanntschaften gemacht hatte, wußten wir, und es mußte ihm dort wohl besser gefallen haben als in unserer Gesellschaft. Ich hatte ihn während zweier Tagereisen angebunden, dann aber durfte er wieder frei im Lager umherlaufen und während des Ruhetages in Serdse spielte er seine Rolle vorzüglich. Er dachte gewiß: „Ich werde nicht eher durchbrennen, als bis die Entfernung so groß ist, daß sie es nicht der Mühe wert halten, mich zurückzuholen.“ Er hatte 50 Kilometer am Ufer des Panggong-tso zurückzulegen, um zu seiner Liebsten zu gelangen. Es wäre interessant zu wissen, wie es ihm auf der Flucht ergangen und ob er den Wölfen, die sicherlich unsere toten Kamele besucht hatten, glücklich entronnen ist. Ja, es wäre mir eine Freude zu wissen, wie es meinem alten Reisegefährten jetzt geht. Er ist natürlich ein Vollbluttibeter geworden; er konnte sich von diesem Lande nicht losreißen, sondern kehrte gerade an der Grenze wieder um. Ich möchte wohl wissen, ob er mich und all die Liebe, mit der ich ihn zwei und ein halbes Jahr behandelt habe, ganz vergessen hat? Mir fehlte er überall, aber in der Karawane war er Gegenstand allgemeiner Verachtung; alle fanden, daß er ein feiger, undankbarer Überläufer sei.
Die Karawane ging jetzt einen nördlicheren Weg, während ich mit Anmar Dschu, Tschernoff und dem Lama auf einem halsbrecherischen Pfade mit mehreren schwierigen Pässen am See entlang nach der nächsten Quelle zog. Als die anderen schließlich auch dort ankamen, brachten sie nur neun Kamele mit; welch ein Jammer, daß jetzt noch ein letztes sterben mußte, da wir nun Stroh und Gerste in Menge hatten und die lange Ruhe an gefüllten Krippen so bald zu erwarten war!
Nachts schneite es endlich tüchtig, und am 16. ritten wir durch eine blendend weiße Winterlandschaft. Von dem Passe oberhalb des Lagers lag der See unter uns wie in einer tiefen Grube, wie ein Graben zwischen schneebedeckten Bergen. Ich machte einige photographische Aufnahmen, aber es war hübsch kalt für die Finger, bei −10 Grad und Wind mit der Kamera zu hantieren; es mußte ein kleines Feuer angezündet werden, damit ich mich ab und zu wärmen konnte. Und nun verlassen wir den Panggong-tso, diesen großartigen, reizenden See, reiten über seine westliche, dünenreiche Sandsteppe, ziehen langsam ein im Südwesten mündendes Tal hinauf und gelangen auf eine kleine Schwelle, die mit zwei Steinkisten von prächtigen[S. 346] „Mani“-Platten mit flatternden Wimpeln geschmückt ist. Diese kleine Schwelle lag in einer Höhe von wenig mehr als 20 Meter, also nur 2 Millimeter Luftdruckunterschied, über dem See. Von dort ging es ein energisch ausgemeißeltes, mit Schutt und Blöcken angefülltes Tal hinab, wo wir am Ufer eines kleinen zugefrorenen Sees, zirka 60 Meter unter dem Spiegel des Sees, lagerten (Abb. 314). Wir hatten das Flußgebiet des Indus erreicht, und die Wassertropfen, die diesem Tale entsprangen, werden sich dereinst nach tausend Kämpfen in dem Indischen Ozean verlieren. Zweieinhalb Jahre hatten wir uns in abflußlosen Zentralbecken im innersten Asien bewegt, jetzt waren wir wieder in Gegenden, die Abfluß nach dem Meere besaßen. Es war ein befreiendes, erquickendes Gefühl, dies zu wissen; wir entfernen uns jetzt allmählich von dem höchsten Gebirgslande der Erde.
Die erwähnte Schwelle ist von großem Interesse, wenn man sie mit den alten Uferlinien vergleicht, die 54 Meter über dem Panggong-tso liegen. Der See hat einst einen Abfluß nach dem Indus gehabt, ist aber später, aus klimatischen Veranlassungen, von diesem Flußgebiete abgeschnürt worden. Infolgedessen ist er salzig geworden, und die Süßwassermollusken sind ausgestorben.
Am 17. nahm ich Abschied von der Karawane, um nach Leh vorauszueilen. Es war noch stockfinster, als wir aufstanden, aber die munteren Ladakpferde waren bereits gesattelt. Anmar Dschu, Tschernoff und Tscherdon begleiteten mich; das Gepäck trugen drei Pferde, die von einigen Fußgängern getrieben wurden. So sprengten wir in raschem Tempo fort. Wir mußten ungefähr 40 Kilometer täglich zurücklegen, um in 4 Tagen Leh zu erreichen, damit ich noch ein Telegramm zum heiligen Abend nach Hause senden konnte. Es ging jetzt schnell talabwärts. Gehöfte und bebaute Felder begannen aufzutreten. Bei Tanksi, wo wir andere Pferde erhielten, erhebt sich malerisch auf einem isolierten Felsen das Kloster Dschowa (Abb. 315). Nachdem es von der Ebene aus photographiert worden war, ritten wir weiter nach Drugub (3919 Meter), dem ersten Nachtlager, wo eine ganze Musikantentruppe mit Trommeln und Flöten und vorgebundenen Masken zu unserer Ehre auf dem Hofe tanzte (Abb. 313). Es kam mir ganz eigentümlich vor, wieder in einem Hause zu schlafen!
Die nächste Tagereise führte bergauf nach immer höherwerdenden Regionen, denn wir mußten über den schwierigen Paß Tschang-la, der sonst um diese Jahreszeit durch Schnee versperrt ist, in diesem Jahre aber passierbar war. Der Anstieg ist schwer, alles grau in grau, Block neben Block. Es dauerte mehrere Stunden, bis wir den Kamm erreichten, auf dem wir uns wieder in einer Höhe von 5386 Meter befanden. Der Abstieg ist[S. 347] noch viel steiler. Zwischen Millionen von Granitblöcken zieht sich der abschüssige Zickzackpfad ins Tal hinunter, und es war schon pechschwarze Nacht, als wir die Steinhütten von Taggar erreichten.
Wie seltsam und merkwürdig war es für uns, wieder überall Menschen zu treffen, Dorf auf Dorf hinter uns verschwinden und die mit Steinmauern umfriedigten Ackerfelder immer größer und zahlreicher werden zu sehen. Tempel thronen auf den Felsen, und der Wind flüstert in Pappeln und Weiden. Die Kosaken betrachteten mich jetzt mit einer gewissen Bewunderung; es imponierte ihnen sichtlich, daß ich den Weg hierher gefunden hatte und von diesen Eingeborenen, von deren Dasein sie bisher noch nie Kunde erhalten hatten, so freundlich aufgenommen wurden. Und immerfort ging es hinunter in tieferliegende Gegenden, in dichtere Luftschichten, mildere Temperatur. Die Steinkisten, jene seltsamen Opferaltäre, gegen welche die Obo der Mongolen Kleinigkeiten sind, nahmen an Zahl und Größe zu. Eine solche, die 1½ Meter hoch und 3 Meter breit war, maß in der Länge nicht weniger als 260 Meter, und ihre ganze, auf beiden Seiten von einem Erdrücken abfallende Fläche war voller Steinplatten, in welche „Om mani padme hum“ mit unglaublicher Mühe eingehauen war. Es muß eine lange Zeit dauern, ehe ein solches Werk zur Ehre der Götter fertig wird. Die Lamas, die den ewigen Denkspruch mit unerschütterlicher Geduld in den Stein graben, trösten sich wohl mit dem Gedanken: wenn wir verstummt sind, werden die Steine reden. Das Tempelkloster Dschimre liegt wundervoll auf einem Felsen, und das Dorf am Fuße desselben ist groß und reich. Nach einer weiteren Reihe von Dörfern gelangen wir an den Indus, der in einem tief eingeschnittenen, gewundenen Bette fließt. Sein klares, grünes, Stromschnellen bildendes Wasser rauscht wie in einem 50 Meter tiefen Graben dahin. An der Flußbiegung läuft eine 3 Meter hohe, 9 Meter breite und 416 Meter, also fast einen halben Kilometer lange „Mani“-Kiste entlang; verrückte Menschen, welch nutzlose Arbeit! Man erstaunt immer mehr, je größer die Kisten werden; in einer Reihe aufgestellt, würden sie eine kleine chinesische Mauer geben.
Hier an der Flußbiegung kam mir Mirsa Muhammed entgegen, der Naib oder Sekretär des Täsildars (eingeborener Distriktschef) von Leh. Er war ein sehr liebenswürdiger, angenehmer Mensch, der fließend Persisch sprach und mir später viele unschätzbare Dienste leisten sollte. Wir ritten auf dem rechten Indusufer durch das breite, gewaltige Tal westwärts nach der Posthalterei von Tikkse, wo es in einem Zimmer einen eisernen Ofen gab. Über dem Dorfe thront erhaben über allen Erdenlärm das Kloster Tikkse-gompa (Abb. 316, 317). Die Mönche, 40–50 an der Zahl, hatten die Freundlichkeit, fragen zu lassen, ob ich nicht lieber bei ihnen[S. 348] wohnen wolle; aber wir hatten es dort unten gut, und erst am nächsten Morgen machte ich ihnen einen Besuch. Von den Terrassen und Altanen ihrer für den Pinsel eines Malers so verlockenden Freistatt hatte man eine entzückende, überwältigende Aussicht über das gigantische Industal (Abb. 318).
Während des Rittes nach Tikkse waren uns drei Boten entgegengekommen; einer von ihnen war eine Frau. Sie trugen ihre Botschaft um das Ende eines Stöckchens gewickelt. Der eine brachte mir ein Telegramm von dem jetzt in Sialkut wohnenden englischen Residenten von Kaschmir: „Warmest congratulations on safe arrival, message sent to His Excellency Viceroy, trust arrangements made satisfactory“. (Wärmste Glückwünsche zur glücklichen Ankunft; habe Se. Exzellenz den Vizekönig benachrichtigt; hoffe, daß die getroffenen Anordnungen zufriedenstellend sind.)
Von dem Augenblick an, da ich den Fuß auf britisches Gebiet setzte, wurde ich täglich mit Gastfreundschaft und Artigkeit überhäuft. Als wir am 20. Dezember müde und bestaubt in Leh, der 4000 Einwohner zählenden Hauptstadt von Ladak (Abb. 319), eintrafen, kam mir ihr Täsildar entgegen, ein fließend Englisch sprechender, bis auf den hohen, faltigen, weißen Turban europäisch gekleideter, ungewöhnlich distinguiert aussehender Hindu namens Jettumal. Er hieß mich auf dem Gebiete des Maharadscha willkommen und überreichte mir ein artiges Telegramm vom Wesir Wesarat. Wir ritten zuerst nach dem „Dak-bungalow“ (Gasthaus, Hotel), das die in Leh weilenden Engländer zu besuchen pflegen. Dieses Haus war in jeder Beziehung elegant und gemütlich; dennoch zog ich es vor, in Mirsa Muhammeds Hause zu wohnen, das früher Missionar Webers Kirche gewesen war, in welchem auch die Kosaken zwei Zimmer bekommen konnten und wo die Karawane auf einem großen Hofe reichlich Platz für Menschen und Tiere fand. Hier wurde für mich ein vortreffliches Zimmer mit Ofen, Teppich, Bett, Tisch und Stühlen eingerichtet, und hierher brachte Jettumal meine gewaltige Post. Seit elf Monaten hatte ich kein Wort von Europa gehört und wußte nicht, wie es zu Hause stand; man kann sich also denken, mit welcher Unruhe ich die Post mit allen ihren Neuigkeiten öffnete. Ich erbrach zuerst die letzten Briefe, und nachdem ich mich überzeugt hatte, daß alle meine Angehörigen noch lebten und gesund waren, konnte ich die Briefe mit Ruhe in chronologischer Reihenfolge durchgehen. Ich legte mich auf das schöne Bett und las die ganze Nacht hindurch, und die Sonne stand am 21. schon hoch am Himmel, als ich zur Ruhe ging. Tief schmerzte mich die Nachricht von Nordenskiölds Tod.
Schon bei meiner Ankunft hatte Jettumal von „King Edward“ gesprochen. Ich war erstaunt, hatte ich doch den Namen nie gehört; ich wußte nicht, daß Königin Viktoria vor beinahe einem Jahre gestorben war!



[S. 349]
Das erste aber, was ich tat, als ich nun nach allen Stürmen in Leh einen Hafen gefunden hatte, war, an König Oskar, an Lord Curzon, den Vizekönig von Indien, und an meine Eltern zu telegraphieren. Die freundlichen, aufmunternden Antworten trafen gerade rechtzeitig als Weihnachtsgaben für mich ein. Das Telegramm des Königs von Schweden lautete: „Vielen Dank für Ihr Telegramm und die bereits erhaltenen interessanten Briefe! Ich freue mich herzlich über Ihre glückliche Ankunft auf britischem Gebiete und hoffe, daß Sie bald heimkehren. Ich und die Meinen sind gesund. Sie herzlich grüßend, König Oskar.“
Von Tscharchlik hatte ich, via Kaschgar, an Lord Curzon geschrieben und ihn gebeten, bei der Ankunft in Leh eine Anleihe von 3000 Rupien aufnehmen zu dürfen; diese Summe lag jetzt bereit und wartete auf mich. Ich hatte auch von der Möglichkeit eines kurzen Besuchs in Indien gesprochen, und jetzt erhielt ich einen langen, liebenswürdigen Brief des Vizekönigs, der mit den Worten schloß:
„Ich habe Ihnen nur einen Vorschlag zu machen, und der ist, daß Sie nach Kalkutta kommen, wo ich mich vom Januar bis Ende März aufhalte, und mir das Vergnügen machen, Sie als meinen Gast im Government House zu begrüßen und aus Ihrem eignen Munde zu hören, was Sie alles gesehen und ausgeführt haben.“
Nachdem ich geantwortet und diese liebenswürdige Einladung dankbar angenommen hatte, telegraphierte Lord Curzon:
„Congratulate you upon your safe arrival after most arduous journey and great discoveries. Am delighted that we shall see you here. Viceroy.“ (Gratuliere Ihnen zu ihrer glücklichen Ankunft nach der sehr anstrengenden Reise und den großen Entdeckungen. Bin entzückt, daß wir Sie hier sehen werden. Vizekönig.)
Ich sollte also einen kurzen Besuch in Indien machen und Lord Curzon (Abb. 320) wiedersehen, den ich seit mehreren Jahren kannte und der auch zugegen gewesen war, als ich in London im Dezember 1897 in der Royal Geographical Society einen Vortrag über meine vorige Reise hielt. Da es sich aber um einen Ritt von 400 Kilometern nach Srinagar, der Hauptstadt von Kaschmir, handelte, glaubte ich mir eine zehntägige Ruhe gönnen zu dürfen, ehe ich nach der Sommerhitze im Märchenlande aufbrach. Die Tage verrannen nur zu schnell. Ich wurde von den in Leh ansässigen Missionaren Ribbach und Hettasch und ihren Frauen mit Freundschaftsbeweisen und Gastfreundschaft überhäuft, ebenso von Miß Baß und dem Missionsarzt E. Shawe, der sich der Kranken in meiner Karawane mit unendlicher Freundlichkeit annahm. Täglich besuchte ich die Missionare und ich habe selten eine Station gesehen, die so musterhaft geleitet wird und so[S. 350] vielversprechende Früchte gezeitigt hat. In dem netten kleinen Kirchensaale feierten wir zusammen Weihnachten. Der Saal strahlte hell im Kerzenscheine, und der Weihnachtsbaum mit seinen zahllosen kleinen Wachslichtern gemahnte mich an viele unvergeßliche liebe Kindheitserinnerungen aus meiner nordischen Heimat. Ribbach predigte in der Ladakisprache, und beim Gesang stimmte die andächtig lauschende, festlich gekleidete Schar ein, die das kleine Gotteshaus dicht gedrängt füllte. Ich bin selten bei einem so ergreifenden, feierlichen Gottesdienst zugegen gewesen, obwohl ich von dem, was Ribbach sagte, nicht ein Wort verstand. Der freundliche Glanz der Christbaumlichter nahm meine Sinne gefangen, die weichen Orgelklänge berauschten mich, — ich hatte ja so unendlichen Grund zur Dankbarkeit, jetzt da alle unsere Mühseligkeiten zu Ende waren und ich mich wieder unter Europäern befand!
Am ersten Weihnachtstage langte meine Karawane an. Die letzten neun Kamele hatten den Paß Tschang-la glücklich überwunden. Jetzt sollten sie sich ausruhen und herrlichen frischen Klee zu fressen erhalten; ihre Krippen sollten beständig davon duften, sie sollten wie unsere eigenen Kinder gepflegt und für alles, was sie durchgemacht hatten, belohnt werden. Sie sahen ängstlich und erstaunt aus, als sie durch den Straßenlärm zogen (Abb. 321); aber auf unserem stillen Hofe fühlten sie sich bald heimisch, und ich sah ihre Augen vor Freude glänzen, als sie den Duft des reichlichen, saftigen Futters verspürten. Die Bewohner der kleinen Stadt, die wohl noch nie Kamele gesehen hatten, kletterten auf die Mauern des Hofes und betrachteten diese seltsamen, langhalsigen, buckligen Tiere mit größtem Erstaunen.
Jetzt wurde folgender Entschluß gefaßt. Während meiner Reise nach Indien sollte sich die Karawane ausruhen. Dazu brauchte ich nur drei von den Muselmännern zu behalten, und es paßte daher gut, daß die übrigen baten, sofort über das Kara-korum-Gebirge und Jarkent nach Hause zurückkehren zu dürfen. Sie erhielten ihren Lohn mit großer Zulage und außerdem Kleider, Proviant und je ein Reitpferd als Geschenk. Ich mietete für sie einen Mann aus Jarkent als Karakesch, der es übernahm, sie für eine bestimmte Summe nach Jarkent zu bringen. Als Sirkin, der sich nach Frau und Kindern sehnte, fragte, ob er sie begleiten dürfe, erlaubte ich ihm dies um so lieber, als er dann Briefe an Generalkonsul Petrowskij, bei dem sich meine früher gemachten Sammlungen befanden, überbringen konnte. Hier verließen uns also Mollah Schah, Hamra Kul, Turdu Ahun, Rosi Mollah, Li Loje, Almas, Islam, Ahmed und Ördek, der den besonderen Auftrag hatte, Sirkins Diener zu sein. Mit ihren Packpferden, dem Führer und seinen beiden Dienern bildeten sie eine recht ansehnliche Karawane,[S. 351] als sie am 29. Dezember von Leh fortritten. Trotzdem Sirkin sich aufrichtig nach Hause sehnte, vergoß er doch bittere Tränen, als ich ihm zu einem langen Lebewohl die Hand reichte und ihm für alle die Dienste dankte, die er mir während dieser Jahre geleistet hatte.
Schließlich wurde alles zum Aufbruch bereit gemacht. Tschernoff wurde Chef des Winterquartiers in Leh, Tscherdon Meteorologe, Turdu Bai, Kutschuk und Chodai Kullu, die besten der Muselmänner, sollten die Kamele, die Maulesel und mein altes Reitpferd pflegen. Sie erhielten eine reichliche Geldsumme zur Bestreitung der Haushaltkosten, und Jettumal versprach, dafür zu sorgen, daß es ihnen an nichts fehle. Auch Dr. Shawe und die übrigen Missionare wollten sich während meiner Abwesenheit meiner Leute annehmen. Der Lama, der ebenfalls dort blieb, stand bald auf vertrautem Fuße mit Herrn Ribbach, der sich für den jungen Priester sehr interessierte. Schagdur nahm ich, nachdem ich vom Vizekönig die Erlaubnis dazu erhalten hatte, mit nach Indien. Ich versprach mir ein ganz besonderes Vergnügen davon, Zeuge der Verwunderung des braven Kosaken zu sein über alles, was er in jenem wunderbaren Lande erblicken würde.
[S. 352]
Ich würde nun meinen Bericht schließen können, da wir alte, wohlbekannte Gegenden erreicht haben, die schon vor mir und besser von vielen Reisenden mit klassischen Namen beschrieben worden sind. Wenn ich dennoch einige Schlußworte hinzufüge, geschieht es, damit der Leser meine Spur nicht vollständig verliere und gänzlich im Stiche gelassen werde, während wir noch im Inneren des großen Kontinents sind, welches durch den „Wohnsitz des Winters“, den Himalaja, von dem warmen Meere getrennt wird. Es soll jedoch schnell gehen; vermutlich sehnt sich der Leser ebenso aufrichtig wie ich danach, dieses Reisewerk hinter sich zu haben.
Am Morgen des 1. Januar 1902 stampften vier kleine, muntere Ladakpferde vor meiner Tür. Ich und Schagdur bestiegen zwei von ihnen, die anderen trugen unser Gepäck und wurden von Fußgängern getrieben; Mirsa Muhammed war von Jettumal beauftragt worden, mich zu begleiten.
Wie wunderlich und ungewiß ist doch das Leben, wie viel rätselhafter der Tod! Ich sollte keine Gelegenheit haben, dem Täsildar Jettumal für die vielen Dienste, die er uns leistete, zu danken, denn bei meiner Rückkehr nach Leh war er schon tot und verbrannt und seine Asche in die heiligen Wellen des Ganges gestreut!
Wir hatten bis Srinagar, der Hauptstadt und Sommerresidenz des Maharadscha, 400 Kilometer in 16 Stationen zurückzulegen. Auf jeder Station (Bungalow, Pangla) werden die Pferde gewechselt, manchmal noch öfter; man kann daher so schnell reisen, wie man will. Was mich betrifft, so war ich zu müde, um draufloszustürmen, und legte selten mehr als eine Station pro Tag zurück, so daß wir nach elf Tagen in Srinagar ankamen. Zuerst reiten wir nach Niemo hinunter, dann geht es durch die an Apfel- und Aprikosenbäumen reichen Felder und Gärten von Saspul. Der Indus ist zwischen gewaltigen, wohl 500 Meter hohen Terrassen eingeschlossen, der Weg läuft auf dem rechten Ufer, und die Bilder, die sich nacheinander entrollen, sind großartig; es ist ein wahrer[S. 353] Kunstgenuß, die Meisterwerke zu betrachten, die die Erosionskraft des Wassers hervorgebracht hat. Bald fließt der Indus langsam und ruhig und ist dann breit und tief, bald verengt sich das Bett, und der Fluß bildet schäumende Stromschnellen und wälzt sich mit betäubendem Getöse über abgestürzte Steinblöcke. Gelegentlich ist der Fluß auch zugefroren, und die natürlichen Brücken werden dann von den Eingeborenen benutzt. Schwindelnd hoch und schmal schlängelt sich der Pfad an dem launenhaften Relief der Bergseite hin; ja bisweilen ist er so schmal, daß man einem Entgegenkommenden nicht ohne Gefahr ausweichen könnte; unsere Kulis eilen dann bis zur nächsten Biegung und stoßen durchdringende Rufe aus, um den Weg freizuhalten.
Bei Kalatschi lassen wir das Industal rechts von uns liegen. Wir dringen gleichsam in die dunkeln Säle des Gebirges ein. Der Pfad ist oft gefährlich, zieht sich bald auf der einen, bald auf der anderen Talseite hin und geht auf kleinen, schwankenden Holzbrücken über einen Fluß.
Hinter der Brücke von Sampa-nesrak entspringt eine Quellader aus der Felswand, und das von ihr gebildete Eis bedeckte den Weg wie eine flache Glocke. Hier glitt das eine Packpferd aus und wäre den Berg hinuntergerollt, wenn ich es nicht in demselben Moment, als es über den Wegrand rutschte, am Schwanze gepackt und festgehalten hätte, bis die anderen zu Hilfe kamen.
Das Lamakloster Lamajuru hat eine höchst eigentümliche, malerische Lage; es ist auf dem Gipfel einer von tiefen Furchen durchschnittenen Geröllterrasse erbaut; es kann nur eine Frage der Zeit sein, wann es in die Tiefe stürzen wird, wo, wie stets in Tempelnähe, eine unzählige Menge Votivdenkmäler (Tschorten) errichtet sind.
Am 4. Januar hatten wir über die beiden Pässe Fotu-la (4100 Meter) und Namika-la (3965 Meter) zu reiten, ehe wir in dunkler Nacht Dorf und Bungalow Mullbeh erreichten. Unser Einzug in diesen kleinen Ort war ziemlich phantastisch. Eine ganze Reihe von Fackelträgern zog vor uns her, und von ihren brennenden Fackeln sprühten die Funken kometenschweifartig, und die Aprikosenbäume streckten ihre feuerroten Zweige zum pechschwarzen Himmel auf.
In Kargil, wo wir es mit einem neuen liebenswürdigen, freundlichen Täsildar zu tun hatten, war ich erstaunt, von etwa vierzig festlich gekleideten jungen Mädchen bewillkommnet zu werden. Jede trug eine Schüssel mit etwas Eßbarem; es ist dortzulande Brauch, daß der Fremdling jede Schüssel anrührt — und dabei, wenn er will, einige Silberannas in das Essen legt. Durch ein Telegramm erfuhren wir, daß der Paß Sodschi-la jetzt nicht für gefährlich galt. In Leh hatte man mir gesagt,[S. 354] daß er den Winter hindurch beinahe stets unpassierbar sei und ich wahrscheinlich davor würde umkehren müssen. Diesen Winter aber war der Schneeniedergang außergewöhnlich gering, und durch den Telegraphendraht, der über den Paß läuft, konnten wir an mehreren Punkten Auskunft erhalten. Von Kargil nahmen wir einen Ladaki namens Abdullah mit, der die Turki- oder, wie man hier sagt, Jarkendisprache beherrschte und ein außerordentlich zuverlässiger Führer war. In dem Dorfe Dras bekamen wir etwa fünfzig Kulis, die den schmalen, eisbedeckten Weg mit Brechstangen und Spaten verbessern sollten. Das Stationshaus Mattschui liegt ganz in der Nähe des Passes, — ein Segen für diejenigen, die eingeschneit werden. Dies passierte vor einigen Jahren, als das Haus noch nicht erbaut war, dem früheren Wesir Wesarat von Ladak. Er mußte mit einer großen Anzahl Kulis zwei Monate dort bleiben und wäre vor Hunger beinahe umgekommen. Er hatte sich durch Erpressungen verhaßt gemacht, und die Bevölkerung auf beiden Seiten des Passes freute sich darüber, daß er für eine Weile festsaß.
Am 9. Januar gingen wir über den Sodschi-la, den schlimmsten Paß, den ich je kennen gelernt habe, obgleich seine Höhe nur 3500 Meter beträgt, er also 2000 Meter niedriger ist als die tibetischen Pässe, mit denen wir zu tun gehabt haben. In Mattschui ließen wir unsere Pferde zurück und gingen zu Fuß in dem Schnee, der nach der −22 Grad kalten Nacht munter knarrte. Die Ladakis banden uns eine Art weicher Schneeschuhe an die Stiefel, damit wir nicht ausgleiten sollten. So stapften wir in ihren Spuren nach der außerordentlich flachen, beinahe unmerklichen Paßschwelle. Nicht weit hinter dieser geht es jedoch kopfüber einen jähen Abhang in Hunderten von Zickzackbiegungen nach dem Stationshause Baltal hinunter. Da heißt es aufpassen und nicht das Gleichgewicht verlieren, — ein einziger Fehltritt, und man würde in die Tiefe stürzen und dort zerschmettert werden. Der Schnee ist in der Sonne aufgetaut und dann wieder gefroren, so daß er eine gefährliche Eisstraße bildete, in die unsere Kulis Kerben schlugen. Der Paß Sodschi-la ist eine wichtige orographische und klimatische Grenzschranke zwischen Tibet und Kaschmir. Steht man auf seiner Schwelle, so hat man das Tal von Baltal unter sich und freut sich, den dunkeln Nadelholzwald zu sehen und sein geheimnisvolles, nordisches Rauschen zu hören.
Ich werde nicht versuchen, die hinreißende Landschaft zu beschreiben, die wir in den beiden letzten Tagen durchritten: dunkelgrüne Wälder, malerische Dörfer, schäumende Flüsse, pittoreske Brücken, ein Hintergrund von blendenden Schneebergen und über dem Ganzen ein türkisblauer Himmel. Die Beschreibungen, die ich von Kaschmirs schönen Tälern[S. 355] gelesen habe, erschienen mir matt, als ich sie mit der Wirklichkeit vergleichen konnte.
In Srinagar wurde ich mit echt englischer Gastfreundschaft von Captain E. Le Mesurier und seiner liebenswürdigen Gattin aufgenommen und verbrachte bei ihnen zwei unvergeßliche Tage. Am 14. Januar stand die erste Tonga, ein zweiräderiger Wagen, auf dem Hofe bereit. In Srinagar waren wir in 1600 Meter Höhe; jetzt sollten wir über zwei kleinere Pässe immer tiefere Gegenden und schließlich Indiens sommerheiße Ebenen erreichen. Der Weg führt zuerst durch das Jelumtal, dann über den Murreepaß und darauf nach Rawal-pindi. Er ist ein Meisterstück der Wegebaukunst.
Es ist ein raffiniertes, beinahe wildes Vergnügen, diese tausend Krümmungen in schwindelnder Fahrt zurückzulegen. Die Tonga wird von zwei mittelgroßen Rädern getragen und ist mit Dach und Seitenvorhängen versehen. In der Mitte sind zwei Sitze mit gemeinsamer Rücklehne. Auf dem vorderen saßen der Kutscher und ich, auf dem hinteren Schagdur mit dem Gepäck. Die starke, ein wenig aufwärtsgebogene Deichsel trägt an ihrem äußersten Ende ein Querholz, das mit Riemen an den Sattelkissen der Pferde befestigt wird. Dank dieser praktischen Einrichtung geht der Pferdewechsel in zwei, drei Minuten vor sich. Die Entfernung zwischen zwei Stationen beträgt selten mehr als eine halbe Stunde. Ein paar Minuten vor der Station bläst der Kutscher auf seinem Horn ein kurzes, angenehm klingendes Signal, und wenn wir dann vor das Haus sprengen, steht das neue Pferdepaar schon bereit. Das Querholz wird den schnaubenden, dampfenden Pferden abgenommen, die neuen werden unter die Enden der Querdeichsel gestellt, die Riemen werden geschnürt, und dann eilen die lebhaften, halbwilden Tiere davon. Sie stürmen mit so wahnsinniger Geschwindigkeit vorwärts, daß man unwillkürlich das Gefühl hat, es könne jeden Augenblick eine Katastrophe eintreten. Gewöhnlich muß der Kutscher sich viel mehr bemühen, die Pferde zurückzuhalten, als daß er nötig hätte, sie anzutreiben, und ich bin mir nicht immer darüber klar, ob sie durchgehen oder ob alles Absicht ist. Solange wir von Srinagar nach Baramullah durch offene Felder fuhren, war es nicht gefährlich, doch als sich der Weg nachher auf den Gehängen des Jelumtales hinschlängelte, hatte man Gelegenheit, schwindelig zu werden, wenn man dazu neigt. Die Pferde rasen vorwärts; rechts von uns geht es senkrecht nach dem in der Tiefe rauschenden Flusse hinunter, nur eine zwei Fuß hohe Brustwehr trennt uns von dem jähen Abgrund; vor uns scheint der Weg auf einmal ein Ende zu nehmen, doch dies kommt davon, daß er in scharfem Winkel nach links abbiegt. Man meint, der Kutscher müsse verrückt sein, daß er die Pferde[S. 356] nicht zügelt und langsamer fährt; die wilde Jagd geht gerade nach dem Abgrunde hin, und wenn auch die Pferde allenfalls noch um die Ecke zu schwenken vermögen, so muß doch der Wagen umkippen und über die niedrige Brustwehr geschleudert werden. Im letzten Augenblick vermindert sich indessen die Geschwindigkeit, es geht ganz glatt um die Ecke, und man ist erstaunt, daß man lebendig an ihr hat vorbeikommen können. Vor solchen Ecken ertönen stets die hellen Klänge des Jagdhorns als Warnungssignal, falls von der anderen Seite eine Tonga mit ebenso wütender Fahrt auf die Ecke losstürmen sollte.
In der Nähe des Murreepasses war der Nadelholzwald dicht, wodurch das Großartige dieser Fahrt, die unter seinem prachtvollen, schattigen Gewölbe hinstürmte, noch erhöht wurde. Vom Passe ahnen wir im Süden die Ebenen des Pendschab; mit gleicher schwindelnder Fahrt eilten wir nach immer tieferen Gegenden hinab, immer dichter werden die Luftschichten, immer linder die milden Windhauche, die bei Sonnenuntergang die Hügel umspielen. Es war schon dunkel, als das letzte Pferdepaar unsere Tonga durch die langen, geraden Straßen von Rawal-pindi führte. Wir fuhren direkt nach der Eisenbahnstation, denn es fehlte nur noch eine Stunde bis zum Abgang des Zuges. Es klingt seltsam, wenn man wieder die schrillen Pfiffe der Lokomotive hört, nachdem man jahrelang an den Frieden und die Stille der Einöden gewöhnt gewesen ist!
In Lahore blieb ich drei Tage — inkognito, denn ich hatte in meinem ganzen Gepäck nicht einmal einen Strumpf, mit dem ich mich vor den Leuten hätte sehen lassen können. Hier kleidete ich mich vom Scheitel bis zur Sohle neu ein und war im Handumdrehen wieder ein vollkommener, wenn auch ein wenig wettergebräunter, sonnverbrannter Gentleman! Jetzt war kein Inkognito mehr nötig; den letzten Abend war ich zu einem glänzenden Diner bei Sir W. Mackworth Young, dem Vizegouverneur des Pendschab, und mir war zumute, als sei ich mein ganzes Leben lang nie etwas anderes gewesen als ein Salonlöwe!


Was soll ich von Lahore, Dehli, Agra, Lucknow und Benares sagen? Nichts! Ich überlasse es denjenigen, die zum Studium dieser märchenhaft wunderbaren Städte Zeit gehabt haben, über jede von ihnen Bände voll zu schreiben. Ich passierte sie wie ein Zugvogel und blieb in jeder nur einen oder ein paar Tage. Ich flog wie eine Wildente über den Tadsch Mahal, fand aber auf der Durchreise noch Zeit, diese Grabmoschee Schah Dschahans als das schönste Kunstwerk, das ich je erblickt habe, anzustaunen und zu bewundern. Alles, was ich in Konstantinopel, Ispahan, Mesched und Samarkand gesehen habe, verschwindet und verbleicht dagegen. Es ist ein Sommertraum in weißem Marmor, eine Luftspiegelung von[S. 357] versteinerten Wolken. Und Benares! Nie vergesse ich die Bootfahrten, die ich längs seiner Kais und Treppen machte, jener Treppen, wo Tausende von Pilgern jeden Morgen bei Sonnenaufgang baden, um Gesundheit und Kräfte wiederzugewinnen, und die Brahminen, die dem Flusse huldigen und hier ihre Gebete verrichten, und die Greise, die hierherreisen, um an dem heiligen Ganges zu sterben. Nichts läßt sich mit einer Ruderfahrt im Mondschein auf dem Ganges vergleichen; tausend Phantasien und Träume aus der Märchenwelt von Benares bestürmen den Fremdling in der Stille der Nacht.
Schagdurs immer größer werdendes Staunen war für mich eine Quelle großen Vergnügens. Einem burjatischen Kosaken aus Sibirien muß alles, was er in den alten Residenzen des Großmoguls, unter Palmen, in Pagoden, sowie in den von einer bunten, lärmenden Menschenmenge erfüllten Basaren erblickt, im höchsten Grade imponieren. Er befragte mich über alles, was er sah, teilte mir seine Gedanken und Beobachtungen mit und konnte keine Worte finden, um sein Erstaunen und seine Bewunderung auszudrücken. Als wir in Lucknow einem Zuge Elefanten begegneten, wollte er kaum seinen Augen trauen und fragte mich, ob diese Kolosse wirklich lebendige Tiere oder nicht vielmehr eine besonders konstruierte Art von Lokomotiven seien. Um ihn zu überzeugen, ließ ich eines der Tiere stehenbleiben, kaufte in einer Basarbude in der Nachbarschaft ein Bündel Zuckerrohr und fütterte das Vieh. Als dieses erst jedes Rohr mit dem Rüssel reinigte und die weniger gutschmeckenden Teile abbrach, um dann den Rest mit virtuosenhafter Eleganz zu verzehren, sah Schagdur ein, daß der Elefant ein wirkliches, lebendiges Tier war.
Am 25. Januar kam ich frühmorgens in Kalkutta an und wurde in einer vizeköniglichen Equipage mit vier Lakaien in rotgoldener Uniform und hohen weißen Turbanen vom Bahnhof abgeholt. Ein zweites Gefährt beförderte Schagdur und das Gepäck. Wir fuhren direkt nach dem Government House, wo mir meine Wohnung angewiesen wurde. Niemals habe ich so vornehm residiert wie in der Residenz des Vizekönigs von Indien. Die Salons sind mit wertvollen Kunstgegenständen geschmückt, man geht auf weichen indischen Teppichen, die Wände verschwinden unter großen Ölbildern von Großbritanniens Monarchen, indischen Maharadschas und persischen Schahen, alles prunkt in einem Meere von elektrischem Licht. Mein riesiges Schlafzimmer hatte seinen eigenen Balkon, der unter einer mächtigen Markise in kühlem Schatten schwebte. Berauscht vom Palmendufte des Parkes konnte ich mich an der großartigen Aussicht über Kalkutta erfreuen und den Blick weithin bis an das Dschungel des Hugli schweifen lassen.
[S. 358]
Der Tag meiner Ankunft war ein Sonntag, und mir wurde sofort von einem Adjutanten mitgeteilt, daß „His Excellency, the Viceroy“ mich auf Schloß Barrakpore, zwei Stunden flußaufwärts, erwarte. Bei schönem Sommerwetter und einer leichten, erfrischenden Brise fuhr ich nach dem Frühstück mit einer Dampfbarkasse hin und hatte dort die liebenswürdigste Gesellschaft, die man sich nur wünschen kann.
Eingebettet in einen tropisch schönen Park und geschmückt mit englisch vornehmer und geschmackvoller Pracht öffnete Barrakpore den anlangenden Gästen die Tore der Gastfreundschaft. Die Wirte erwarteten uns mit ihren beiden kleinen reizenden Töchtern und ihrem Gefolge in dem kühlen Schatten einer gewaltigen Laube, und Lord Curzon begrüßte mich so liebenswürdig und warm wie ein alter Freund; er stellte mich seiner charmanten Gemahlin vor, der schönsten und sympathischsten Dame, die ich je kennengelernt habe. Beim Lunch brachte er in schäumendem Champagner ein Hoch auf mich aus und gratulierte mir zu den gewonnenen Resultaten und den glücklich überstandenen Mühen. Nachdem wir einige Stunden über geographische Fragen gesprochen hatten, wurde ich von Lady Curzon zu einer Spazierfahrt in die Umgegend aufgefordert, und meine Wirtin führte dabei die Zügel mit ebensoviel Grazie wie Sicherheit.
Die zehn Tage, die ich in Lord und Lady Curzons Hause Gast zu sein die Ehre hatte, gehören zu meinen liebsten und schönsten Erinnerungen. Nicht allein, daß ich täglich mit Freundschaft und Gastfreundschaft überhäuft wurde, nein, ich fand auch in meinem Wirte, der einer der ersten jetzt lebenden Kenner der Geographie Asiens ist, einen Mann, der meine Reise mit dem sachverständigsten und lebhaftesten Interesse erfaßte.
In Europa macht man sich kaum einen Begriff davon, was es heißen will, Vizekönig von Indien zu sein und beinahe souveräne Macht über dreihundert Millionen Untertanen zu besitzen, also fast ebenso viele, wie allen Monarchen Europas zusammengenommen gehorchen. Es ist eine glänzende, eigenartige Stellung, und man bewundert ein Reich, das seinen Söhnen Gelegenheit geben kann, nach solchen Posten zu streben.
Lord Curzon fühlt die auf ihm lastende Verantwortung und faßt seinen Beruf mit tiefem Ernste auf, er opfert ihm alle seine Zeit und Kräfte. Er gönnte sich keine Ruhe, er war wie festgenagelt an seinen Schreibtisch und machte nur bei den Mahlzeiten eine kleine Arbeitspause. Mit Sport und eiteln Vergnügungen verlor er keine Stunde, — als wir einmal zusammen das Theater besuchten, wo der Vizekönig mit der Nationalhymne begrüßt wurde, verschwand er noch vor Schluß des ersten Aktes, um in sein Arbeitskabinett zurückzukehren. Wir nahmen einmal alle Kartenblätter, wohl hundert, die ich von Ladak mitgebracht hatte, durch; jedes Blatt wurde[S. 359] besonders geprüft, und Lord Curzons Urteil konnte mir nur in höchstem Grade schmeichelhaft und erfreulich sein.
Während meines Aufenthalts wurden ein paar Festdiners und große Bälle im Government House gegeben, das in blendender Pracht strahlte; es ging bei dieser Gelegenheit ebenso glänzend her wie an einem europäischen Fürstenhofe. Eines Tags kamen ein deutsches und ein österreichisches Kriegsschiff den Hugli herauf, was Veranlassung zu einem Frühstück für die Offiziere im Government House gab, dem mehrere Feste auf den Schiffen und im deutschen Klub folgten.
Wohl hatte ich während meiner neunjährigen Wanderungen in Asien mancherlei erlebt, aber noch keinen solchen Kontrast, wie ich ihn jetzt durchmachte. Zweieinhalb Jahre lang hatte ich, von der Welt abgeschnitten, in den Wüsten und Gebirgen des innersten Asiens gelebt und Strapazen und Entbehrungen jeglicher Art ertragen müssen, und jetzt befand ich mich inmitten der verfeinertsten Zivilisation, die man sich denken kann. Nach Jahren der Einsamkeit wurden jetzt bei jedem Schritt neue Bekanntschaften gemacht. Eben noch wanderte ich bei 30 Grad Kälte über 5000 Meter hohe Gebirge, wo nur das Archari und der wilde Yak ihre Nahrung finden, und jetzt wandelte ich in lauter Wärme und Licht unter den Palmen an der Küste des Indischen Ozeans. Eben noch hatten wir die schmutzigen, rauchigen Zelte der Tibeter besucht, jetzt entzückten mich in englischen Salons der Duft schwellender Rosen, liebenswürdige Damen und Musik. Die Tibeter hatten mich wie ein verdächtiges, gefährliches Individuum behandelt, in Indien ertrank ich beinahe in Gastfreundschaft; jedesmal, wenn ich einen Ort verließ, mußte ich mich aus freundlichen Armen losreißen, um am nächsten wieder mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Überall fühlte ich mich „at home“, und es wurde mir stets schwer, meine neuen Freunde zu verlassen; dieses ewige Abreisen und Abschiednehmen breitete einen Wehmutsschleier über eine sonst so angenehme, erinnerungsreiche Reise.
Die indische Presse hatte mir so viel liebenswürdige Aufmerksamkeit geschenkt, daß ich mit Einladungen buchstäblich überhäuft wurde — nach Dardschiling, Ceylon, Mysore, Peschawar, zu meinem alten Freunde von Kaschgar (1890) Major Younghusband, nach schwedischen Missionsstationen usw. Doch ich durfte meine Karawane und die Kosaken, die mich in Leh erwarteten, nicht vergessen. Einigen Einladungen konnte ich allerdings nicht widerstehen, und mein Aufenthalt in Indien wurde dadurch etwas verlängert. Leider war mein prächtiger treuer Kosak Schagdur am Fieber erkrankt und während des ganzen Aufenthalts in Kalkutta sehr schwach. Er lag im Parke in einem geräumigen, eleganten Zelte — mit Bretterfußboden,[S. 360] Badezimmer und elektrischem Licht — und wurde vom Leibarzt des Vizekönigs, Oberst Fenn, selbst und dem Assistenzarzte Emir Baksch behandelt. In ihrer Pflege mußte ich Schagdur zurücklassen, als ich südwärts reiste. Wir wollten uns in Rawal-pindi wiedertreffen.
Nach herzlichem Abschied von Lord und Lady Curzon verließ ich am 5. Februar Kalkutta und reiste nach Secundrabad bei Hyderabad. Ich hatte eine Einladung meines vortrefflichen ritterlichen Freundes von der Pamirgrenzkommission im Jahre 1895, Oberst McSwiney, angenommen. Er war jetzt nach dem Militärlager Belarum im Gebiet des Nizam, wo ungefähr 8000 Mann englische Truppen stehen, versetzt worden. Es waren drei angenehme Tage, die ich in McSwineys Hause verlebte.
In Bombay war ich eingeladen worden, bei dem Gouverneur Lord Northcote und seiner Gattin zu wohnen. Auch die vier in ihrem Heim verbrachten Tage gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen. Meine Wohnung lag auf der äußersten Spitze von Malabar Point; ringsumher hatte ich den unendlichen Ozean. Es war mir, als sei ich an Bord eines Schiffes — ein seltsames Bild für den, der jahrelang im Inneren des großen Asien gelebt hat. Ich wurde nicht müde, dem rauschenden Sange der Wellen am Fuße des felsigen Vorgebirges zuzuhören. Wie gern hätte ich mich von ihnen über die Meere nach meiner alten Heimat tragen lassen, statt, wie jetzt, noch einmal durch den Kontinent zu ziehen und nach den schweigenden, unwirtlichen Gebirgen in Westtibet zurückzukehren! Die Postdampfer fuhren von Zeit zu Zeit unmittelbar unter dem Vorgebirge vorbei; sie gingen direkt nach Europa, und auf ihrem Deck konnte ich geraden Weges dorthin gelangen. Ich hatte von Asien genug und es graute mir davor, wieder quer durch die alte Welt ziehen zu müssen — auf dem Landwege von Bombay nach Petersburg und Stockholm! Es erforderte eine gute Portion Energie, um der Versuchung nicht nachzugeben. Aber ich konnte die Kosaken und die Karawane nicht verlassen und das Resultat meiner Reise nicht allen Winden preisgeben, sondern mußte alles in Sicherheit bringen, ehe ich mich ruhig fühlen durfte. Ich nahm also Abschied von Lord und Lady Northcote und kehrte nach Dehli zurück.
Die Reise nach Rawal-pindi machte ich mit nur zwei kurzen Unterbrechungen. In Dschaipur holte mich die Equipage des Maharadscha ab, und ich machte auf einem seiner prachtvoll geschmückten Elefanten einen herrlichen Ausflug nach den Ruinen von Amber. In Dschaipur sind alle Häuser rosenrot, alle Einwohner rot oder rosa gekleidet, — man muß an das Morgenrot in einem Rosengarten denken.



Der Maharadscha von Kapurtala hatte mich telegraphisch nach seinem Schlosse in Kartarpur eingeladen, wo ich zwei schöne Tage verlebte und[S. 361] in Gesellschaft Seiner Hoheit Ausflüge zu Wagen, Boot und Elefant machte. Ganz im selben Stile feierte er meinen Geburtstag auf seinem Schlosse mit Tafelmusik und schäumendem Champagner. Der Aufenthalt in Kartarpur erinnerte lebhaft an Tausendundeine Nacht.
In Rawal-pindi fand ich meinen armen Schagdur wieder, der infolge seiner Krankheit nicht soviel Vergnügen von der Indienreise gehabt, wie ich gehofft hatte. Oberst Fenn war so freundlich gewesen, ihn mit einem eingeborenen Assistenzarzte von Kalkutta nach Rawal-pindi zu schicken, wo Hauptmann Waller und Major Medley, der bekannte Asienreisende, ihn mit großer Freundlichkeit aufnahmen und ihm alle die Pflege, deren er bedurfte, zuteil werden ließen. Schagdur war entzückt von Medley, der sich mit ihm täglich lange russisch unterhalten hatte. Der Arzt, Major Marshall, der ihn behandelte, riet mir, ihn so schnell wie möglich ins Gebirge zu bringen. Bei meiner Ankunft war dies jedoch unmöglich, denn er war so schwach, daß er sich nicht auf der Tonga festhalten konnte. Ich mußte daher geduldig warten. Ich selbst hatte es sehr gut; die Offiziere wetteiferten förmlich, mir Gastfreundschaft zu erzeigen. Leider wurde mir nicht die Freude zuteil, Herrn Dr. Stein, der sein Hauptquartier in Rawal-pindi hat, zu treffen. Er war kürzlich von seiner erfolgreichen, bedeutungsvollen Forschungsreise in Ostturkestan zurückgekehrt. Ich konnte aber seine Bekanntschaft wenigstens brieflich machen und traf ihn später, ehe noch das Jahr 1902 zu Ende gegangen war, persönlich in London.
Endlich war Schagdur soweit hergestellt, daß wir aufbrechen konnten. Wir fuhren auf dieselbe Weise wie vor zwei Monaten nach Srinagar.
Dank der großartigen Gastfreundschaft des Herrn Le Mesurier und seiner Gattin konnte Schagdur hier in der frischen, kühlen Luft von Kaschmir, die ihm bald seine Gesundheit wiederschenkte, noch fünf Tage ausruhen. Hauptmann und Frau Le Mesurier waren neben Dr. Shawe die ersten und die letzten Engländer, die ich während dieses hastigen, aber langen Abstechers nach Indien traf. Der erste Eindruck, den ich von der herrschenden Rasse in Indien erhielt, war daher warm und sympathisch, und als ich sie wieder verlassen sollte, nahm ich mit aufrichtigem Bedauern Abschied. Sie waren grenzenlos freundlich und liebenswürdig gegen mich und meinen Kosaken gewesen. Der Hauptmann, der „Joint Commissioner“ für Ladak ist, telegraphierte nach allen Stationen auf dem Wege nach Leh, damit alles zu unserer Reise in Ordnung wäre, und ordnete an, daß auf dem Sodschi-la besondere Vorsichtsmaßregeln getroffen würden.
[S. 362]
Am 6. März ging es wieder nach Leh hinauf. Ich mietete zwei Tragstühle mit je acht Trägern und benutzte den meinen, solange es möglich war; aber Schagdur hatte, obwohl Rekonvaleszent, einen ausgesprochenen Widerwillen gegen dieses Beförderungsmittel und zog es vor zu reiten.
In Sonamarg erhielt ich Warnungstelegramme von Le Mesurier, dem Wesir Wesarat, aus Kargil und aus Leh, ja nicht über den Sodschi-la zu gehen, da jetzt sehr viel Schnee gefallen sei. Le Mesurier war so liebenswürdig, mich zu bitten, nach Srinagar zurückzukehren. Doch ich mußte um jeden Preis über den Paß. Er ist von der indischen Seite viel schwieriger, da man die unheimlichen Abhänge zu Fuß erklimmen muß. Jetzt konnten wir auch nicht, wie auf der Hinreise, den Sommerweg benutzen, sondern mußten in der tiefen Kluft gehen, in welche die Lawinen jeden Winter von den Felswänden stürzen und wo alljährlich so viele Unglückliche begraben werden. Große Vorsicht ist stets nötig; man muß sich frühmorgens auf den Weg machen, wenn die Schneemassen noch gefroren sind; nachmittags stürzen sie, von der Sonne aufgeweicht, herunter. Bei Schneewetter darf man unter keiner Bedingung nach dem Passe hinaufgehen, denn dann hat man große Aussicht, unter den Lawinen begraben zu werden. An den gefährlichsten Stellen dieses Hohlweges muß man möglichst schnell vorbeieilen.
Am 10. standen wir in aller Frühe auf, als es noch stockdunkel, rauh und kalt war. Die Sterne glänzen hell an dem stahlblauen, kalten Himmel, die Berge mit ihren Schneemassen zeichnen sich in schwachen Umrissen ab. Völlige Ruhe herrscht, einige Fackeln auf dem Balkon flackern nicht einmal, der Rauch meiner Zigarre steigt lotrecht in die Luft. Im Handumdrehen sind wir reisefertig; 63 Träger und Wegemacher gehen in langem Gänsemarsch voran, dann werden einige Pferde, die den Proviant der Leute tragen, geführt, und hinterdrein reiten wir, von dem Naib-i-täfildar von[S. 363] Ganderbal und seinem nächsten Untergebenen begleitet. Allmählich wird es heller; die weißen Schneefelder treten immer schärfer hervor, und die Tannen stechen dunkel gegen sie ab. Dann und wann purzelt einer in den Schnee; Schritt für Schritt geht es vorwärts und aufwärts durch immer tiefer werdende Schneewehen. Noch war die Kruste der Schneefelder stark genug, um die Fußgänger zu tragen, doch schon am Vormittag brachen diese ein. Da, wo die Pferde keinen Grund fanden, sondern wie Delphine im Schnee hüpften, gingen wir zu Fuß. In Baltal kam uns Abdullah mit 23 sicheren Leuten entgegen.
Am folgenden Tag gingen wir durch den Hohlweg hinauf, der jetzt gar nicht wiederzuerkennen war. Die Massen von Blöcken, die in der Schlucht umherliegen, waren vollständig verschwunden unter herabgestürzten Lawinen, die, wie man mir sagte, den engen Gang mit einer 150 Meter hohen Schneeschicht angefüllt hatten. Solange es Winter ist, kann man oben auf den abgestürzten Schneemassen gehen, im Sommer aber ist dieser Weg unpassierbar. Ich und Schagdur wurden nach dem Passe hinaufgezogen und geschoben. Ein unangenehmer Wind strich wie ein Wasserfall durch den Hohlweg herunter und wirbelte Wolken von feinem Schnee auf (Abb. 322). Nachdem wir die gefährlichen Stellen glücklich passiert hatten, konnten wir uns gänzlich unbesorgt fühlen; aber hier war der tiefe Schnee nicht so festgepackt wie im Hohlwege. Nach jedem Schneefall wird ein Pfad ausgetreten, der aus einer unzähligen Anzahl tiefer Gruben besteht. Kann man balancieren, ohne auszugleiten, so ist es am vorteilhaftesten, auf den zwischen ihnen liegenden Erhöhungen zu gehen, gewöhnlich aber nimmt man gern mit den Gruben vorlieb.
Vier Tage lang trabten wir auf diese Weise über den Paß und seine beiderseitigen Umgebungen. Schließlich konnten wir Yake benutzen und zuletzt uns wieder der Pferde bedienen. In Kargil schneiten wir ein und mußten dort drei Tage bleiben. Man versuchte, uns durch Tänzerinnen und rauschende Musik zu erfreuen. Am 25. März trafen wir wieder in Leh ein, wo wir alles gut und gesund vorfanden. Von Sirkin und Ördek wußte man nichts, aber alle anderen, die an Weihnachten ihren Abschied erhalten hatten, waren wiedergekommen, weil, wie sie sagten, die Pässe verschneit waren. Die beiden erstgenannten gelangten jedoch schließlich gesund und glücklich nach Kaschgar.
Es war meine Absicht, nur ein paar Tage auszuruhen und dann über den Kara-korum-Paß nach Norden zu eilen. Doch böse Mächte hielten uns in Leh zurück. Schagdur bekam einen sehr schweren Rückfall; Dr. Shawe hielt es für Typhus. Der Kranke würde noch ein paar Monate unter keinen Umständen reisen dürfen. Er war entsetzlich abgemagert und matt[S. 364] und phantasierte mehrere Nächte lang. Wir wurden infolgedessen von einem Tage zum andern aufgehalten; daß wir ihn nicht mitnehmen konnten, war klar, aber ich wollte nicht eher reisen, als bis Dr. Shawe ihn außer Gefahr hielt. Einige Tage hindurch hatten wir beinahe die Hoffnung aufgegeben, daß er überhaupt genesen würde. Doch Anfang April fing er an, sich zu erholen; die Krisis war vorüber, und um vollständig wiederhergestellt zu werden, bedurfte er nur noch einige Monate der Ruhe und Pflege in dem Missionskrankenhause, wo Dr. Shawe ihn unter seiner persönlichen Aufsicht hatte. Alles wurde für den Kranken so gut wie möglich eingerichtet. Li Loje erhielt Befehl, bei ihm zu bleiben und sein Leibdiener zu sein; führe er seinen Auftrag gut aus, so solle er in Kaschgar eine Extrabelohnung erhalten. Im Sommer sollten die beiden sich einer nach Jarkent ziehenden Handelskarawane anschließen und sich von dort nach Kaschgar begeben. Schagdur erhielt 200 Rupien zur Bestreitung der Kosten.
Es tat mir bitter weh, Schagdur zu verlassen, als wir am 5. April 1902 aufbrachen. Die Sonne schien so freundlich und warm in sein Zimmer hinein, als ich ihn zum letztenmal sah. Er war allerdings betrübt, daß er uns nicht bis ans Ende der Reise begleiten konnte, aber er sah ein, daß er sich jetzt ruhig verhalten müsse, bis er ganz wiederhergestellt sei. Ich beruhigte ihn und versuchte, ihm alles in hellem Lichte zu zeigen, auch gab ich ihm das Versprechen, ihn, soweit es von mir abhinge, auf meiner nächsten Reise ebenfalls mitzunehmen. Diese Hoffnung hatte ihn stets erfreut; er träumte davon wie von der größten Ehre und Freude, die ihm im Leben zuteil werden könne. Schließlich drückte ich ihm die Hand zum Abschied und befahl ihn in Gottes Schutz; da brach seine Fassung zusammen, er wandte sich ab und weinte. Ich eilte hinaus, um ihn nicht sehen zu lassen, daß auch meine Augen feucht glänzten und wie tief und schmerzlich mir diese lange Trennung zu Herzen ging. Auch von den Familien Ribbach, Hettasch und von Dr. Shawe schied ich mit aufrichtigem Bedauern. Sie hatten mir in so vieler Weise genützt und geholfen, und ich hatte in ihrer Missionsstation das Ideal einer solchen Anstalt kennengelernt.
Leicht war es auch nicht, unseren alten, treuen Veteranen Lebewohl zu sagen, den letzten neun Kamelen, die allein noch imstande gewesen waren, Leh zu erreichen, und die sich während der drei Wintermonate so von ihren Anstrengungen erholt hatten, daß sie jetzt dick, fett und vergnügt vor ihren Krippen standen. Aber es mußte sein; sie konnten im Winter nicht über den Kara-korum gehen. Ich verkaufte sie für einen Spottpreis an einen Kaufmann aus Jarkent, wohin sie im nächsten Sommer gebracht werden sollten.


War es ein großer Kontrast gewesen, von einem tibetischen Winter[S. 365] in 5000 Meter Höhe in den Sommer Indiens am Meer zu gehen, so war der Übergang nicht weniger schroff, als er jetzt in umgekehrter Weise stattfand. Eigentlich war es wunderbar, daß ich von jeder Spur von Fieber verschont blieb, aber ich war dafür sehr müde und sehnte mich nach meiner friedlichen Studierstube in Stockholm. Ich beschloß daher, mich jetzt, solange es anging, d. h. bis an den Fuß des Tschang-la-Passes, wieder des Tragstuhls zu bedienen. Von vier starken Männern getragen, schaukelte ich von Leh ab. Der Palast der früheren Könige auf seinem Felsen und die kleine malerische Stadt verschwanden bald hinter den Hügeln, als sich die Männer, einen charakteristischen Wechselgesang singend, mit raschen Schritten dem Indus näherten. Der Führer singt eine kurze Strophe, und die anderen fallen mit einem eintönigen, einschläfernden Kehrreime ein, aber der Gesang treibt sie und hilft ihnen, im Takt zu gehen.
Am 6. gingen wir am linken Indusufer aufwärts. Als Begleiter hatte ich nur den Lama und Kutschuk; die Karawane mit ihren gemieteten Pferden marschierte auf der großen Heerstraße nach dem Tschang-la und folgte dem rechten Flußufer.
Schließlich verlassen wir den Indus, ziehen nach Süden und Südwesten den Geröllkegel der südlichen Bergkette hinauf und treten in die Mündung des Hemistales ein. Wir passieren eine Menge malerisch ornamentierter Tschorten und ganze Reihen von runden und länglichen Steinkisten. Das Tal wird immer enger und die Richtung beinahe westlich; zwischen den grauen Felswänden wirken einzelne Pappelgruppen sehr hübsch, und im Hintergrund zeigt sich das schneebedeckte Hochgebirge.
Jetzt wird der berühmte Tempel Hemis unseren Blicken sichtbar; er ist am besten mit einer Masse zusammengedrängter amphitheatralisch gebauter Häuser, die wie Schwalbennester an dem Abhange kleben, zu vergleichen. Durch Höfe, Gänge und über gewundene Steige mit Geländern gelangen wir an eine kleine Pforte in der Mauer; hier heißt uns der Prior von Hemis freundlich willkommen. Es war ein alter Mann mit dünnem, grauem Bart und großer, dicker Nase (Abb. 327); sein Lächeln war ebenso heiter wie gütig. Sein Name und Titel war Ngawand Tschö Tsang, Hemi Tschaggtsot.
Nun beginnt die Runde in diesem Klosterlabyrinth von dunkeln Löchern und Kammern, Höfen und Gängen, Korridoren und steilen, engen Steintreppen, die von einer Tempelterrasse zur anderen führen (Abb. 323). Es wäre schwer, eine auch nur annähernd orientierende Beschreibung von dem eigentümlichen Gebäudekomplex zu geben. Eine bestimmte Ordnung herrscht in der Architektur nicht; die verschiedenen würfelförmigen Häuser scheinen nach und nach überall, wo nur der kleinste Platz dazu war, hingebaut worden[S. 366] zu sein. Man wird aufgefordert, durch eine Pforte zu treten, und es geht einen schmalen Weg bergauf, der, zwischen Mauern eingeschlossen und mit Steinplatten gepflastert, um eine Ecke biegt und sich in einen wagerechten dunkeln Gang verliert, der seinerseits auf eine Reihe kleiner Höfe ausmündet. Man steigt eine sehr steile Treppe hinauf, wirft einen Blick in einen Tempelsaal hinein, wo die vergoldeten Götterbilder matt im Halbdunkel glänzen; man wird auf eine Terrasse hinausgeführt, ist von der herrlichen Aussicht hingerissen und meint, es sei ein Wunder, daß noch kein Bergrutsch von der hinter dem Tempel liegenden Felswand die ganze Tempelstadt in Trümmer gelegt hat, dann wird man wieder eine Treppe hinaufgeführt, durch neue Gänge und Winkel bis in die Unendlichkeit, bis einem der Kopf schwindelt. Man muß sich wie in einem Irrgarten oder einer verzauberten Höhle verlieren. Es war leichter, sich im Government House zu Kalkutta zurechtzufinden, obgleich es einige Zeit dauerte, bis ich dort Bescheid wußte. Hier in Hemis aber können sich nur Mönche auskennen.
In dem ersten Saale, der mir gezeigt wurde und dessen Decke malerische Säulen trugen, thronte der Gott Dollma, mit großen, stechenden Augen. Vor dem Gotte, der 300 Jahre alt sein soll, standen auf Tischen ganze Batterien von Messingschalen mit Wasser, Reis, Gerste, Mehl, Fett und Butter. Von dem zweiten Saale machte ich in aller Hast eine Zeichnung, die hier wiedergegeben ist. Er soll der vornehmste in Hemis sein; zwei Lamas knieten vor Doggtsang Raspas vergoldetem, mit einem Mantel bekleideten Bilde (Abb. 324, 325). Rechts von ihm sitzt der Lama Jalsras, links Sandschas Schaggdscha Toba. Die Tempelsäle, sieben an der Zahl, heißen „Dengkang“ (mongolisch Doggung) und die Kammern, wo die Mönche ihre „Nom“ (heiligen Schriften) studieren, werden „Tsokkang“ (mongolisch Sume) genannt.
In einem gewaltigen, becherförmigen Messinggefäß, „Lotschott“, brennt in einer Vertiefung in gelbem Fett eine kleine Flamme, die ein Jahr lang nicht erlischt. Fahnenähnliche, religiöse Gemälde schmücken oft in mehreren Schichten die Wände, und von den Decken hängen „Tschutschepp“ genannte Draperien; an den Säulen flattern lange, in drei Zungen auslaufende, als „Pann“ bezeichnete Bänder, und über den Götterbildern schweben sonnenschirmartige Thronhimmel. Trommeln, Glocken, Götter, Messingbecken und lange Blashörner gehören zur Ausstattung; man wandelt gleichsam in einem Museum umher, das man aus dieser im Gebirge versteckten Krypte entführen und mit nach Hause nehmen möchte. Die Büchergestelle biegen sich unter Bänden der „Nom“. In gleicher Weise sind die übrigen Säle mit Götterbildern und „Tschurden“ von Silber mit Rubinen, Türkisen und Gold bevölkert. Durch eine Falltür im Fußboden des einen[S. 367] Saales konnte man in das „Bakkang“, das Zeughaus oder die Rüstkammer, hinabsteigen, wo alle Gewänder, Masken, Hüte, Speere, Trommeln, Posaunen und Blashörner, die man zu den Anfang Juli stattfindenden Festtänzen brauchte, aufbewahrt wurden. Einige Lamas kleideten sich in ihre Festgewänder und standen mir freundlich Modell, während ich sie abzeichnete (Abb. 326, 328). Während des Sommerfestes wird das „Tabbtsang“ oder Küchenhaus benutzt, wo fünf kolossale und mehrere kleine Kessel in einen Herd eingemauert sind (Abb. 329).
Es wimmelte während der Runde um uns her von rotgekleideten Lamas, aber der Prior zeigte uns alles selbst und benahm sich dabei mit imponierender Würde. Sodann führte er uns nach unseren Gastzimmern in einem kleinen, eleganten und behaglichen Pavillon unterhalb des Klosters. Abends besuchte ich ihn in seiner Zelle und wurde zu diesem Zweck von einigen dienenden Brüdern abgeholt. Bei dem Scheine der gelbroten Flammen der Fackeln glichen die engen Korridore und Grotten jetzt noch mehr Krypten und Höhlen in einem Berge.
Der Greis erzählte, daß Hemi-gompa, wie er sein Kloster nannte, vor 300 Jahren von Doggtsang Raspa erbaut worden sei, einem Lama, der wie der Dalai-Lama durch alle Zeiten weiterlebe. Der jetzige Doggtsang Raspa sei 19 Jahre alt und lebe seit drei Jahren als Eremit ganz allein in einem kleinen „Gompa“ im Gebirge, nicht sehr hoch oben in der Talschlucht, wo die Gegend Gotsang heiße. Er müsse dort noch drei Jahre leben. Sechs Jahre lang dürfe er keinen Menschen sehen und sein Gefängnis überhaupt nicht verlassen. Er müsse die Zeit mit dem Studium der heiligen Schriften und mit Meditation zubringen. In der Nachbarschaft wohne ein dienender Lama, der ihm Nahrung bringe. Diese werde ihm täglich in eine runde Maueröffnung hineingeschoben, aber die Blicke der beiden Männer dürfen sich dabei nie begegnen, und sie dürfen nie miteinander reden; falls es sich um eine besonders wichtige Angelegenheit handle, dürfe ein beschriebener Zettel in die Maueröffnung gelegt werden. Wasser liefere eine kleine Quellader neben dem Tempel. Ich fragte, was er denn anfange, wenn er erkranke, und erhielt die Antwort, er sei so heilig, daß er überhaupt nicht krank werde, und überdies kenne er die Heilmittel für alle Krankheiten der Welt. Alle Doggtsang Raspa hätten sich dieser Läuterung unterzogen. Wenn die sechs Jahre zu Ende seien, komme der Doggtsang Raspa nach Hemis herunter, und wenn er sterbe, gehe sein Geist in einen neuen Doggtsang Raspa über. Es muß schauerlich sein, sechs lange Winter ganz allein in dem stillen Tale zu verleben.
Dreihundert Lamas gehören zum Kloster; den Winter bringen die meisten in anderen Gompa und in Leh zu (Abb. 330, 331, 332, 333, 334).[S. 368] Das Kloster, welches reich ist und viel anbaufähiges Land besitzt, sorgt für ihren Unterhalt. Ein russischer Reisender, der vor einigen Jahren die Welt durch die behauptete „Entdeckung“ eines Manuskriptes über Jesu Leben, das er in Hemis gefunden haben wollte, in Erstaunen setzte, wurde schon damals so gründlich entlarvt, daß ich mich bei ihm nicht weiter aufzuhalten brauche.
Als ich am folgenden Nachmittag den Tempel verließ, erhielt ich allerlei Proviant und ein Schaf, wofür ich unter keiner Bedingung bezahlen durfte. Der Prior begleitete uns zu Pferd bis an die Indusbrücke; in Taggar vereinigten wir uns wieder mit den Unsrigen. —
Die Rückreise durch Asien und Europa könnte Stoff zu noch einer Reisebeschreibung geben, aber ich muß jetzt den Bericht über meine Schicksale schließen; nur ein paar Episoden darf ich nicht übergehen.
Nachdem wir durch das Schejoktal (Abb. 335) auf Yaken den Kara-korum-Paß (5658 Meter) (Abb. 336, 337) erreicht hatten und auf Pferden weitergeritten waren, den Sugett-dawan und den Sandschupaß überschritten hatten und, um uns auszuruhen, ein paar Tage in Kargalik und Jarkent geblieben waren, langten wir am 14. Mai 1902 endlich in Kaschgar an.
Der Frühling prangte in seiner ganzen Schönheit, als ich mit meinem alten Freunde Generalkonsul Petrowskij wieder in wohlbekannten Laubgängen wandelte, ihm von meinen Erfahrungen und Erinnerungen aus dem Herzen von Asien erzählte und ihm für die unschätzbaren Dienste dankte, die er mir während der vergangenen Jahre bei so vielen Gelegenheiten geleistet hatte. Auch Macartney und Pater Hendriks zeigten lebhaftes Interesse für meine Erfahrungen, und ich freute mich ebenso sehr, sie wieder zu sehen, wie die Bekanntschaft der neuangekommenen Missionare Andersson und Bäcklund zu machen, die sich der schwedischen Missionsstation ernstlich annahmen und Grund hatten, mit den Früchten ihrer mühevollen, menschenfreundlichen Arbeit zufrieden zu sein.
Aber ich hatte keine Zeit, mich dort länger aufzuhalten, ich mußte ihnen bald die Hand zum Abschied drücken und westwärts über die Berge eilen. Kutschuk und Chodai Kullu kehrten wieder nach ihren Hütten am Lop zurück und erhielten reichen Lohn für ihre treugeleisteten Dienste.
In Osch verließ ich den alten redlichen Turdu Bai und empfahl ihn aufs wärmste an Oberst Saizeff, in dessen Hause ich wieder einmal eine freundliche Freistatt fand.
Sehr schwer wurde es mir, von Malenki und Maltschik zu scheiden. Ich küßte sie auf die Schnauze und streichelte sie, die angebunden auf dem Hofe standen, als wir in Andischan nach dem Bahnhofe fuhren. Sie sahen mir mit nachdenklichen, fragenden Blicken nach, als hätten sie verstanden, daß ich sie in diesem Augenblick für immer verließ.


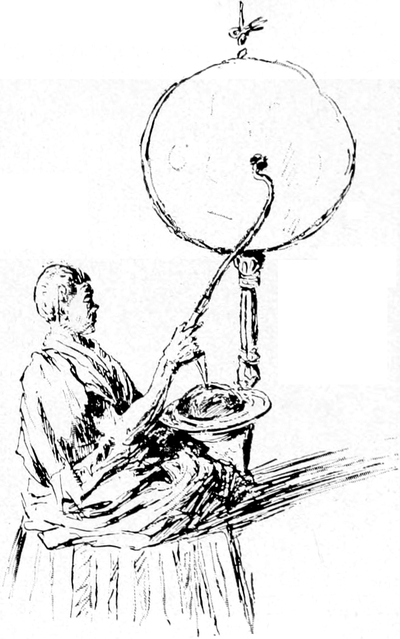



[S. 369]
In Tschernajewa nahm ich herzlichen Abschied von dem prächtigen Tschernoff, der sich über Taschkent nach Wernoje begab. Tscherdon und der Lama begleiteten mich über das Kaspische Meer. Der gute Lama staunte, als er sah, wie die Räder des großen Dampfers uns auf den See hinausbrachten. Beide sollten von Petrowsk nach Astrachan weiterfahren, wo der Lama sich für die Zukunft in einem Kalmückenkloster niederzulassen beabsichtigte. Petrowskij und ich hatten ihn dem Gouverneur aufs beste empfohlen. In Kara-schahr wagte er nicht mehr sich sehen zu lassen, und das Betreten des Gebietes von Lhasa war ihm vom Kamba Bombo für immer untersagt worden; deshalb wurde er russischer Untertan. Tscherdon fuhr mit der sibirischen Eisenbahn wieder nach seiner transbaikalischen Heimat.
Ja, es war schmerzlich, von ihnen allen zu scheiden; hatte ich doch lange Jahre mit diesen Männern durchlebt! Ihre Tränen bewiesen, daß auch sie mit Bedauern und Zuneigung Abschied von mir nahmen. Von einigen von ihnen habe ich später Nachricht erhalten, und ich weiß zu meiner großen Freude, daß Schagdur wenigstens schon innerhalb der Grenzen Rußlands ist und sich bereits in Osch befindet. General Sacharoff in Petersburg hat bei mehreren Gelegenheiten die große Freundlichkeit gehabt, mich von den weiteren Schicksalen meiner lieben Kosaken in Kenntnis zu setzen. Kürzlich erhielt ich einen Brief von Oberst Saizeff, den ich nicht ohne Rührung las. Er enthielt eine Beschreibung davon, wie Schagdur über seine Eindrücke von der ganzen Reise, besonders aber unsern Ritt nach Lhasa und die Reise nach Indien berichtet hatte; es freute mich zu hören, daß er mir ein gutes, liebevolles Andenken bewahrte.
Alle vier Kosaken wurden von König Oskar mit eigens geprägten Goldmedaillen ausgezeichnet, welche zu tragen der Zar ihnen erlaubte. Von ihrem eignen Kaiser wurden sie mit dem Ehrenzeichen des Sankt-Annenordens und je 250 Rubel bedacht. Auch Turdu Bai und Chalmet Aksakal erhielten vom König goldene und Faisullah eine silberne Medaille für treuen, redlichen Dienst. Bei einer Audienz in Peterhof freute sich Kaiser Nikolaus herzlich, als er hörte, wie zufrieden ich mit den Kosaken gewesen, deren Betragen vom ersten bis zum letzten Tage über jedes Lob erhaben gewesen war. An den Kriegsminister General Kuropatkin sandte ich darüber einen offiziellen Bericht.
Ich werde nicht versuchen, die Gefühle zu schildern, die auf mich einstürmten, als ich am 27. Juni 1902 mit dem Dampfer v. Döbeln in die schwedischen Schären einfuhr. Wie manchesmal hatte ich Veranlassung gehabt, mich zu fragen, ob ich diese lieben, alten Felsenklippen, die wie Außenwerke um die Heiligtümer meiner Kindheitserinnerungen stehen, wohl je wiedersehen würde! Drei Jahre und drei Tage, mehr als 1001 Nacht[S. 370] waren vergangen, seit ich von meinen Eltern und Geschwistern Abschied genommen hatte. Wie bitter war jener Junitag gewesen gegen diesen, an dem ich sie alle gesund und über meine Heimkehr beglückt wiedersah. Sie erwarteten mich auf demselben Kai, auf dem wir einander Lebewohl gesagt hatten. Jetzt prangte ein neuer Sommer in seiner größten Schönheit, und die Fliederbüsche blühten gerade wie damals. Die langen Jahre, die inzwischen vergangen waren, erschienen mir wie ein Traum; es war mir, als sei ich nur ein paar Tage fortgewesen, alles war unverändert.
Schon am folgenden Tage durfte ich dem König, der stets mit so warmem, erlauchtem Interesse, so großartiger Freigebigkeit und väterlicher Huld meine Pläne beschützt, ihre Ausführung gefördert und mich persönlich ausgezeichnet hatte, über das Ergebnis der jetzt beendeten Reise Bericht erstatten. Ein neuer Stein war dem Bau hinzugefügt worden, der, wie ich hoffe, noch lange nicht fertig ist.
Doch das Beste von allem war, wieder zu Hause zu sein und das innerste Asien und Tibet, die meine Gedanken so lange beschäftigt hatten, für einige Zeit vergessen zu dürfen. Je größere Kreise man um die Erde zieht, desto heißer wird die Liebe zum Vaterland, besonders wenn dieses, wie das meine, so reich an Ehre und glorreichen Erinnerungen ist. Wenn alle gutgesinnten Bewohner des Reiches es verständen, auf den schon in der Wiege ihnen gewordenen Ehrentitel stolz zu sein, nämlich darauf, daß sie einer Nation angehören, deren Geschichte zu einem großen Teil eine Heldengeschichte ist, so würden keine äußeren Gefahren je unsere Freiheit bedrohen können. Unsere Kraft wächst, und unsere Lage ist jetzt unendlich viel besser, als sie es während mancher kritischen Augenblicke in vergangenen Zeiten war. Doch die Vaterlandsliebe ist unser hauptsächlichster Schutz. Sie muß im Elternhause und in der Schule eingeprägt, in den Kirchen gepredigt und in den Kasernen entflammt werden; sie muß das ganze Volk durchdringen, ihm Kraft und Eintracht schenken und jeden einsehen lehren, daß das Vaterland allen anderen irdischen Interessen vorgeht. Wenn alle an demselben großen Ziele arbeiten, wenn eigennützige Bestrebungen in den Hintergrund treten, dann können wir mit frohen Hoffnungen einer neuen Größezeit innerhalb unserer eigenen Grenzen entgegensehen.
Wenn man, wie ich, in vielen Ländern gesehen und erfahren hat, wie andere Menschen leben müssen, muß man sich beglückwünschen, einem Volke anzugehören, dem ein so glückliches Los zugefallen ist wie dem unsrigen.
Ohne eigne Vergleiche ist es jedoch vielleicht schwer, diese Überzeugung zu gewinnen. Glaubt daher meinen Worten, wenn ich mit diesen wenigen Zeilen meine Erfahrungen andeute!
Und hiermit sage ich dem geduldigen Leser für diesmal Lebewohl!
[S. 371]
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.